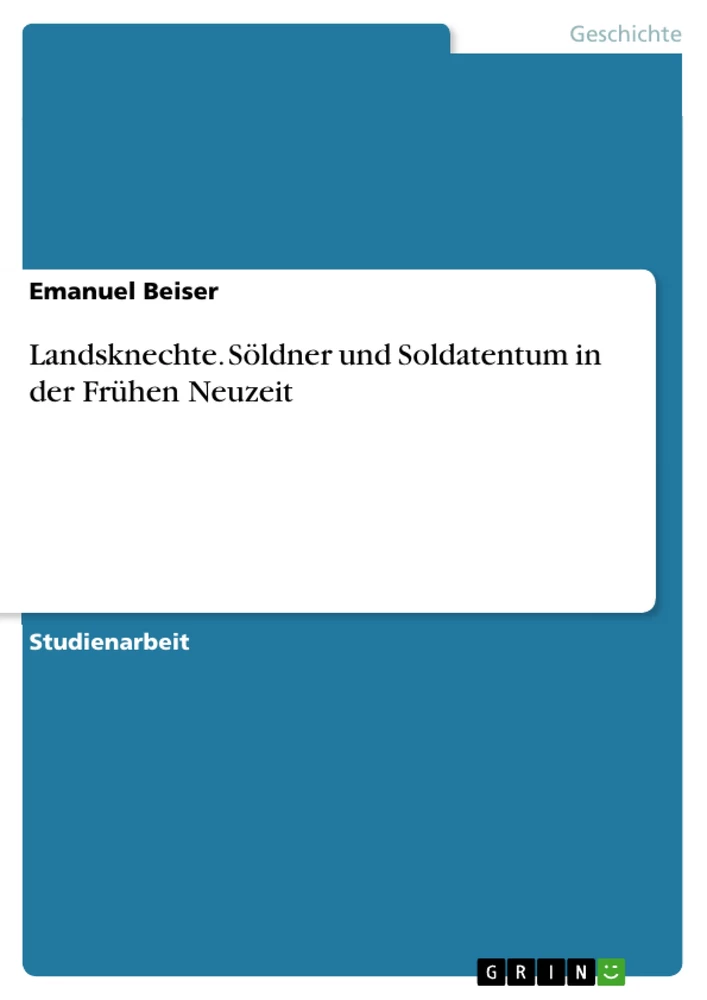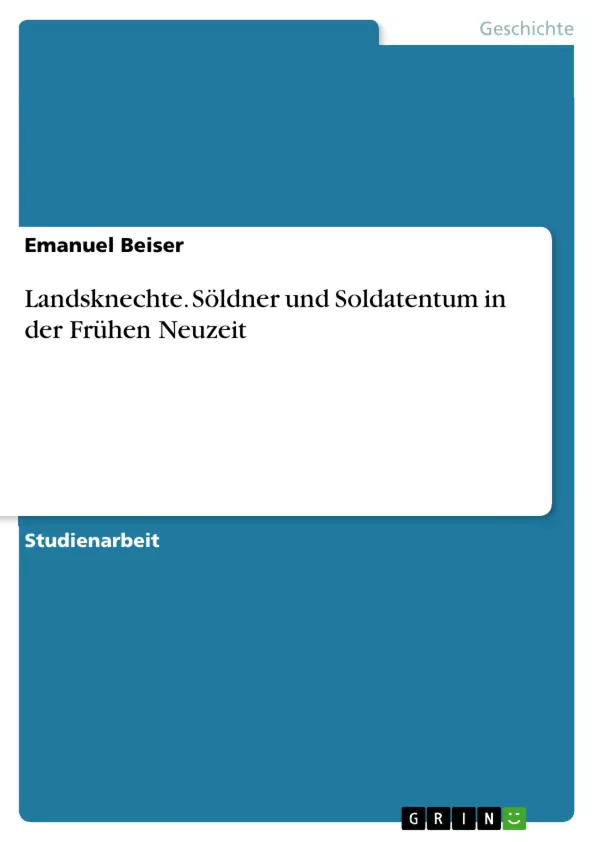Die Zeit des Überganges zwischen Mittelalter und Neuzeit war teilweise von großen Veränderungen und Umwälzungen gekennzeichnet. Diese Veränderungen traten nicht schlagartig, sondern in einem mehrere Jahrhunderte dauernden Prozess auf. Besonders im Bereich des Militärischen kam es wieder zu einer Blüte des Fußvolkes und das vorher dominierende Rittertum erlebte langsam seinen Niedergang. Mit diesen Umwälzungen waren natürlich auch Veränderungen und Spannungen im gesellschaftlichen Leben und im Staatsentstehungsprozess inbegriffen. Auch im territorialen Einflussbereich der Habsburger veränderte sich einiges bzw. von hier gingen auch die ersten Schritte einer maßgebenden militärischen Veränderung aus. Daher werde ich versuchen, soweit möglich, auch die Situation im Tiroler Raum genauer zu beschreiben. In der folgenden Arbeit möchte ich die Situation der Landsknechte und der Söldner in der frühen Neuzeit kurz schildern und auf das Spannungsverhältnis zwischen Söldnern und Staat bzw. Fürst näher eingehen. Zu Beginn werde ich kurz den Söldner definieren und dann einen Überblick über die Voraussetzungen, die Entstehung, die Motive und den Niedergang des Söldnerwesens liefern. Als zweites werde ich näher auf das Spannungsverhältnis zwischen Söldnern und Staat bzw. Fürst eingehen. Hierbei werde ich auch die Verhältnisse in Tirol kurz schildern. Im dritten Punkt der Arbeit wird über das Verhältnis von Söldnern zur Gesellschaft, vor allem zur Bevölkerung berichtet. Auch hier wird ein Schwerpunkt auf Tirol gelegt.
Meine Fragestellungen zu diesem Thema lauten wie folgt:
Wie trug das Söldnerwesen als quasi „privatisiertes Kriegswesen“ zum Staatsentstehungsprozess bei?
Wie entwickelte sich das Söldnerwesen im Laufe der Zeit bis hin zum Stehenden Heer und wie gestaltet sich das Spannungsverhältnis zwischen Söldnern, Staat und der Bevölkerung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Erklärung und die Entwicklung des Söldnertums
- Definition
- Ursprünge und Voraussetzungen
- Niedergang
- Das Verhältnis zwischen den Söldnern und dem Staat bzw. dem Fürst
- Verstaatlichungsprozess
- Konflikte mit den Ständen
- Aufgebotswesen und Defensionsordnungen
- Probleme des Fürsten mit Söldnern
- Gartknechte
- Die Situation in Tirol
- Das Verhältnis zwischen den Söldnern und der Gesellschaft
- Das Ansehen in der Gesellschaft
- Tiroler Söldner
- Werbeverbote in Tirol
- Das Ansehen der Söldner innerhalb der Tiroler Bevölkerung
- Wehrhafte Tiroler Bauern
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Söldnerwesen, insbesondere die Landsknechte, in der frühen Neuzeit und deren Spannungsverhältnis zu Staat und Gesellschaft. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Söldnerwesens, seine Ursachen und seinen Niedergang. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Situation in Tirol.
- Definition und Entwicklung des Söldnerwesens
- Das Verhältnis zwischen Söldnern und dem Staat/Fürsten
- Die soziale Stellung der Söldner in der Gesellschaft
- Die Rolle der Landsknechte im Kontext der militärischen Veränderungen
- Der Einfluss des Söldnerwesens auf den Staatsbildungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, indem sie den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit als eine Zeit großer Veränderungen darstellt, die sich besonders im militärischen Bereich durch die Blüte des Fußvolkes und den Niedergang des Rittertums manifestierte. Die Arbeit fokussiert auf die Landsknechte und Söldner der frühen Neuzeit und deren komplexes Verhältnis zu Staat und Gesellschaft, wobei ein besonderer Fokus auf die Situation in Tirol liegt. Die zentralen Forschungsfragen befassen sich mit dem Beitrag des Söldnerwesens zum Staatsentstehungsprozess und der Entwicklung des Söldnerwesens hin zum stehenden Heer, sowie dem Spannungsverhältnis zwischen Söldnern, Staat und Bevölkerung. Es wird auf relevante Literatur hingewiesen.
Die Erklärung und die Entwicklung des Söldnertums: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Söldners und unterscheidet ihn von den späteren stehenden Heeren. Es beschreibt die Ursprünge des Söldnerwesens, beginnend mit der Antike und dem Mittelalter, und analysiert die Voraussetzungen für dessen Blüte in der frühen Neuzeit. Hierzu zählen die zunehmende Bedeutung der Geldwirtschaft, die militärisch-technische Entwicklung (Feuerwaffen, Fußtruppen), das Versagen des mittelalterlichen Lehensheeres und die Verarmung des Adels. Soziale und wirtschaftliche Faktoren wie Missernten, Bevölkerungswachstum und Unterbeschäftigung werden als treibende Kräfte für den Söldnerdienst hervorgehoben. Die unterschiedlichen Motivationen für Söldnerdienst (wirtschaftliche Not, Beute, Ruhm, Adelsprivilegien) werden diskutiert, ebenso wie die Vorteile für Regionen, die Söldnerwerbung erlaubten. Schließlich wird die Rolle Kaiser Maximilians I. bei der Begründung der Landsknechte und deren Reformierung des Heeres beschrieben, unter Betonung ihres hohen Ansehens und ihrer inneren Struktur.
Das Verhältnis zwischen den Söldnern und dem Staat bzw. dem Fürst: Dieses Kapitel behandelt die komplexe Beziehung zwischen Söldnern und dem Staat. Der Verstaatlichungsprozess des Militärs wird diskutiert, inklusive der Konflikte mit den Ständen. Es wird die Rolle des Aufgebotswesens und der Defensionsordnungen analysiert sowie die Probleme, die Fürsten mit ihren Söldnern hatten. Die Gartknechte werden erwähnt und schließlich wird die Situation in Tirol genauer beleuchtet, womit ein regionaler Vergleich zum allgemeinen Kontext des Söldnerwesens möglich wird.
Das Verhältnis zwischen den Söldnern und der Gesellschaft: Dieses Kapitel analysiert das Ansehen der Söldner in der Gesellschaft, sowohl allgemein als auch im speziellen Kontext Tirols. Es werden Werbeverbote in Tirol behandelt, das Ansehen der Söldner innerhalb der Tiroler Bevölkerung beleuchtet und die Rolle wehrhafter Tiroler Bauern im Kontext des Söldnerwesens diskutiert. Das Kapitel verbindet die soziale Wahrnehmung der Söldner mit den politischen und ökonomischen Realitäten der Zeit.
Schlüsselwörter
Landsknechte, Söldnerwesen, Frühe Neuzeit, Staat, Gesellschaft, Tirol, Militärgeschichte, Habsburger, Staatsbildung, Verstaatlichung, Konflikte, Soziale Stellung, Wirtschaftliche Bedingungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Söldnerwesen in der Frühen Neuzeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Söldnerwesen, insbesondere die Landsknechte, in der frühen Neuzeit und deren komplexes Verhältnis zu Staat und Gesellschaft. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung des Söldnerwesens, seinen Ursachen und seinem Niedergang, mit besonderem Augenmerk auf die Situation in Tirol.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Entwicklung des Söldnerwesens, das Verhältnis zwischen Söldnern und dem Staat/Fürsten, die soziale Stellung der Söldner in der Gesellschaft, die Rolle der Landsknechte im Kontext der militärischen Veränderungen und den Einfluss des Söldnerwesens auf den Staatsbildungsprozess. Die Arbeit analysiert die Ursprünge des Söldnerwesens, die verschiedenen Motivationen der Söldner, die Konflikte mit den Ständen und die Probleme der Fürsten mit ihren Söldnern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ansehen der Söldner in der Gesellschaft und der spezifischen Situation in Tirol, inklusive Werbeverboten und der Rolle der Tiroler Bauern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Erklärung und Entwicklung des Söldnertums, ein Kapitel zum Verhältnis zwischen Söldnern und Staat/Fürst, ein Kapitel zum Verhältnis zwischen Söldnern und Gesellschaft und ein Schlusswort. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Thematik. Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit und die Forschungsfragen. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über die behandelten Inhalte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Landsknechte, Söldnerwesen, Frühe Neuzeit, Staat, Gesellschaft, Tirol, Militärgeschichte, Habsburger, Staatsbildung, Verstaatlichung, Konflikte, Soziale Stellung, Wirtschaftliche Bedingungen.
Was sind die zentralen Forschungsfragen der Arbeit?
Die zentralen Forschungsfragen befassen sich mit dem Beitrag des Söldnerwesens zum Staatsentstehungsprozess und der Entwicklung des Söldnerwesens hin zum stehenden Heer, sowie dem Spannungsverhältnis zwischen Söldnern, Staat und Bevölkerung.
Welche Rolle spielte Kaiser Maximilian I.?
Die Arbeit beschreibt die Rolle Kaiser Maximilians I. bei der Begründung der Landsknechte und deren Reformierung des Heeres, unter Betonung ihres hohen Ansehens und ihrer inneren Struktur.
Wie wird die Situation in Tirol in der Arbeit behandelt?
Die Situation in Tirol wird als regionaler Vergleich zum allgemeinen Kontext des Söldnerwesens verwendet. Die Arbeit beleuchtet die spezifische Situation in Tirol, einschließlich Werbeverboten, dem Ansehen der Söldner innerhalb der Tiroler Bevölkerung und der Rolle wehrhafter Tiroler Bauern.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit verweist auf relevante Literatur, jedoch wird die genaue Quellenangabe nicht im FAQ dargestellt.
- Citar trabajo
- Emanuel Beiser (Autor), 2010, Landsknechte. Söldner und Soldatentum in der Frühen Neuzeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263634