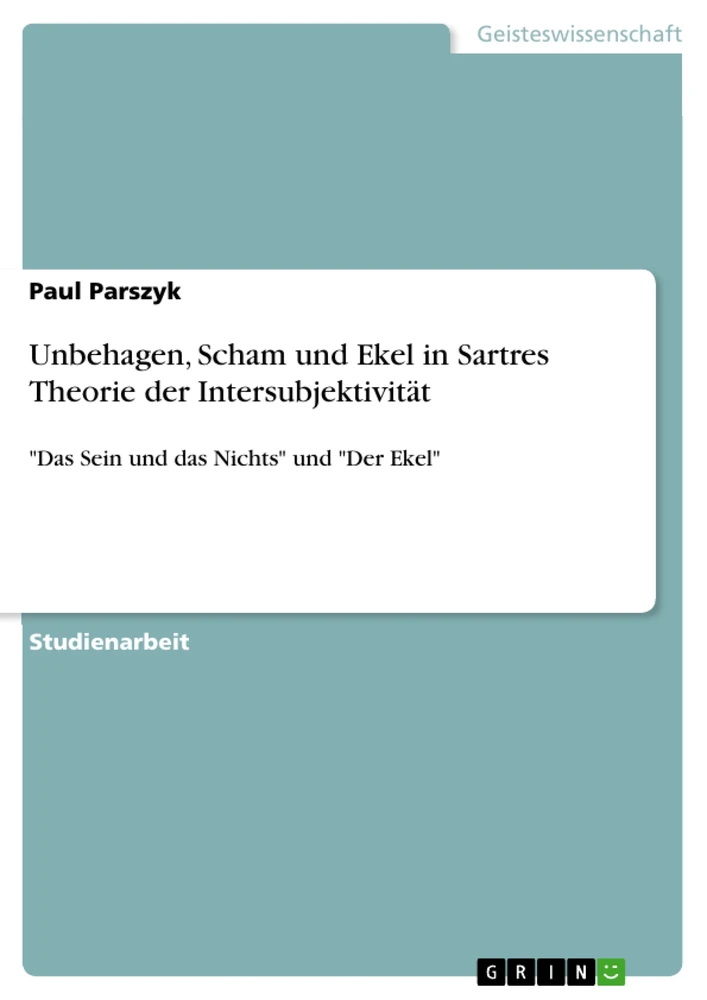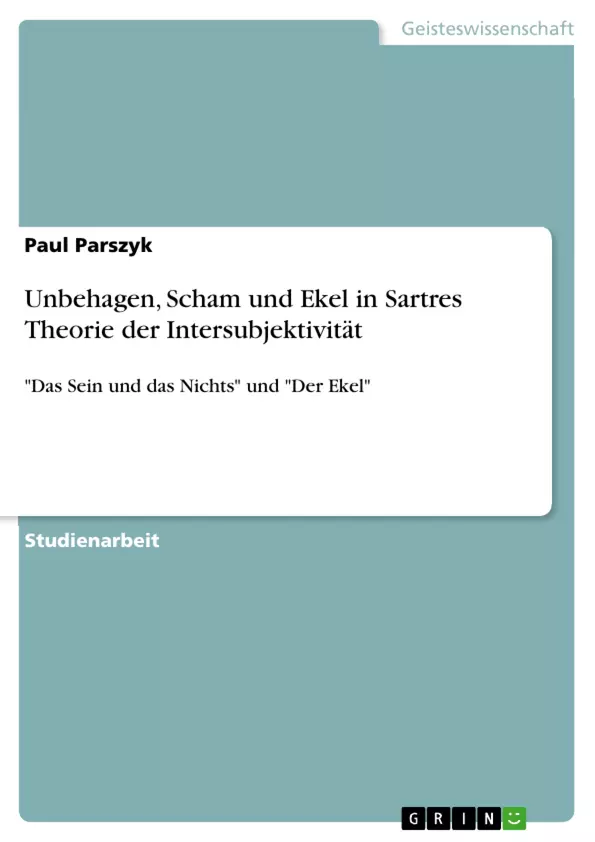Auch Sartre begab sich auf die Such nach dem Sein. Ihn aber interessierte nicht nur, was ist, sondern was passiert, wenn Sein auf Sein trifft. Stellen Sie sich vor, sie sitzen in einem Wartezimmer und warten. Plötzlich kommt jemand herein. Was ist nun anders? Warum ändert sich ihr Verhalten? Ändert sich ihr Verhalten?
Intersubjektivität ist ein Phänomen des Alltags, jedoch als Thema in der Philosophie selten. Daher ist das Angebot an Theorien rar. Sartre widmet sich diesem Phänomen als Phänomen: Was so viel heißt wie, dass Sartre nicht nur das Phänomen Intersubjektivität beschreiben will – und damit allgemeine Ereignisse wie Scham durch den Blick oder Ekel in konkreten Situationen – sondern phänomenologisch argumentieren will. Er startet einen Versuch einer phänomenologischen Ontologie – so der Untertitel – in seinem schwerzugänglichen Mammutwerk „Das Sein und das Nichts“.
Die Arbeit legt den Schwerpunkt auf Themen wie Begierde, Ekel, Scham, Unbehagen und Existenz in "Der Ekel" und in Sartres Hauptwerk: Das Sein und das Nichts - Versucht einer phänomenologischen Ontologie" (- so werden auch Husserl und Heidegger sowie Hegel kurz angerissen) ...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Intersubjektivität als Phänomen bei Sartre
- Sartre, Hegel, Husserl und Heidegger
- An-sich und Für-sich
- Tanszendentales Ego und der Blick als Struktur
- Ekstasen (des Bewusstseins)
- Ekel
- Unbehagen
- Scham
- Ekel
- Begierde
- Der Ekel in Der Ekel
- Existenz als Menschlichkeit und (Ekel vor der) Verantwortung
- Schlussteil
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit Sartres Theorie der Intersubjektivität, insbesondere mit den Phänomenen des Unbehagens, der Scham und des Ekels. Sie analysiert diese Gefühle im Kontext von Sartres Hauptwerk "Das Sein und das Nichts" sowie in seinem Roman "Der Ekel".
- Intersubjektivität als konstitutives Moment der menschlichen Existenz
- Der Einfluss des "anderen" auf das Selbstverständnis
- Die Bedeutung des "Blicks" als Struktur der Wahrnehmung
- Unbehagen, Scham und Ekel als Ausdruck des menschlichen Daseins in der Welt
- Die Rolle der Freiheit und Verantwortung in Sartres Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Intersubjektivität bei Sartre ein und beschreibt den Ansatz der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die philosophischen Grundlagen von Sartres Intersubjektivitätstheorie, insbesondere die Einflüsse von Hegel, Husserl und Heidegger. Es werden zentrale Begriffe wie "An-sich" und "Für-sich" sowie die Rolle des transzendentalen Egos und des Blicks als Struktur der Wahrnehmung diskutiert. Kapitel 3 widmet sich dem Phänomen des Ekels, wobei Unbehagen und Scham als Vorstufen betrachtet werden. Die Bedeutung des Ekels in "Der Ekel" wird analysiert, und die Verbindung von Ekel und menschlicher Verantwortung wird erörtert. Im Schlussteil wird die Arbeit zusammengefasst und die zentralen Ergebnisse hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Intersubjektivität, Sartre, "Das Sein und das Nichts", "Der Ekel", Unbehagen, Scham, Ekel, Blick, Freiheit, Verantwortung, Existenz, An-sich, Für-sich, transzendentales Ego, Unaufrichtigkeit.
- Citar trabajo
- BA Paul Parszyk (Autor), 2013, Unbehagen, Scham und Ekel in Sartres Theorie der Intersubjektivität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263639