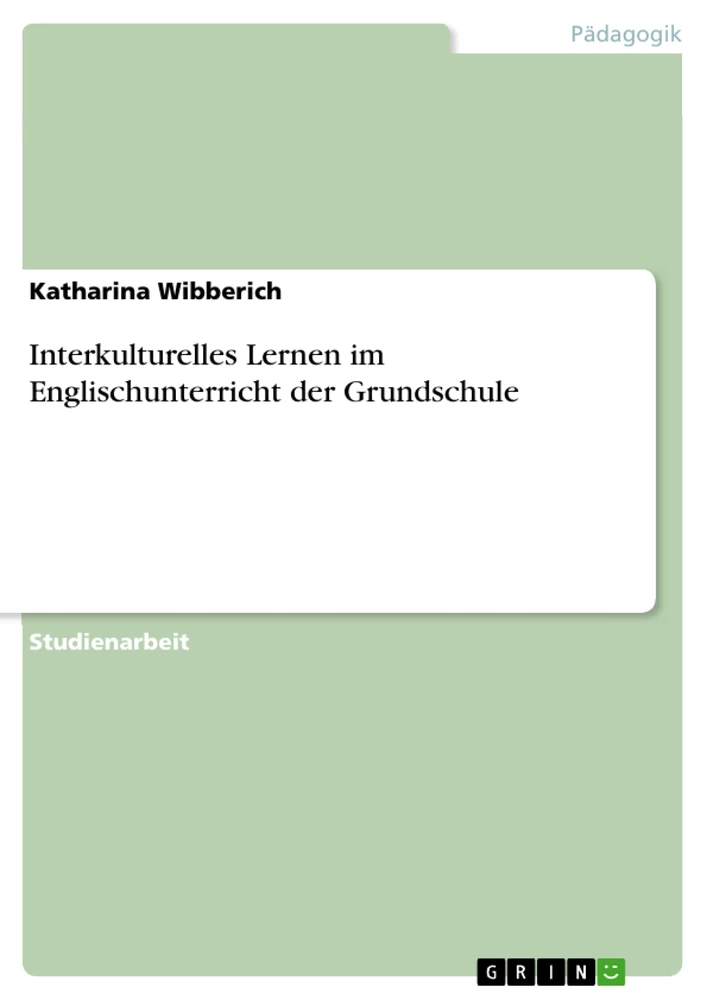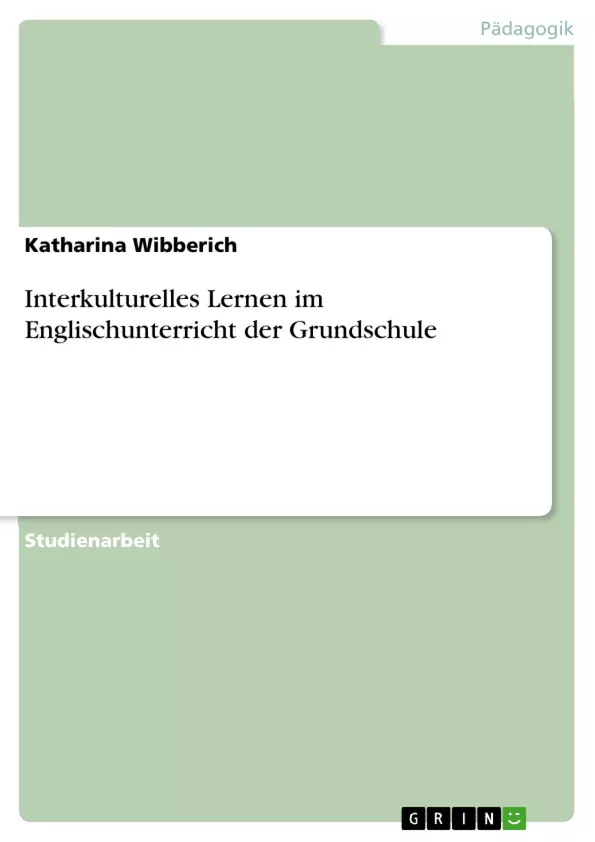Interkulturelles Lernen bildet einen wesentlichen Bestandteil des Englischunterrichts in der Grundschule. Der Lehrplan legt insbesonders Wert auf einen authentischen Zugang zu unterschiedlichen englischsprachigen Kulturen. Diese Arbeit stellt zunächst den Wert des interkulturellen Lernens im Grundschulunterricht heraus, um dann konkret auf exemplarische Beispiele einzugehen, die das interkulturelle Lernen im Unterricht verankern können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Fragestellung
- 2. Authentizität im Unterricht
- 2.1. Interkulturelles Lernen durch interaktive Projekte
- 2.2. Interkulturelles Lernen durch englische Kinderliteratur
- 2.3. Interkulturelles Lernen durch den Einsatz der Handpuppe
- 2.4. Interkulturelles Lernen durch Feste und Traditionen
- 3. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Integration des interkulturellen Lernens in den Englischunterricht der Grundschule. Sie beleuchtet die Bedeutung des Themas und erörtert verschiedene methodische Ansätze zur Förderung des interkulturellen Verstehens im Unterricht.
- Die Bedeutung von Authentizität im interkulturellen Lernen
- Die Rolle von interaktiven Projekten, englischer Kinderliteratur und der Handpuppe im interkulturellen Unterricht
- Die Einbindung von Festen und Traditionen in den Unterricht
- Die Förderung von Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten im Englischen
- Der Aufbau von Orientierungswissen und Verständnis für andere Kulturen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Relevanz des interkulturellen Lernens im Englischunterricht der Grundschule und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Kapitel 2 untersucht den Begriff der Authentizität im Unterricht und diskutiert verschiedene Ansätze zur Förderung des interkulturellen Lernens, darunter interaktive Projekte, englische Kinderliteratur, die Handpuppe und die Einbindung von Festen und Traditionen.
Schlüsselwörter
Interkulturelles Lernen, Englischunterricht, Grundschule, Authentizität, Lebenswelten, interaktive Projekte, Kinderliteratur, Handpuppe, Feste und Traditionen, Kulturvergleich, Kommunikation, Interaktion.
- Quote paper
- Katharina Wibberich (Author), 2011, Interkulturelles Lernen im Englischunterricht der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263648