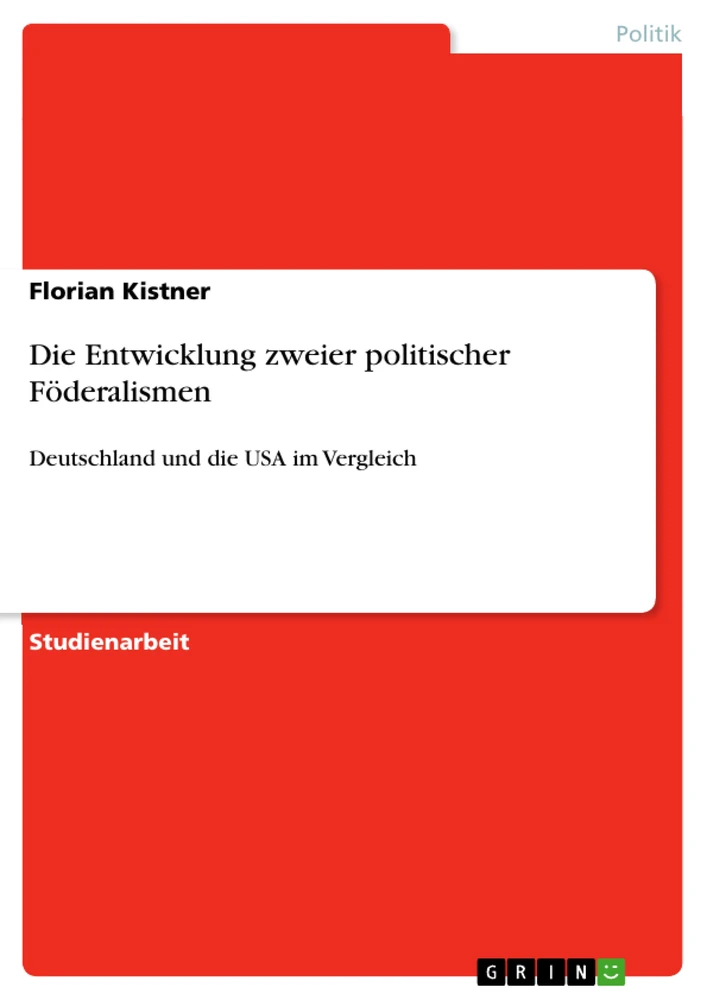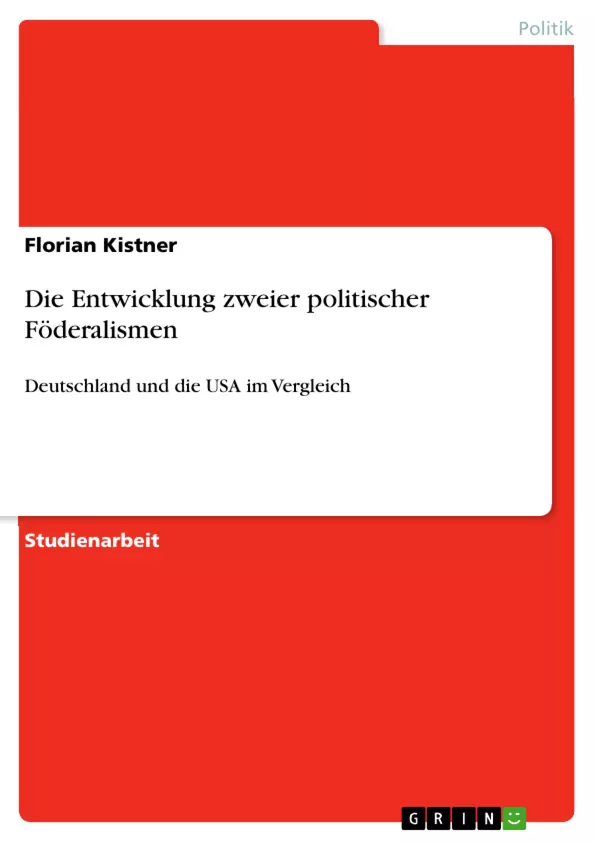Der Föderalismus ist ein wesentliches Merkmal zweier westlicher politischer Systeme. Deutschland und die USA sind Musterbeispiele in Fragen der vertikalen Gewaltenteilung. Doch sind hier zwei Systeme entstanden, die verschiedenen historischen Entwicklungen unterlagen, woraus sich zwei verschiedene Verfassungen und damit auch Formen des Föderalismus entwickelt haben. Welche historischen Entwicklungen haben zu den heutigen Verfassungen und den damit verbundenen Föderalismen geführt? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich die vorliegende Seminararbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Aufbau und Methodik
- Forschungsstand
- Föderalismus: Eine Erklärung
- Geschichte des Föderalismus
- Die historische Entwicklung in Deutschland
- Von Napoléon zum Norddeutschen Bund
- Von der Reichseinigung zum Dritten Reich
- Von den Besatzungszonen zur Wiedervereinigung
- Die historische Entwicklung in den USA
- Von den Kolonien zu den frühen Gründen für den amerikanischen Föderalismus
- Vom Unabhängigkeitskrieg zur Aufnahme Kaliforniens und Texas
- Vom Sezessionskrieg zum 50. Bundesstaat
- Gesetzliche Grundlagen und Kompetenzverteilung heute
- Deutschland
- Gesetzliche Grundlagen in Deutschland
- Kompetenzverteilung in Deutschland
- Die USA
- Gesetzliche Grundlagen in den USA
- Kompetenzverteilung in den USA
- Schlussanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung des Föderalismus in Deutschland und den USA im Vergleich, indem sie die historischen Hintergründe und die aktuellen verfassungsrechtlichen Grundlagen beleuchtet.
- Analyse der historischen Entwicklung des Föderalismus in Deutschland und den USA
- Identifizierung der wichtigen Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Föderalismus in beiden Ländern
- Vergleich der aktuellen verfassungsrechtlichen Grundlagen des Föderalismus in Deutschland und den USA
- Beurteilung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Föderalismusmodelle
- Bewertung der Rolle des Föderalismus in der politischen und gesellschaftlichen Ordnung Deutschlands und der USA
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Fragestellung, den Aufbau und die Methodik sowie den Forschungsstand dar.
- Föderalismus: Eine Erklärung: Dieses Kapitel liefert eine Definition des Föderalismus und unterscheidet ihn von anderen politischen Ordnungssystemen.
- Geschichte des Föderalismus: Die historische Entwicklung des Föderalismus wird sowohl in Deutschland als auch in den USA dargestellt. Dabei werden wichtige Meilensteine und Veränderungen beleuchtet.
- Gesetzliche Grundlagen und Kompetenzverteilung heute: Die aktuellen verfassungsrechtlichen Grundlagen des Föderalismus in Deutschland und den USA werden analysiert und die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern bzw. Bundesstaaten untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Föderalismus, politische Systeme, Geschichte, Verfassung, Kompetenzverteilung, Deutschland, USA, Vertikale Gewaltenteilung, Bundesstaat, Einheitsstaat, Staatenbund, Partikulare, Unitarisch, Säkularisierung, Mediatisierung, Reichsdeputationshauptschluss, Rheinbund, Wiener Kongress, Deutscher Bund, Norddeutscher Bund, Deutsches Reich, Weimarer Republik, Gleichschaltung, Dritte Reich, Besatzungszonen, Bundesrepublik, Deutsche Demokratische Republik, Wiedervereinigung, Kolonien, Unabhängigkeit, Sezessionskrieg, Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, Grundgesetz.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet den deutschen vom US-amerikanischen Föderalismus?
Die Arbeit vergleicht die historische Entwicklung und die daraus resultierenden unterschiedlichen Verfassungsstrukturen und Kompetenzverteilungen beider Länder.
Wie entwickelte sich der Föderalismus in Deutschland historisch?
Der Weg führte vom Rheinbund über den Deutschen Bund und das Kaiserreich bis hin zur Bundesrepublik nach 1945 und der Wiedervereinigung.
Was waren die Ursprünge des Föderalismus in den USA?
Der US-Föderalismus entstand aus dem Zusammenschluss der ehemaligen Kolonien, dem Unabhängigkeitskrieg und der Notwendigkeit einer vertikalen Gewaltenteilung.
Welche Rolle spielt das Grundgesetz für den deutschen Föderalismus?
Das Grundgesetz legt die gesetzlichen Grundlagen und die genaue Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern fest.
Was bedeutet „vertikale Gewaltenteilung“?
Es ist die Aufteilung der staatlichen Macht auf verschiedene Ebenen (Zentralstaat und Gliedstaaten), um Machtmissbrauch zu verhindern.
Wie beeinflusste der Sezessionskrieg den US-Föderalismus?
Der Bürgerkrieg war ein entscheidender Wendepunkt für das Verhältnis zwischen den Einzelstaaten und der Bundesregierung in den USA.
- Citation du texte
- Florian Kistner (Auteur), 2013, Die Entwicklung zweier politischer Föderalismen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263649