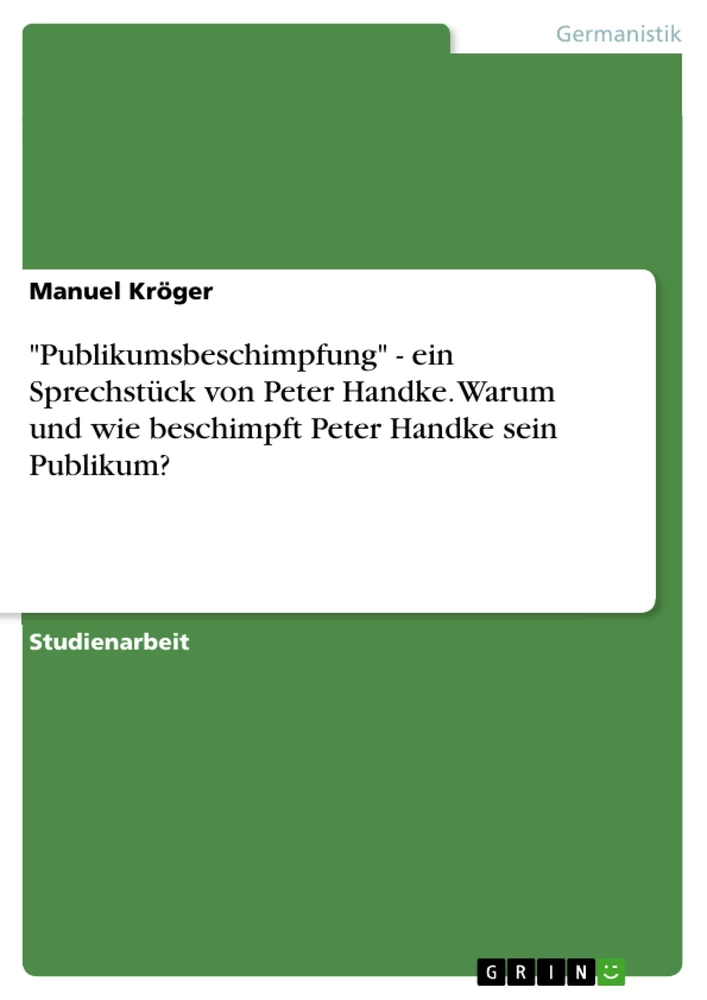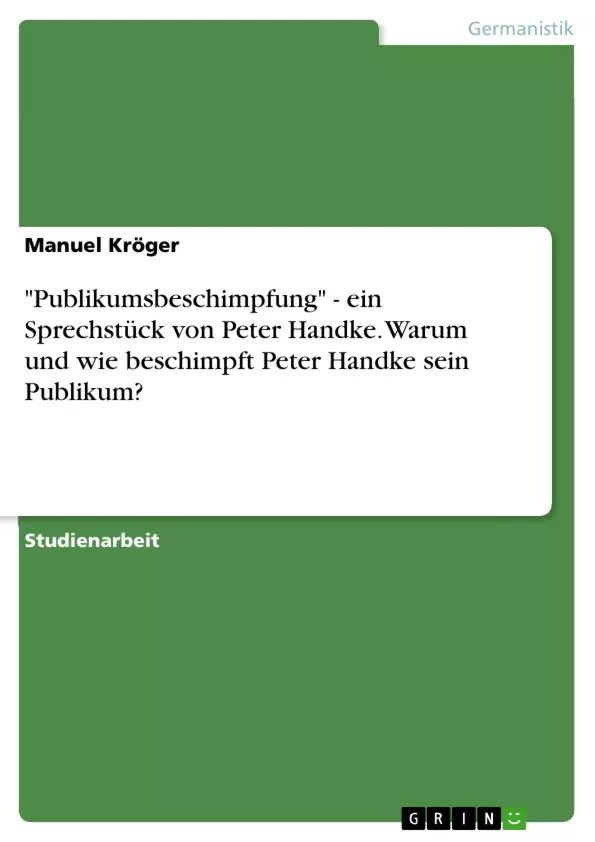Handkes Publikumsbeschimpfung ist nicht als Beschimpfung eines Publikums angelegt, wie der Titel vermuten lässt. Auf jeden Fall ist dies nicht der Sinn des Werks. Durch diese Aufdeckung der Irreführung nähern wir uns dem Sinn schon weiter. Beschimpft wird erst auf den letzten fünf Seiten und das mit vorausgehender Warnung, dazu noch unterbrochen von Lobesreden an das Publikum.1
Laut seiner eigenen Exposition ist das Stück auch kein Theaterstück, sondern eine „Vorrede“2. Es ist ein Sprechstück3, mit vier Schauspielern, die nicht schauspielen4, sondern bloß sprechen. Also eigentlich keine Schauspieler, nur Sprecher.5 Und das, was sie sprechen, hat keine tiefere Bedeutung.
Ein Titel, der nicht hält, was er verspricht, ein Theaterstück, das keines ist, Schauspieler, die nicht spielen, ein Theatertext, der keine weitere Bedeutung in sich trägt? Welchen Sinn hat das alles? Keinen? Oder doch einen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Form und Aufbau
- Die ,,Regeln für die Schauspieler“
- Die fugale Struktur des Werks
- Inhalt
- Intention des Werks, sein „Sinn“, seine „Bedeutung\"
- Die Verwehrung der Bedeutung und des Schauspiels
- Die Beschimpfung: Warum das Publikum beschimpfen?
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Theatertextanalyse untersucht Peter Handkes Sprechstück „Publikumsbeschimpfung“ und analysiert dessen Form, Aufbau, Inhalt und Intention. Das Stück stellt konventionelle theatralische Elemente in Frage und hinterfragt den Sinn und die Bedeutung von Theater im Allgemeinen.
- Die Dekonstruktion des Theaters
- Die Verweigerung von Bedeutung und Sinn
- Die Rolle des Publikums im Theater
- Die sprachliche Gestaltung des Textes
- Handkes Kritik an den Erwartungen und Konventionen des Theaters
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Handkes „Publikumsbeschimpfung“ ist kein klassisches Theaterstück, sondern eine „Vorrede", ein Sprechstück mit vier Sprechern, die keine Figuren darstellen, sondern den Autor und dessen Gedanken repräsentieren. Der Text selbst hat keine tiefere Bedeutung und hinterfragt traditionelle Theatralität.
Form und Aufbau
Die Dramenform wird in „Publikumsbeschimpfung“ unterwandert. Der Text ist ein monologischer Theatertext, obwohl vier Sprecher beteiligt sind. Der Text ist in vier Sprechrollen aufgeteilt, aber es findet kein Dialog im eigentlichen Sinne statt. Es wird eine vierstimmige Fuge-Struktur angelegt, was durch die „Pop-Fuge“ „Tell me“ von den Rolling Stones angedeutet wird.
Die „Regeln für die Schauspieler“
Handke gibt detaillierte Anweisungen für die Schauspieler, um die Stimmung vor dem Beginn eines Stücks zu erzeugen. Die Schauspieler sollen verschiedene Dinge hören und sehen, um sich auf ihre Rolle vorzubereiten. Es sollen keine Figuren, sondern Sprecher agieren, welche dem Publikum Schimpfwörter entgegenrufen, ohne dass diese an eine bestimmte Person gerichtet sind.
Schlüsselwörter
Peter Handke, Sprechstück, Publikumsbeschimpfung, Theatertextanalyse, Dekonstruktion, Bedeutung, Sinn, Schauspieler, Sprecher, Monolog, Dialog, Fuge, Inszenierung, Erwartungshaltung, Schimpfwörter, Sprache
Häufig gestellte Fragen
Ist Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“ wirklich eine Beschimpfung?
Obwohl der Titel es vermuten lässt, erfolgt eine tatsächliche Beschimpfung erst am Ende des Stücks und dient eher der Dekonstruktion theatraler Erwartungen.
Was ist ein „Sprechstück“?
Ein Sprechstück verzichtet auf Handlung, Rollencharaktere und Bühnenbild. Es konzentriert sich rein auf die Sprache und die Sprechakte der Akteure.
Warum gibt es keine Handlung in diesem Stück?
Handke wollte die traditionelle Illusion des Theaters brechen. Das Publikum soll nicht eine Geschichte beobachten, sondern sich seiner eigenen Rolle im Raum bewusst werden.
Welche Struktur hat das Werk?
Das Stück folgt einer fugalen Struktur, ähnlich einer musikalischen Komposition, in der Themen wiederholt und variiert werden.
Welche Rolle spielen die Schauspieler?
Sie agieren nicht als fiktive Figuren, sondern als Sprecher, die direkt zum Publikum sprechen und konventionelle Theaterregeln thematisieren.
- Quote paper
- Manuel Kröger (Author), 2011, "Publikumsbeschimpfung" - ein Sprechstück von Peter Handke. Warum und wie beschimpft Peter Handke sein Publikum?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263704