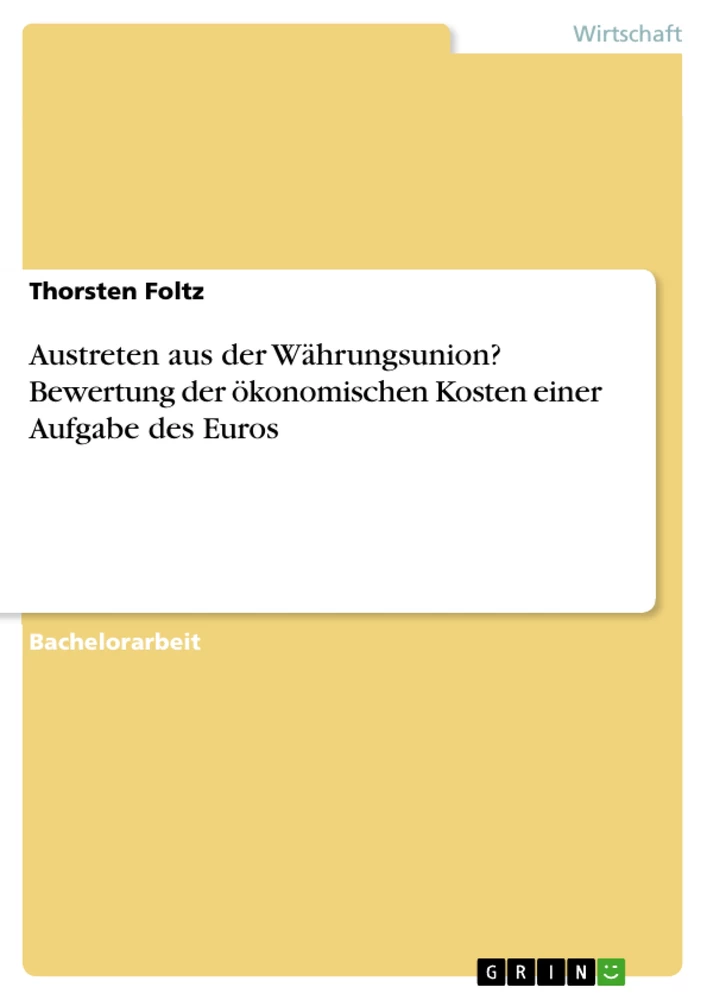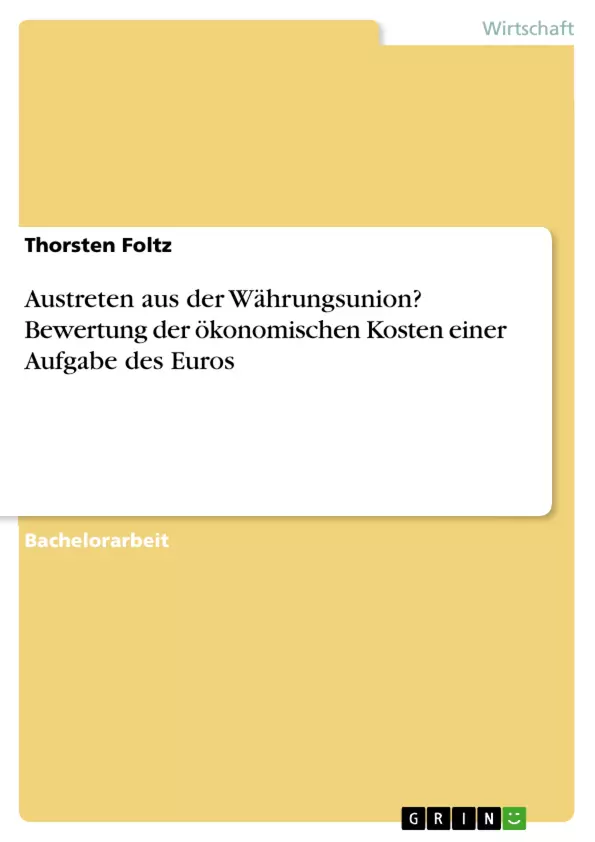Die Eurokrise stellt viele Bürger und Politiker vor die Frage, ob der Austritt eines Landes oder gar die Auflösung der gesamten Währungsunion nicht die Lösung der Probleme darstellt. Drei Szenarien werden gegenwärtig diskutiert. Soll ein wirtschaftlich schwaches Mitglied wie Griechenland oder ein wirtschaftlich starkes Mitglied wie Deutschland austreten, oder sollte möglicherweise die Währungsunion selbst aufgelöst werden?
Diese Arbeit zeigt, dass ein Austritt eines Mitgliedstaates aus der Eurozone, unabhängig davon, welches Mitgliedsland austritt, den Zusammenbruch der Währungsunion und auch den der Europäischen Union zur Folge hätte. Die ökonomischen Kosten des Austrittes eines Landes würden diejenigen einer Beibehaltung des Euro weit übertreffen.
Eine neue Große Depression und unter Umständen eine Hyperinflation könnten die Folgen sein. Die politischen und sozialen Kosten sind allerdings quantitativ nicht zu ermitteln. Juristisch ist ein freiwilliger Austritt eines Landes aus der Eurozone nur möglich, wenn gleichzeitig die Europäische Union verlassen wird. Ein „Rausschmiss” eines Landes ist nicht möglich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersicht über die aktuelle Lage
- Die Staatsschuldenkrise in Europa
- Die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank
- Lage und Auswirkungen auf Südeuropa
- Lage und Auswirkungen auf Nordeuropa
- Szenarien eines Austritts/einer Aufgabe des Euro
- Ein freiwilliger oder unfreiwilliger Austritt eines Mitglieds der Währungsunion
- Austritt eines schwächeren Mitglieds am Beispiel Griechenlands
- Argumente für einen Austritt
- Argumente für einen Verbleib
- Auswirkungen und Kosten eines Austritts Griechenlands
- Realwirtschaft, Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere
- Inflation, Wechselkurs, öffentliche Finanzen und Staatsanleihen
- Der Finanzsektor, Immobilien- und Aktienmärkte
- Sonstige Kosten
- Gesamtkosten
- Austritt eines starken Mitglieds am Beispiel Deutschlands
- Das TARGET II-System und die versteckte Problematik
- Fahrplan eines Austritts Deutschlands aus der EWU
- Kostenvergleich zwischen einem Austritt und einem Verbleib
- Bewertung des Kostenvergleichs
- Gesamtkosten
- Zusammenbruch der gesamten Währungsunion
- Der Domino-Effekt
- Zerfall historischer Währungsunionen und Argentinienkrise nicht übertragbar
- Kosten der Euroländer bei einem Zerfall der EWU
- Realwirtschaft, Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere
- Inflation, Wechselkurs, öffentliche Finanzen und Staatsanleihen
- Der Finanzsektor, Immobilien- und Aktienmärkte
- Ökonomische Kosten für Nichtmitglieder der Eurozone
- Sonstige Kosten
- Gesamtkosten
- Große Depression und Hyperinflation
- Beurteilung der Rechtslage
- Austrittsmöglichkeit nach den europäischen Verträgen
- Rechtliche Probleme bei einem Austritt aus dem Euro für die Wirtschaft
- Handlungsspielraum der EZB und Eurobonds
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der ökonomischen Bewertung eines Austritts oder einer Aufgabe des Euros im Kontext der Eurokrise. Der Fokus liegt auf der Analyse der Kosten, die ein Austritt für die einzelnen Mitgliedstaaten und für die gesamte Währungsunion hätte. Es werden verschiedene Szenarien betrachtet, darunter ein Austritt eines schwachen Mitglieds (Griechenland), eines starken Mitglieds (Deutschland) und ein vollständiger Zusammenbruch der Währungsunion.
- Ökonomische Kosten eines Austritts aus der Eurozone
- Analyse verschiedener Austrittsszenarien
- Bewertung der Folgen für die Realwirtschaft, den Finanzsektor und die öffentliche Hand
- Rechtliche Aspekte eines Austritts
- Die Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Bedeutung von Eurobonds
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas im Kontext der Eurokrise hervorhebt. Anschließend erfolgt eine umfassende Darstellung der aktuellen Situation, die die Staatsschuldenkrise in Europa, die Maßnahmen der EZB und die Auswirkungen auf Südeuropa und Nordeuropa beleuchtet. Die folgenden Kapitel untersuchen verschiedene Szenarien eines Austritts oder einer Aufgabe des Euro. Es werden sowohl die Kosten eines Austritts eines einzelnen Mitgliedslandes, sowohl für ein schwaches (Griechenland) als auch für ein starkes Land (Deutschland), als auch die Kosten eines Zusammenbruchs der gesamten Währungsunion analysiert.
Kapitel 3.2.3 widmet sich den Auswirkungen und Kosten eines Austritts Griechenlands, wobei verschiedene Bereiche wie die Realwirtschaft, der Finanzsektor und die Staatsfinanzen betrachtet werden. Die Kapitel 3.3.1 bis 3.3.5 konzentrieren sich auf die Folgen eines Austritts Deutschlands aus der Eurozone, wobei das TARGET II-System und die rechtlichen Aspekte beleuchtet werden. Kapitel 3.4.1 bis 3.4.4 analysieren den Zusammenbruch der Währungsunion, die Kosten für die einzelnen Euroländer und die potenziellen Folgen wie eine große Depression oder Hyperinflation.
Kapitel 4 behandelt die rechtliche Situation und die Austrittsmöglichkeit aus der Eurozone, wobei die rechtlichen Implikationen für die Wirtschaft beleuchtet werden. Schließlich wird in Kapitel 5 das Ergebnis der Analyse zusammengefasst und die Bedeutung der Ergebnisse für die aktuelle Debatte um die Eurozone herausgestellt.
Schlüsselwörter
Eurokrise, Währungsunion, Austritt, Kostenanalyse, Staatsschuldenkrise, Realwirtschaft, Finanzsektor, Inflation, Wechselkurs, EZB, Eurobonds, rechtliche Aspekte, TARGET II-System, Große Depression, Hyperinflation, EU-Verträge, Wirtschaftspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Folgen hätte ein Austritt eines Landes aus der Eurozone?
Die Arbeit zeigt, dass ein Austritt – egal welches Landes – wahrscheinlich zum Zusammenbruch der Währungsunion und der Europäischen Union führen würde.
Warum wäre ein Austritt Deutschlands besonders problematisch?
Ein Austritt Deutschlands würde unter anderem das TARGET II-System vor enorme Herausforderungen stellen und hohe ökonomische Kosten verursachen.
Ist ein „Rausschmiss“ eines Mitgliedslandes rechtlich möglich?
Nein, nach den europäischen Verträgen ist ein unfreiwilliger Ausschluss eines Landes aus der Eurozone nicht vorgesehen.
Welche ökonomischen Gefahren drohen bei einer Auflösung des Euro?
Es könnte zu einer neuen Großen Depression, Hyperinflation und massiven Verwerfungen im Finanzsektor sowie in der Realwirtschaft kommen.
Wie ist die Rechtslage für einen freiwilligen Austritt?
Ein freiwilliger Austritt aus der Eurozone ist juristisch nur möglich, wenn das Land gleichzeitig die gesamte Europäische Union verlässt.
- Citar trabajo
- Thorsten Foltz (Autor), 2013, Austreten aus der Währungsunion? Bewertung der ökonomischen Kosten einer Aufgabe des Euros, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263887