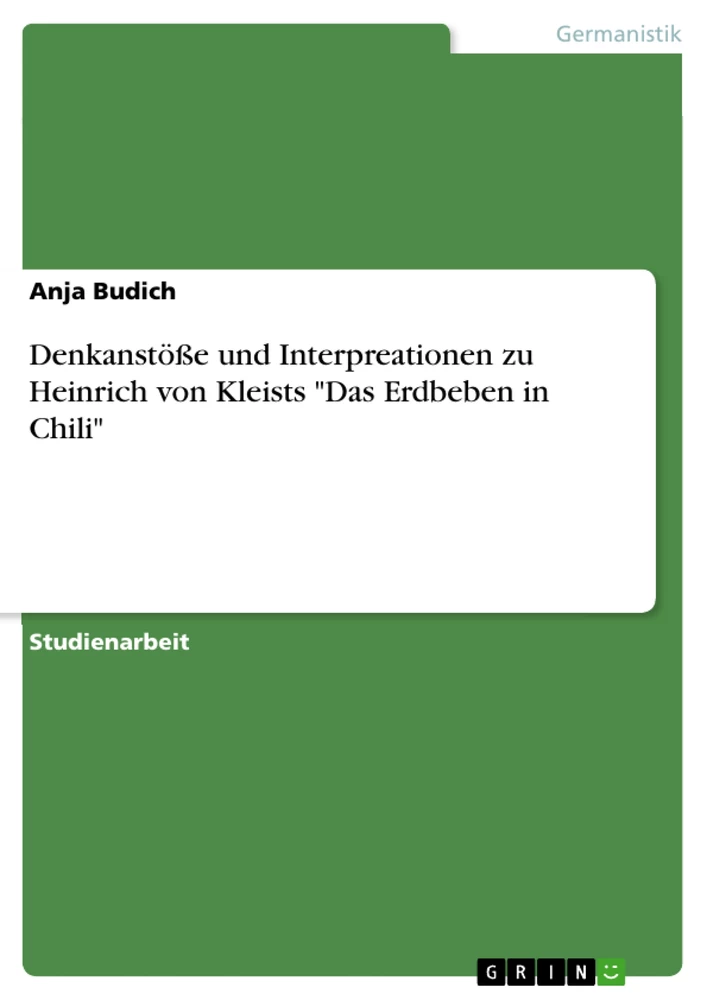Kleists Erzählungen wurden, verglichen mit seinen Dramen, von der positivistischen Quellenforschung des 19. Jahrhunderts nur sehr spärlich behandelt. Der ästhetische Wert dieser Prosa wird auch im 20. Jahrhundert nur zögernd begriffen, noch lange wirkt das Stereotyp von der angeblichen ästhetischen Höherwertigkeit und Höherstellung der Dramen nach.
Dies ist auch der Grund dafür, dass zu den meisten Erzählungen von Kleist, besonders zum Erdbeben in Chili, noch keine definitiven Quellen ausfindig gemacht wurden. Es ist jedoch offensichtlich, dass Kleist den historisch-gesellschaftlichen Hintergrund seiner Zeit als Anlass zum Verfassen dieser Novelle genommen hat.
Heute jedoch wird in der Kleistforschung die besondere Struktur seiner Novellen erkannt:
„Wenn Goethe Gesetz und Muster der Novelle zu geben suchte, so gab Kleist ihr die entscheidende Gestalt.“
Heinrich von Kleist zählt zu den großen deutschen Dichtern, seine Dramen und Erzählungen haben weltliterarischen Rang erreicht. Erst ab dem 20. Jahrhundert wurde Kleist der Rang eines Klassikers zuerkannt, wohl auch deshalb, da bis heute wichtige Abschnitte seines Lebens im Dunklen liegen. Auch ist es sehr bedauerlich, dass seine schriftstellerische Tätigkeit auf nur 10 Jahre begrenzt war.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Informationen zum Autor; Entstehungsgeschichte
3 Kleist als Novellist
4 Denkanstöße
4.1 Das Erdbeben in Chile 1647
4.2 Das Erdbeben in Lissabon 1755
4.3 Die zeitgenössische philosophische Diskussion
5 Inhaltsangabe
6 Interpretation
7 Formalitäten
7.1 Das Zeitgerüst
7.2 Zeitangaben
7.3 Haltung des Erzählers
7.4 Erzähltechnik
7.5 Novellistischer Höhepunkt / Wendepunkt
8 Leitmotive
8.1 Granatapfelmotiv
8.2 Glocken
8.3 Pfeiler
8.4 Zufall
9. Formales
9.1 Nähe zum Drama
9.2 Prosa
10. Novellenbegriff
11 Schlussgedanke
Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Anja Budich (Autor:in), 2010, Denkanstöße und Interpreationen zu Heinrich von Kleists "Das Erdbeben in Chili", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264008