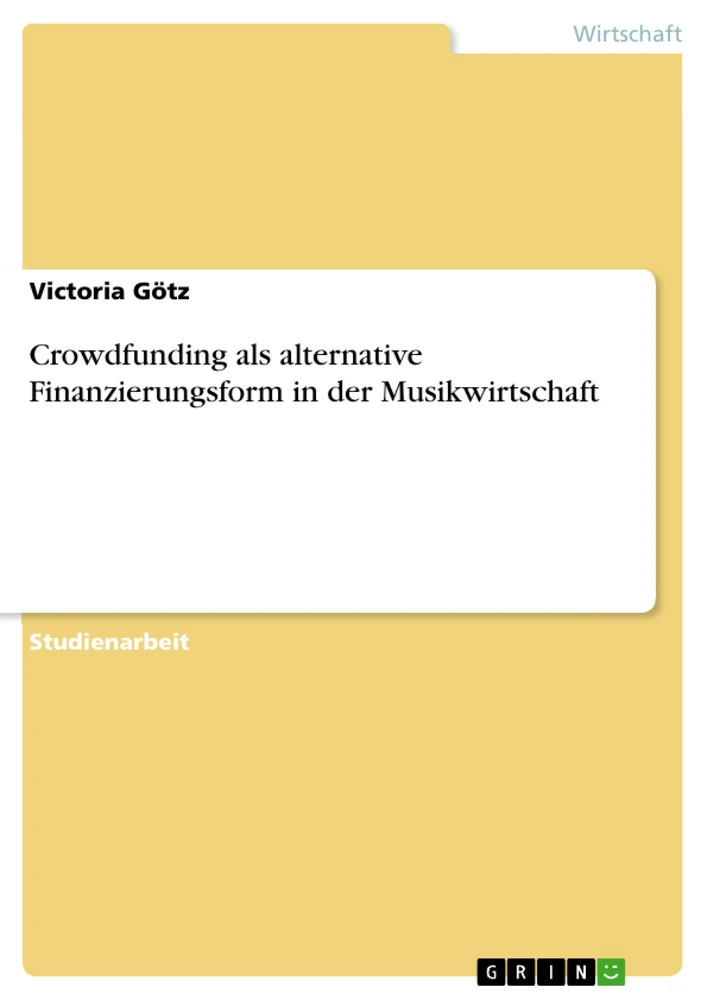In den vergangenen Jahrzehnten sorgte das Internet ständig für neue Entwicklungen in beinahe allen Wirtschaftsbereichen. Durch neue Anwendungen wie Web 2.0 und Social Media veränderte sich die Nutzung des Mediums grundlegend. So ist es nun auch dem gewöhnlichen User möglich eigenen Content zu erstellen und sich mit einer breiten Masse anderer User aus der ganzen Welt zu vernetzen und Daten auszutauschen. Vor allem in der Musikwirtschaft veränderten sich hierdurch die Machtverhältnisse zu Gunsten der Konsumenten und Künstler. Diese nutzten in den vergangenen Jahren vermehrt Plattformen und Netzwerke im Internet ,wie bspw. YouTube oder Facebook, um ihre Musik weiterzuverbreiten. Trotz neuer günstigerer digitaler Produktionstechnik fehlen zu professionellen Produktionen jedoch oft die nötigen Mittel und so können die meisten von einem eigenen Album bisher nur träumen.
Diesem Dilemma könnte eine mehr oder weniger neue Erscheinung Abhilfe schaffen. Das Phänomen Crowdfunding (CF), bezeichnet die Kapitalbeschaffung durch viele Unterstützer mit kleinen Beträgen. Diese neue Erscheinungsform bietet sich insbesondere für Projekte aus kreativen und innovativen Bereichen an, da es sich beim anfallenden Kapitalbedarf meist nur um wenige Tausend Euro handelt. Zum anderen besteht in diesen Bereichen allgemein hohes Interesse seitens der Unterstützer.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau und Zielsetzung der Arbeit
- Begriffliche Klärungen
- Crowdsourcing und Crowdfunding
- Mikrofinanzierung
- Web 2.0
- Social Media
- Musikindustrie/Musikwirtschaft
- Beschreibung des Phänomens Crowdfunding
- Entstehung, Entwicklung und Historie
- Anwendungsgebiete und Formen der Gegenleistung
- Hauptakteure im Crowdfunding-Prozess
- Ablauf eines Crowdfunding-Prozesses
- Crowdfunding in der Musikwirtschaft
- Marktstrukturen der Musikwirtschaft
- Wertschöpfungsprozesse
- Bisherige Finanzierungsmethoden
- Projekt-Formen
- Nicht-plattform-basierte Crowdfunding-Projekte
- Deutschsprachige Crowdfunding-Plattformen
- Crowdfundind-Plattformen mit dem Schwerpunkt Musik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Möglichkeiten von Crowdfunding (CF) als alternative Finanzierungsmethode in der Musikwirtschaft. Sie beleuchtet die Integration von CF in die bestehende Ökonomie der Musikindustrie und analysiert, welche Akteure am meisten von dieser Entwicklung profitieren. Die Arbeit definiert wichtige Begriffe wie Crowdsourcing, Mikrofinanzierung, Web 2.0, Social Media und Musikindustrie, um eine klare Grundlage für die Analyse zu schaffen.
- Bedeutung von Crowdfunding als Finanzierungsform
- Integration von Crowdfunding in die Musikindustrie
- Analyse der Vorteile und Herausforderungen von Crowdfunding in der Musikwirtschaft
- Identifizierung der Akteure, die vom Crowdfunding profitieren
- Bedeutung von Web 2.0 und Social Media im Kontext von Crowdfunding
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Crowdfunding (CF) als alternative Finanzierungsmethode in der Musikwirtschaft ein und stellt die Relevanz von Web 2.0 und Social Media in diesem Kontext dar. Der zweite Abschnitt definiert die Zielsetzung der Arbeit und strukturiert die folgenden Kapitel. Im dritten Kapitel werden wichtige Begriffe wie Crowdsourcing, Mikrofinanzierung, Web 2.0, Social Media und Musikindustrie geklärt. Der vierte Abschnitt beschäftigt sich mit der Entstehung, Entwicklung und Geschichte von CF, seinen Anwendungsgebieten, den Hauptbeteiligten im Prozess sowie dem Ablauf von CF-Projekten. Kapitel 5 analysiert die Marktstrukturen, Wertschöpfungsprozesse und bisherigen Finanzierungsmethoden in der Musikwirtschaft, bevor es verschiedene Projektformen im Bereich des Crowdfundings in der Musikwirtschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Crowdfunding, Musikwirtschaft, Finanzierungsmodelle, Web 2.0, Social Media, Crowdsourcing, Mikrofinanzierung, Marktstrukturen, Wertschöpfungsprozesse, Projekt-Formen, Plattformen, Künstler, Konsumenten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Crowdfunding im Kontext der Musikwirtschaft?
Crowdfunding bezeichnet die Kapitalbeschaffung für Musikprojekte durch viele Unterstützer, die meist kleine Beträge beisteuern.
Warum ist Crowdfunding für Musiker heute so relevant?
Es bietet eine Alternative zu klassischen Plattenverträgen und ermöglicht es Künstlern, Produktionen (wie Alben) unabhängig zu finanzieren.
Welche Rolle spielen Social Media und Web 2.0?
Diese Plattformen ermöglichen es Künstlern, sich direkt mit Fans zu vernetzen, ihre Musik zu verbreiten und Unterstützer für ihre Kampagnen zu finden.
Was ist der Unterschied zwischen Crowdsourcing und Crowdfunding?
Die Arbeit klärt diese Begriffe terminologisch ab, wobei Crowdsourcing eher das Auslagern von Aufgaben und Crowdfunding die Finanzierung betrifft.
Welche Arten von Crowdfunding-Plattformen werden untersucht?
Es werden sowohl allgemeine deutschsprachige Plattformen als auch solche mit speziellem Fokus auf Musik analysiert.
- Quote paper
- Victoria Götz (Author), 2012, Crowdfunding als alternative Finanzierungsform in der Musikwirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264041