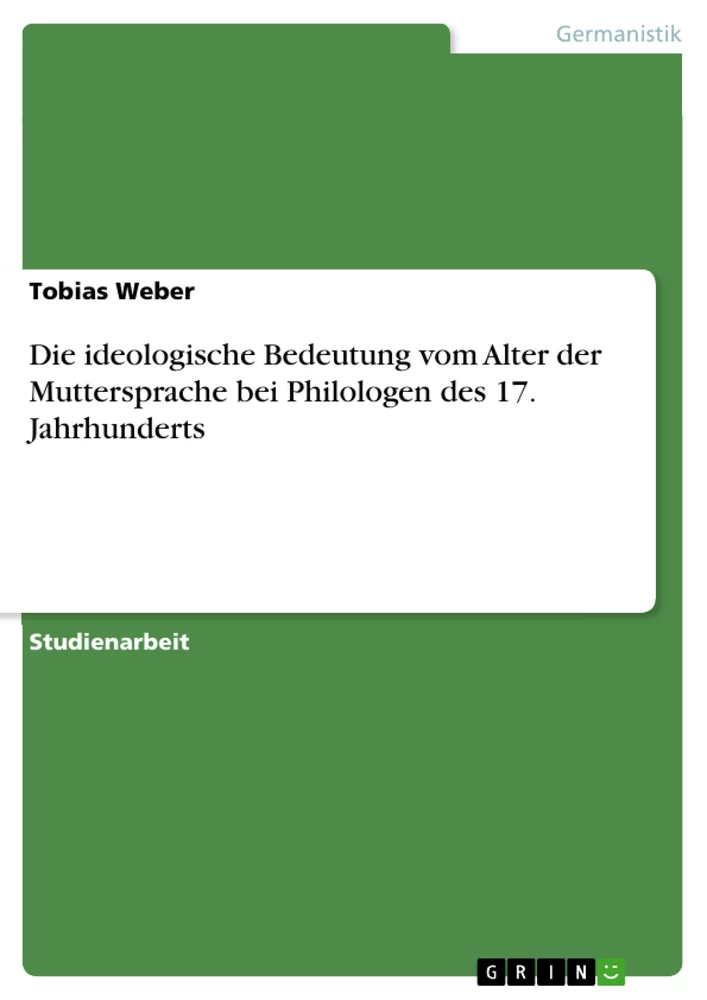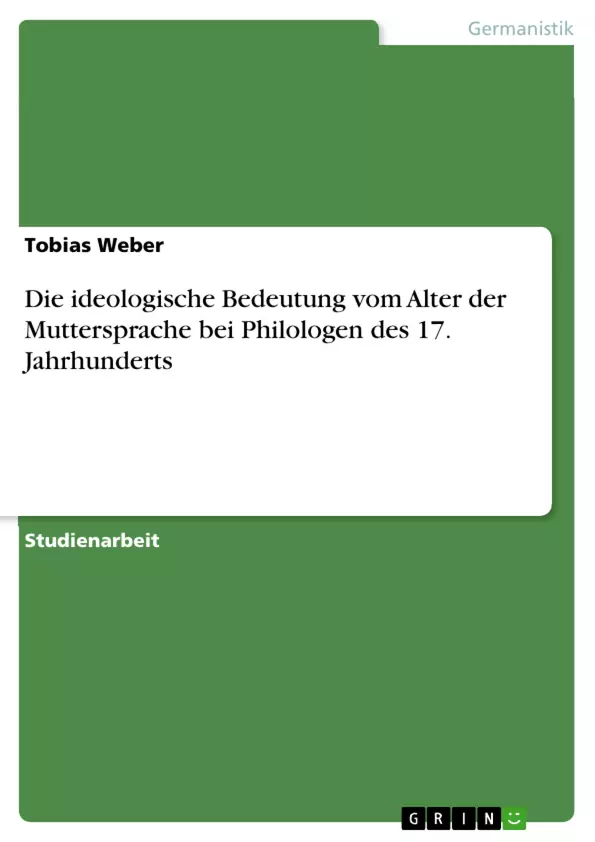In der vorliegenden Arbeit soll die ideologische Bedeutung des Sprachalters für die Argumentation der Sprachpfleger des 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum erörtert werden. Dazu wird zunächst auf die kulturpatriotische Strömung der damaligen Zeit eingegangen, um die Grundlagen für eine tiefer gehende Analyse zu schaffen. Wir betrachten also im Folgenden die Entstehung, Verbreitung und Etablierung des Sprach- oder Kulturpatriotismus in Europa, später im deutschsprachigen Raum, sowie deren bedeutendste Vertreter und ihre Ideen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird das zeitgenössische Sprachgeschichtskonzept des 17. Jahrhunderts dargelegt. Dazu wird insbesondere Schottelius' Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache diskutiert, welche "die umfassendste und fundierteste Einbeziehung sprachhistorischer Fragestellungen in ein grammatikographisches Werk vor Adelung bietet" (Rössing-Hager 1985, S. 1566). Dabei wird der Fokus der Betrachtung auf der Betonung und Begründung des hohen Alters der deutschen Sprache liegen. Abschließend werden die weiteren sprachphilosophischen und -wissenschaftlichen Auswirkungen der Sprachpfleger des 17. Jahrhunderts betrachtet. Die ideologisch belastete Grundhaltung der noch nicht wissenschaftlichen Arbeits- und Denkweise der frühen Philologen wird allseits deutlich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 die Wurzeln des Sprach- oder Kulturpatriotismus
- 1.2 nationale Sprachpflege
- 1.3 Sprachpflege im 17. Jahrhundert
- 2. Sprachgeschichtsschreibung im 17. Jahrhundert
- 2.1 das zeitgenössische Sprachgeschichtskonzept
- 2.2 Alter, Verwandtschaft und Bedeutung der einzelnen Sprachen
- 2.3 die Besonderheit des Alters der Teutschen HaubtSprache
- 2.4 Sprachwandel
- 3. Ausblick
- 3.1 Kritik
- 3.2 weiterführende Sprachgeschichtsschreibung
- 3.3 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ideologische Bedeutung des Alters der deutschen Sprache für Sprachpfleger des 17. Jahrhunderts. Sie analysiert den kulturpatriotischen Kontext dieser Zeit und beleuchtet das zeitgenössische Sprachgeschichtskonzept, insbesondere anhand von Schottelius' Werk. Der Fokus liegt auf der Argumentation für das hohe Alter der deutschen Sprache und deren Auswirkungen auf die sprachwissenschaftliche Entwicklung.
- Kulturpatriotismus im 17. Jahrhundert
- Sprachgeschichtskonzept des 17. Jahrhunderts
- Das Alter der deutschen Sprache als ideologisches Argument
- Einfluss von Sprachideologien auf die Sprachpflege
- Auswirkungen auf die sprachwissenschaftliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel legt die Grundlage für die gesamte Arbeit. Es beschreibt die Zielsetzung, die sich auf die Erörterung der ideologischen Bedeutung des Sprachalters für Sprachpfleger des 17. Jahrhunderts konzentriert. Es führt in den kulturpatriotischen Kontext ein und skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit, der die Entstehung und Verbreitung des Sprachpatriotismus, das zeitgenössische Sprachgeschichtskonzept und die Auswirkungen der Sprachpflege des 17. Jahrhunderts umfasst. Besondere Beachtung findet dabei Schottelius' Werk als umfassende Quelle für sprachhistorische Fragestellungen.
2. Sprachgeschichtsschreibung im 17. Jahrhundert: Dieses Kapitel präsentiert das Verständnis von Sprachgeschichte im 17. Jahrhundert. Es analysiert das zeitgenössische Konzept, untersucht die Betrachtung von Alter, Verwandtschaft und Bedeutung verschiedener Sprachen, und konzentriert sich insbesondere auf die Hervorhebung des hohen Alters der deutschen Sprache als zentrales Argument. Der Sprachwandel wird ebenfalls thematisiert, um das Verständnis der damaligen Sprachwissenschaftler für die Entwicklung der Sprache zu beleuchten. Die Analyse stützt sich maßgeblich auf Schottelius’ Werk, welches als ein bedeutendes Beispiel für die Integration sprachhistorischer Aspekte in grammatikographische Werke gilt.
Schlüsselwörter
Sprachpflege, Kulturpatriotismus, Sprachgeschichte, 17. Jahrhundert, Deutsche Sprache, Sprachideologie, Schottelius, Sprachwandel, Sprachgeschichtskonzept.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachgeschichtsschreibung und Kulturpatriotismus im 17. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die ideologische Bedeutung des Alters der deutschen Sprache für Sprachpfleger im 17. Jahrhundert. Sie analysiert den kulturpatriotischen Kontext dieser Zeit und beleuchtet das damalige Sprachgeschichtskonzept, insbesondere anhand des Werkes von Schottelius. Der Fokus liegt auf der Argumentation für das hohe Alter der deutschen Sprache und deren Auswirkungen auf die sprachwissenschaftliche Entwicklung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Kulturpatriotismus im 17. Jahrhundert, das Sprachgeschichtskonzept des 17. Jahrhunderts, das Alter der deutschen Sprache als ideologisches Argument, den Einfluss von Sprachideologien auf die Sprachpflege und die Auswirkungen auf die sprachwissenschaftliche Entwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, die die Zielsetzung und den Kontext erläutert; ein Hauptteil, der die Sprachgeschichtsschreibung des 17. Jahrhunderts, insbesondere das Verständnis von Alter, Verwandtschaft und Bedeutung verschiedener Sprachen und den Sprachwandel, analysiert; und einen Ausblick, der kritische Anmerkungen und weiterführende Forschungsfragen beinhaltet.
Welche Rolle spielt Schottelius in dieser Arbeit?
Schottelius' Werk dient als zentrale Quelle für die Analyse des zeitgenössischen Sprachgeschichtskonzepts und der Argumentation für das hohe Alter der deutschen Sprache. Seine Arbeit wird als bedeutendes Beispiel für die Integration sprachhistorischer Aspekte in grammatikographische Werke betrachtet.
Wie wird das Alter der deutschen Sprache dargestellt?
Das hohe Alter der deutschen Sprache wird als zentrales ideologisches Argument der Sprachpfleger des 17. Jahrhunderts dargestellt. Die Arbeit untersucht, wie dieses Argument im Kontext des Kulturpatriotismus verwendet wurde und welche Auswirkungen dies auf die sprachwissenschaftliche Entwicklung hatte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachpflege, Kulturpatriotismus, Sprachgeschichte, 17. Jahrhundert, Deutsche Sprache, Sprachideologie, Schottelius, Sprachwandel, Sprachgeschichtskonzept.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Arbeit liefert eine detaillierte Analyse der Sprachgeschichtsschreibung und der damit verbundenen Sprachideologien des 17. Jahrhunderts, wobei der Fokus auf der ideologischen Bedeutung des Alters der deutschen Sprache liegt. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Kulturpatriotismus und sprachwissenschaftlicher Entwicklung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studierende der Germanistik, Linguistik, Sprachgeschichte und Kulturgeschichte, die sich mit dem 17. Jahrhundert, Sprachideologien und dem Zusammenhang von Sprache und Nationalität auseinandersetzen.
- Citation du texte
- M.Ed. Tobias Weber (Auteur), 2013, Die ideologische Bedeutung vom Alter der Muttersprache bei Philologen des 17. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264096