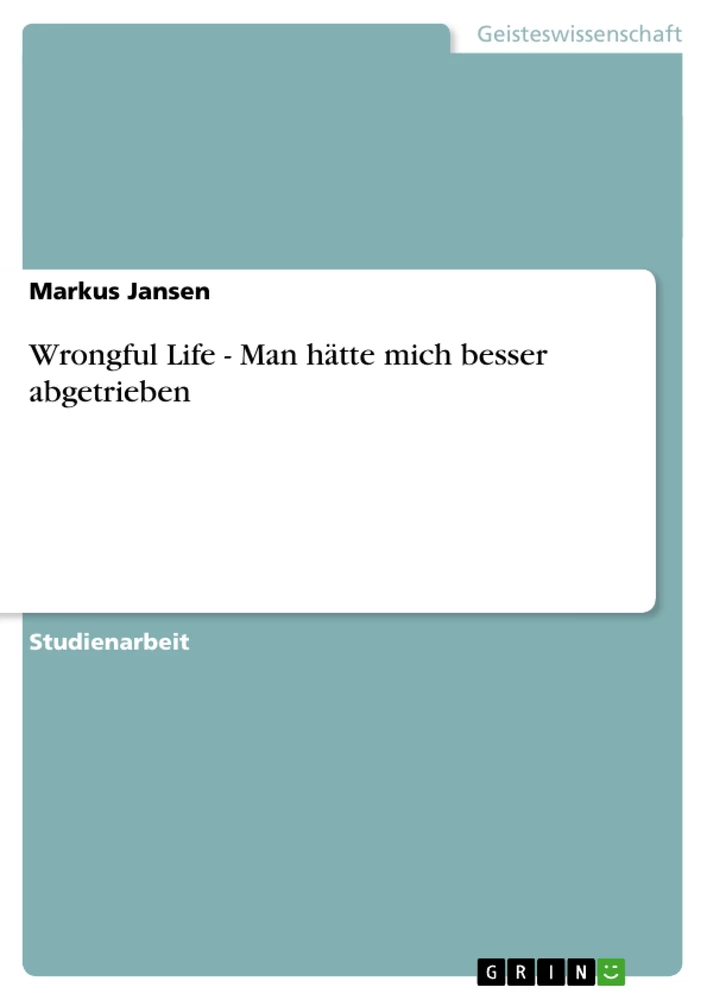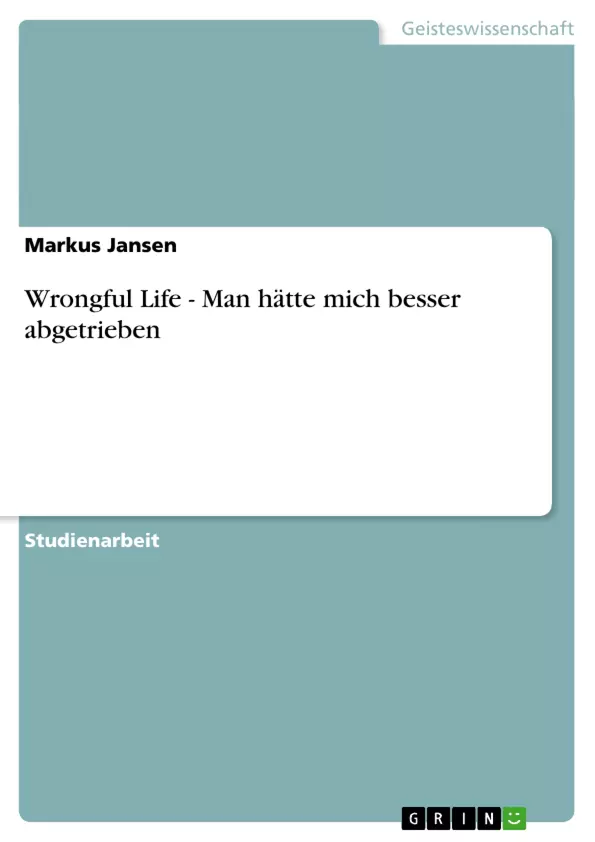Was in Deutschland kaum möglich ist, ist in Israel Alltag. Potentiell behinderte Kinder werden abgetrieben, ohne rechtliche und moralische Bedenken: "Mein Kind wäre vielleicht behindert auf die Welt gekommen, also habe ich es lieber abgetrieben". Sollte doch ein behindertes Kind geboren werden, so kann es den Arzt verklagen, der es zur Welt gebracht hat. Der Grund für die Klage: ich muss leben, weil man mich nicht abgetrieben hat.
Inhaltsverzeichnis
1 Rechtliche Grundlagen
1.1 Schwangerschaftsabbruch in Deutschland
1.2 „Wrongful Birth“ und „Wrongful Life“
2 Fallstudie Yanir Schlussel
3 Literaturverzeichnis
1 Rechtliche Grundlagen
Der Begriff „Wrongful Life“1 entstammt dem juristischen Sprachgebrauch; er bezeichnet die Klage von Eltern behinderter Kinder bzw. der behinderten Kinder selbst gegen den behandelnden Arzt sowie das zugehörige Krankenhaus, dass die Behinderung des Fötus’ während der Schwangerschaft nicht erkannt und in Folge dessen nicht abgetrieben worden ist. Gegenstand der Klage ist somit das Leben eines behinderten Menschen, der bei korrekt durchgeführten medizinischen Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft nicht hätte leben sollen. Die rechtliche Grundlage für solche Klagen ist in jedem Land unterschiedlich, daher soll zunächst die Rechtslage in Deutschland erläutert werden. Im Anschluss wird eine Fallstudie eines „Wrongful Life“-Prozesses aus Israel vorgestellt.
1.1 Schwangerschaftsabbruch in Deutschland
Die rechtlichen Grundlagen für eine Abtreibung sind in §218-219 StGB des Strafgesetzbuchesaufgeführt. Ein Schwangerschaftsabbruch ist grundsätzlich rechtswidrig. Wer einen Schwangerschaftsabbruch durchführt oder den Versuch unternimmt einen Schwangerschaftsabbruchdurchzuführen, verstößt in jedem Fall gegen das Gesetz und kann mit einer Freiheitsstrafe biszu 3 Jahren bestraft werden.2 Die umgangssprachliche Aussage, eine Abtreibung bis zum dritten Monat verstoße nicht gegen das Gesetz, ist demnach falsch. Die Regelgung für einen straffreien, allerdings nach wie vor rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch, ist in §218a StGBfestgelegt. Der Tatbestand des §218 StGB ist somit nicht verwirklicht, wenn seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wochen vergangen sind, der Schwangerschaftsabbruch von einem Arztvorgenommen wird und die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch ausdrücklich verlangtsowie eine entsprechende Bescheinigung nach §219 Abs. 2 Satz 2 vorlegen kann. Sind dieseAnforderungen erfüllt, so kann der Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden, ohne dassdieser strafrechtlich verfolgt wird.3 Unter bestimmten Umständen kann sogar bis 22 Wochennach Empfängnis und entsprechender Beratung nach §218a Abs. 4 ein Schwangerschaftsabbruch straffrei durchgeführt werden, wenn sich die Schwangere in einer Notlage befindet. Was genau als Notlage zu werten ist, wird jedoch nicht genauer definiert.4 Allerdings gibt es nochweitere Ausnahmefälle, in denen ein Schwangerschaftsabbruch straffrei erfolgen kann; diesesind ebenfalls in §218a StGB aufgeführt. Neben der Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch bei kriminologischer Indikation nach §218a Abs. 3 StGB straffrei bis 12 Wochen nachEmpfängnis (ohne vorherige Beratung) durchzuführen, ist vor allem die Ausnahmeregelungin §218a Abs. 2 StGB aus ethischer Sicht sowie für die Problematik des „Wrongful Life“besonders relevant.5
Nach §218a Abs. 2 StGB ist bei Gefahr für Gesundheit oder Leben der Schwangeren einSchwangerschaftsabbruch nicht strafbar. Dies ist auch der einzige in §218a StGB aufgeführteAusnahmefall, der aus ethischer und theologischer Sicht vollständig zu unterstützen ist. DasLeben der Schwangeren und das Leben des noch ungeborenen Kindes sind gleichwertig undin gleichem Maße schützenswert. Wenn das Leben einer Frau durch eine Schwangerschaftbedroht ist, ist es also aus ethischer Perspektive durchaus legitim, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Allerdings ist die weitere Formulierung dieser Ausnahmeregelung ausethischer Perspektive höchst bedenklich. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nach §218a Abs. 2StGB auch dann straffrei, wenn die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes bestehen.6 Was als schwerwiegende Beeinträchtigung gilt, liegt dabei allein im Ermessensspielraum des Arztes, eine genaue Definitionexistiert nicht. Ein Schwangerschaftsabbruch ist im Falle von §218a Abs. 2 StGB ohne zeitliche Begrenzung straffrei möglich, das Einsetzen der Wehen ist aus medizinischen Gründendie einzige zeitliche Begrenzung.7 Allgemein wird aber empfohlen, den Schwangerschaftsabbruch bis 22 Wochen nach Empfängnis vorzunehmen. Bei späteren Schwangerschaftsabbrüchen könnte der Fetus nach der „Frühgeburt“ leben, der Arzt wäre in diesem Fall dazuverpflichtet das Leben zu erhalten.8 Auf die daraus entstehenden ethischen Fragestellungensoll hier aber nicht weiter eingegangen werden.
Da keine genaue Eingrenzung für die potentiellen körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen der Schwangeren existieren, wäre aus juristischer Sicht die Abtreibung eines Fötus biszum Einsetzen der Wehen möglich, wenn dieser vermutlich eine Behinderung haben könnteund die Mutter sich körperlich oder seelisch nicht in der Lage sieht, mit dieser potentiellenBehinderung umgehen zu können. Ob das Kind wirklich diese Behinderung haben und wie stark diese ausgeprägt sein wird ist dabei genauso zu vernachlässigen, wie die Frage nach derBeeinträchtigung der körperlichen bzw. seelischen Gesundheit der Schwangeren. Lediglichein Arzt muss davon überzeugt sein, dass der Schwangerschaftsabbruch aus medizinischenGründen nach §218a Abs. 2 StGB nötig ist. Diese sehr drastische Auslegung des Paragraphenist in Deutschland bisher kaum umzusetzen, (willkürliche) Schwangerschaftsabbrüche basierend auf Vermutungen und fehleranfälligen Testergebnissen sind ethisch nicht vertretbar. Diejuristischen Grundlagen für solche Schwangerschaftsabbrüche sind aber durchaus gegeben, inanderen Ländern wie z.B. Israel sind solche Schwangerschaftsabbrüche auch schon gängigePraxis.
1.2 „Wrongful Birth“ und „Wrongful Life“
Die Begriffe des „Wrongful Birth“ und „Wrongful Life“ stehen in Verbindung mit zwei verschiedene Arten von Klagen. Bei einem „Wrongful Birth“- Prozess verklagen die Eltern eines behinderten Kindes den zuständigen Gynäkologen, der die Behinderung bei einer Vorsorgeuntersuchung nicht erkannt hat. Mit dem Wissen um die Behinderung hätten die Elternsonst einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung gezogen. Gegenstand solcher Klagen sindBehandlungs- und Unterhaltskosten.9 Bei einem „Wrongful Life“-Prozess verklagt das Kindselber den behandelnen Gynäkologen. Das Kind bzw. das Leben des Kindes ist Gegenstandsolcher Klagen, eine Entschädigung für die Konsequenzen der eigenen Geburt wird eingefordert, da das Kind „leben muss“ und nicht abgetrieben worden ist.10 „Wrongful Birth“-Prozessesind in Deutschland grundsätzlich möglich und wurden auch schon geführt, allerdings nur insehr engen, verfassungsrechtlichen Grenzen.11 Ein „Wrongful Life“-Prozess ist hingegen inDeutschland nicht möglich, Art. 1 GG verbietet es, das Kind selber als Schadensposten einzuordnen, ein „Wrongful Life“-Prozess würde also über unwürdiges bzw. würdiges Lebenentscheiden müssen. In Übereinstimmung mit dem deutschen Bundesgerichtshof sind auch inÖsterreich lediglich „Wrongful Birth“-Klagen möglich. In einigen anderen Ländern sind aberauch „Wrongful Life“-Klagen zumindest nicht verboten, in den USA sowie in Frankreichwurden bereits mehrere „Wrongful Life“-Prozesse verhandelt, in Spanien, Südkorea und Südafrika ist es möglich, eine solche Klage vorzubringen; bisher wurden diese aber abgelehnt.12
[...]
1 In der deutschen Sprache gibt es keinen entsprechenden Begriff für diesen Ausdruck. Mögliche Übersetzungen wären etwa „mit einem Fehler behaftetes Leben“ oder drastischer ausgedrückt „unerwünschtes Leben“,wobei hauptsächlich die Lebensqualität des behinderten Menschen unerwünscht ist.2 Vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__218.html.
3 Vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__218a.html.
4 Vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__218a.html.
5 Vgl. ebd..
6 Vgl. ebd..
7 Vgl. Haag/Hanhart/Müller 2011, S. 125.8 Vgl. ebd..
9 Vgl. Wolbring 2001, S. 90.
10 Vgl. ebd., S. 89.
11 Vgl. ebd., S. 90.
12 Vgl. ebd., S. 89-91.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeuten die Begriffe "Wrongful Birth" und "Wrongful Life"?
"Wrongful Birth" ist eine Klage der Eltern wegen unterlassener Aufklärung über eine Behinderung. "Wrongful Life" ist die Klage des Kindes selbst, das Schadensersatz für sein eigenes Leben fordert.
Sind "Wrongful Life"-Klagen in Deutschland möglich?
Nein, in Deutschland sind sie aufgrund von Art. 1 GG unzulässig, da ein menschliches Leben rechtlich nicht als Schaden gewertet werden darf.
Welche Rolle spielt § 218a StGB bei dieser Thematik?
Er regelt die Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen. Besonders die medizinische Indikation (§ 218a Abs. 2) ist relevant, wenn eine Behinderung des Kindes die Gesundheit der Mutter gefährdet.
Wie unterscheidet sich die Rechtslage in Israel?
In Israel sind "Wrongful Life"-Klagen Alltag. Behinderte Kinder können Ärzte verklagen, weil sie nicht abgetrieben wurden, was in der Arbeit am Fall Yanir Schlussel gezeigt wird.
Gibt es zeitliche Grenzen für einen Abbruch bei medizinischer Indikation?
Juristisch ist ein Abbruch nach § 218a Abs. 2 StGB bis zum Beginn der Wehen möglich, was ethisch höchst umstritten ist.
- Citation du texte
- Markus Jansen (Auteur), 2013, "Wrongful Life". Juristische Klagen bei der Geburt von Kindern mit Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264122