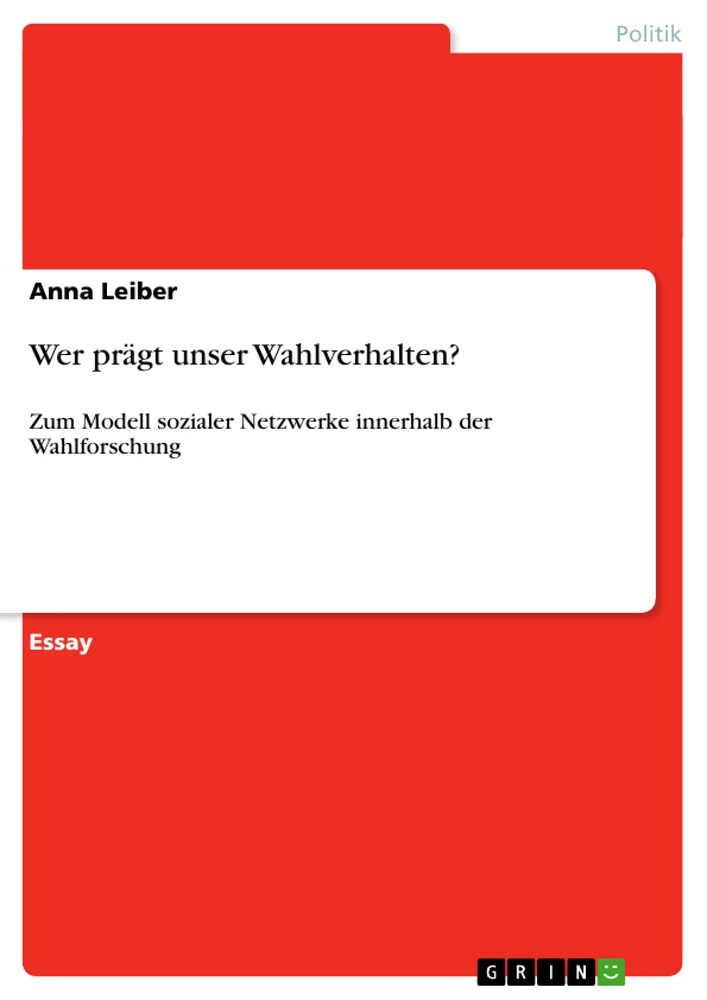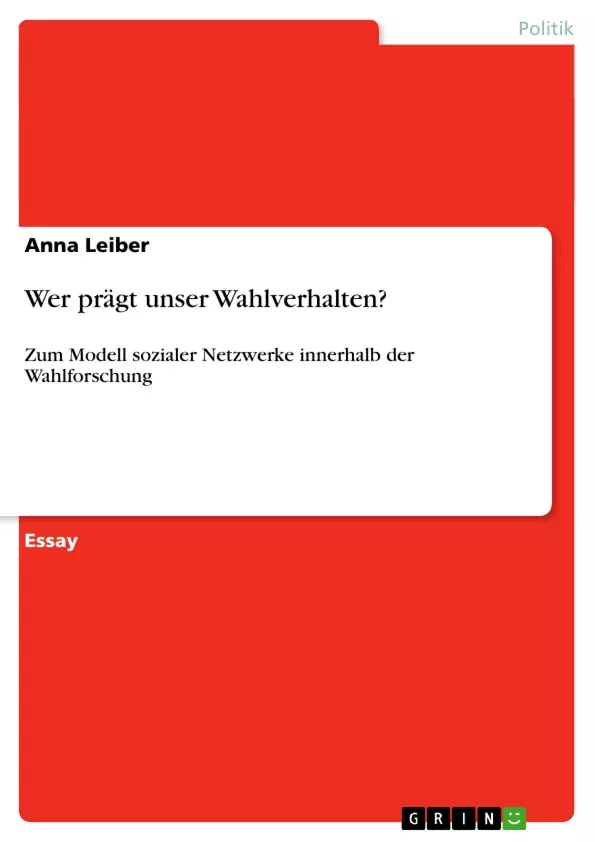Seit den 1950er Jahren hat sich innerhalb der Wahlverhaltensforschung ein Teilbereich entwickelt, der noch heute von großer Bedeutung ist: der mikro-soziologische Untersuchungsansatz. Dabei fokussiert man gezielt die Frage, in welchem Maße öffentliche Kommunikation, gemeinschaftliche Interessenbildung sowie politische Partizipation die individuelle Wahlentscheidung beeinflussen. Um diesen komplexen Themenbereich angemessen analysieren zu können, haben Wissenschaftlerinnen und Wis-senschaftler verschiedene Modelle entwickelt. In meinen folgenden Ausführungen widme ich mich einem dieser Modelle besonders aufmerksam - den sozialen Netzwerken. Dabei möchte ich zunächst kurz auf die theoretischen Hintergründe eingehen, auf die sich dieser Modellansatz stützt. Anschließend stelle ich die wesentlichen Annahmen hinsichtlich sozialer Netzwerke dar. Primär geht es dabei um autoregressive Effekte, ihre Entstehung sowie ihre Auswirkungen auf die einzelnen Netzwerke. Zuletzt möchte ich die Frage beantworten, inwieweit mediale Nachrichten einen Einfluss auf die einzelnen Mitglieder eines sozialen Netzwerkes haben.
„Independent individuals arrive at choices and decisions as interactive participants in a socially imbedded process that depends on networks of communication among and between individuals with particular settings.“ (Zuckerman 2005)
Seit den 1950er Jahren hat sich innerhalb der Wahlverhaltensforschung ein Teilbereich entwickelt, der noch heute von großer Bedeutung ist: der mikro-soziologische Untersuchungsansatz (Huckfeldt 2007: 104). Dabei fokussiert man gezielt die Frage, in welchem Maße öffentliche Kommunikation, gemeinschaftliche Interessenbildung sowie politische Partizipation die individuelle Wahlentscheidung beeinflussen. Um diesen komplexen Themenbereich angemessen analysieren zu können, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedene Modelle entwickelt. In meinen folgenden Ausführungen widme ich mich einem dieser Modelle besonders aufmerksam - den sozialen Netzwerken. Dabei möchte ich zunächst kurz auf die theoretischen Hintergründe eingehen, auf die sich dieser Modellansatz stützt. Anschließend stelle ich die wesentlichen Annahmen hinsichtlich sozialer Netzwerke dar. Primär geht es dabei um autoregressive Effekte, ihre Entstehung sowie ihre Auswirkungen auf die Netzwerke. Zuletzt möchte ich die Frage beantworten, inwieweit mediale Nachrichten einen Einfluss auf die einzelnen Mitglieder eines sozialen Netzwerkes haben.
Das theoretische Fundament sozialer Netzwerksforschung bilden die Wahlanalysen der Columbia School. Die Forscher um Paul Lazarsfeld widmeten sich mit ihren Arbeiten erstmals der Individualdatenebene. Dabei untersuchten sie gezielt den Zusammenhang zwischen sozialen Bindungen einzelner Individuen und ihren persönlichen Wahlentscheidungen (Huckfeldt 2007: 101/102). Als Ergebnis ließen sich schließlich zwei signifikante Beobachtungen festhalten.
Individuen werden bei ihren Entscheidungen stark von ihrem direkten sozialen Umfeld geprägt. So bilden sich innerhalb eines langen sozialen Lernprozesses neben verschiedenen Interessen und Einstellungen auch politische Meinungen heraus (Zuckerman 2007: 634). Diesen Prozess bezeichnet man daher allgemein als „Social logic of politics“ (Partheymüller/Schmitt-Beck 2011: 2).
Des Weiteren stellte Lazarsfeld fest, dass Individuen eng an ihre soziale Gruppe gebunden sind, und dass die gruppen-internen Beziehungen sowie Kommunikationswege das Wahlverhalten beeinflussen (Huckfeldt 2007: 100).
Aus diesen Erkenntnissen hat sich das Modell sozialer Netzwerke entwickelt. Damit ist es möglich, komplexe soziale Strukturen zu analysieren. Außerdem hilft das Modell dabei, „mikro- und makro-soziologische Forschungsansätze zu verbinden“ (Trezzini 1998: 378). Als soziales Netzwerk versteht man allgemein eine begrenzte Anzahl an Individuen und alle Beziehungen, die ausgehend von diesen Individuen festgelegt werden (Wasserman/Faust in Trezzini 1998: 379).
Zwischen den klassischen Gruppen-Vorstellungen der Columbia School und den sozialen Netzwerken lassen sich zwei wesentliche Unterschiede feststellen (Huckfeldt 2007: 101). Lazarsfeld und seine Kollegen gingen innerhalb ihrer Arbeit davon aus, dass es sich bei den sozialen Gruppen stets um homogene Netzwerke handelte (Huckfeldt et. al 2003: 2). Im Gegensatz dazu lassen sich innerhalb sozialer Netzwerke häufig Beziehungen finden,
die durch Asymmetrie und fehlende Wechselhaftigkeit gekennzeichnet sind (Huckfeldt et. al 2003: 3).
Ein weiterer Unterschied liegt in der Annahme über die einzelnen Verbindungen innerhalb einer Gruppe oder eines Netzwerkes. Während die Columbia School darlegte, dass die gruppen-internen Verbindungen immer gleich stark sind, kann diese Stärke innerhalb sozialer Netzwerke deutlich variieren (Huckfeldt et. al 2003: 3). Wenn beispielsweise Person A mit Person B befreundet ist, so muss diese Freundschaft nicht zwangsläufig alle anderen Freundschaften der beiden Personen tangieren. Vielmehr können von jeder Person innerhalb eines sozialen Netzwerkes mehrere Freundeskreise ausgehen, deren Mitglieder wiederum nicht miteinander in Kontakt stehen.
Eine weitere Ansicht bezüglich sozialer Netzwerke, die sich aufgrund der umfassenden technischen, medialen und infrastrukturellen Entwicklungen manifestiert hat, betrifft die räumliche Ausbreitung. Im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten sind soziale Interaktionen heute nicht mehr an geographische Gegebenheiten gebunden, Netzwerke können sich über die direkte Nachbarschaft hinweg ausdehnen (Huckfeldt et. al 2003: 9).
Um Phänomene feststellen zu können, die im Kontext sozialer Netzwerke auftreten, ist eine fundierte Analyse sehr wichtig. Die ersten wissenschaftlichen Netzwerk-Analysen zeichneten sich durch eine hohe Komplexität aus, welche Untersuchungen in einem größeren Feld nicht ermöglichen konnten. Aus diesem Grund entwickelten Wissenschafterinnen und Wissenschaftler den Ansatz des Ego-Zentrierten Netzwerkes. Dabei möchte man im Rahmen von Befragungen die Beziehungen einer Person (EGO) zu seinem sozialen Umfeld (ALTERI) untersuchen (Huckfeldt 2007: 104).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen soziale Netzwerke die Wahlentscheidung?
Individuen werden stark von ihrem direkten sozialen Umfeld geprägt. Durch Kommunikation und soziale Bindungen bilden sich politische Meinungen und Interessen heraus, was als „Social logic of politics“ bezeichnet wird.
Was ist der mikro-soziologische Ansatz in der Wahlforschung?
Dieser Ansatz fokussiert sich auf die Individualdatenebene und untersucht, wie persönliche Beziehungen und die Einbettung in soziale Strukturen das Wahlverhalten beeinflussen.
Was ist der Unterschied zwischen homogenen Gruppen und sozialen Netzwerken?
Frühere Modelle der Columbia School gingen von homogenen Gruppen aus. Moderne Netzwerkforschung berücksichtigt hingegen Asymmetrien und unterschiedliche Bindungsstärken zwischen Personen.
Haben mediale Nachrichten einen Einfluss auf Netzwerkmitglieder?
Ja, die Arbeit untersucht, inwieweit mediale Informationen über soziale Netzwerke gefiltert und an die einzelnen Mitglieder weitergegeben werden, was deren Wahlverhalten beeinflusst.
Was versteht man unter einem "Ego-Zentrierten Netzwerk"?
Dies ist ein Analyseansatz, bei dem die Beziehungen einer zentralen Person (EGO) zu ihren Kontaktpersonen (ALTERI) im Rahmen von Befragungen untersucht werden.
- Citar trabajo
- B.A. Anna Leiber (Autor), 2012, Wer prägt unser Wahlverhalten?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264447