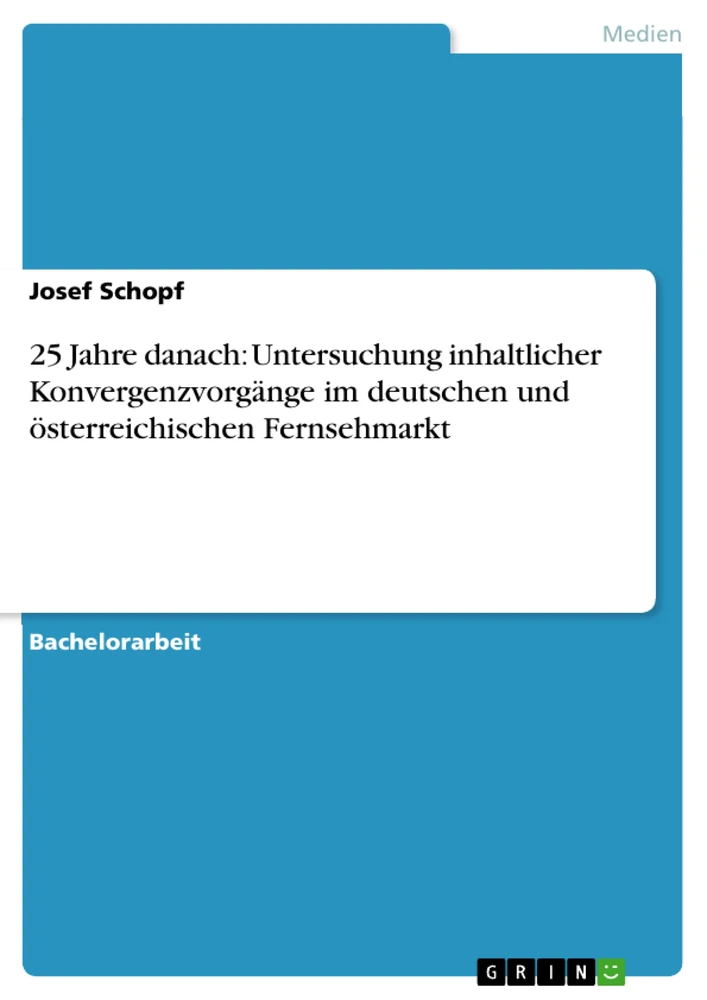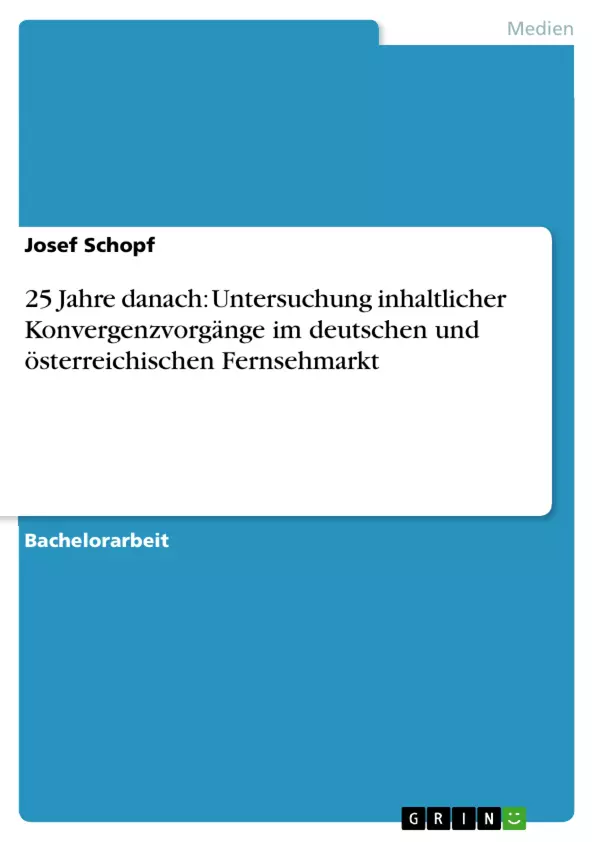25 Jahre ist es mittlerweile aus, als am 1. Jänner 1984 das Privatfernsehen mit den Worten „Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Moment sind sie Zeuge des Starts des ersten privaten Fernsehveranstalters in der Bundesrepublik Deutschland“, durch den später in Sat.1 umbenannten Fernsehsender PKS in Deutschland eingeführt wurde. Einen Tag danach ging auch RTL auf Sendung. Das Privatfernsehen war geboren. 1984 konnte der durchschnittliche Haushalt drei Programme – ARD, ZDF und das jeweilige Regionalprogramm – empfangen. Heute wählen hingegen fast 80 Prozent der Haushalte aus über 30 Programmen aus. Die Mehrzahl der Programme wird bereits heute von privaten Anbietern zur Verfügung gestellt.
Aufgrund der fortschreitenden Medienevolution stieg das Informationsangebot der Fernsehsender in den letzten Jahrzehnten enorm an. Der Einfluss der Medien wurde immer größer. In den ersten sieben Jahren dieses Jahrzehnts lagen die Gesamt-TV-Reichweiten in Österreich immer über 60 Prozent. Alleine dadurch zeigt sich schon der Einfluss, den das Fernsehen auf die Menschen ausüben kann. Was die Marktanteile in Österreich betrifft, so erreichten die beiden ORF Programme ORF 1 und ORF 2 im Jahr 2007 miteinander einen Marktanteil von über 43 Prozent. Doch mit diesen hohen Werten kommt auch eine große Verantwortung auf die Fernsehbranche generell und auf die Öffentlich-Rechtlichen im Speziellen zu. Durch gewisse Vorgaben wie dem Rundfunkstaatsvertrag Deutschlands oder dem ORF-Gesetz in Österreich soll gewährleistet werden, dass die Qualität und die Vielfalt gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich hoch gehalten wird.
Durch die Einführung des Privatfernsehens vor 25 Jahren änderte sich die Marktsituation für immer. Die Öffentlich-Rechtlichen mussten nun zum ersten Mal lernen, mit Konkurrenz umzugehen. Die Zahl der Medienorganisationen wurde im Laufe der Zeit immer höher und gerade in den letzten Jahren sind besonders viele neue Anbieter auf den Markt gekommen. Diese Vielzahl an Medienorganisationen ist zwar noch keine Garantie, aber zumindest eine Chance für inhaltliche Vielfalt. Im Laufe der hier vorliegenden Arbeit soll nun überprüft werden, ob die vielen Medienorganisationen am deutschen und österreichischen Fernsehmarkt ihre Chance auf diese inhaltliche Vielfalt genutzt haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Teil
- 2.1. Duales Rundfunksystem
- 2.2. Postulat der Grundversorgung
- 2.3. Konvergenzdebatte – Die Frage der Vielfalt
- 2.4. Zur Geschichte des dualen Rundfunks
- 2.4.1. Situation nach dem zweiten Weltkrieg
- 2.4.2. Entwicklungen seit dem Startschuss
- 3. Methodische Vorgehensweise
- 3.1. Sekundäranalyse
- 3.2. Fallbeispiel - Fernsehprogramm
- 4. Empirischer Teil
- 4.1. Die Öffentlich-Rechtlichen
- 4.1.1. ARD
- 4.1.2. ZDF
- 4.1.3. ORF
- 4.2. Die Privat-Kommerziellen
- 4.2.1. RTL Group
- 4.2.2. ProSiebenSat.1 Media AG
- 4.2.3. ATV
- 4.2.4. Puls 4
- 4.2.5. Austria 9 TV
- 4.3. Rechtliche Rahmenbedingungen
- 4.4. Ergebnisse zur Konvergenzhypothese
- 4.5. Fernsehwoche: 6. März 2010 – 12. März 2010
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die inhaltlichen Konvergenzvorgänge im deutschen und österreichischen Fernsehmarkt 25 Jahre nach der Einführung des Privatfernsehens. Sie zielt darauf ab, die Auswirkungen der Medienevolution auf die Programmangebote von öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehveranstaltern zu untersuchen. Dabei werden die Entwicklungen im dualen Rundfunksystem sowie die Konvergenztheorie im Kontext der Frage nach der Programvielfalt beleuchtet. Die Arbeit befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen des dualen Rundfunksystems und stellt die Ergebnisse der Forschung zur Konvergenzthese anhand aktueller Daten dar. Sie verknüpft die Analyse mit einem Fallbeispiel, um die Frage zu beantworten, ob die Einführung des Privatfernsehens zur Programmvielfalt beigetragen hat oder ob die inhaltliche Konvergenz heute größer ist denn je.
- Die Entwicklung des dualen Rundfunksystems in Deutschland und Österreich
- Die Konvergenztheorie und ihre Auswirkungen auf die Programmangebote
- Die Frage der Programvielfalt im Kontext des dualen Rundfunksystems
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche und private Fernsehveranstalter
- Aktuelle Forschungsergebnisse zur Konvergenzthese im Vergleich
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt den Leser in das Thema ein und beleuchtet die historische Entwicklung des Privatfernsehens in Deutschland und Österreich. Kapitel 2 befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund der Arbeit und definiert wichtige Begriffe wie duales Rundfunksystem, Grundversorgung und Konvergenzdebatte. Es werden die wichtigsten Aspekte der Geschichte des dualen Rundfunksystems im Kontext der Medienevolution dargestellt. Kapitel 3 erläutert die methodische Vorgehensweise der Arbeit, die auf einer Sekundäranalyse und einem Fallbeispiel basiert. Kapitel 4 stellt den empirischen Teil der Arbeit dar, der die Programmangebote von öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehveranstaltern in Deutschland und Österreich analysiert. Es werden die Ergebnisse der Forschung zur Konvergenzthese präsentiert und mit einem aktuellen Fallbeispiel verknüpft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themenfelder des dualen Rundfunksystems, Konvergenzdebatte, Programvielfalt, Öffentlich-Rechtliche, Privat-Kommerziellen, Fernsehmarkt, Medienevolution, rechtliche Rahmenbedingungen, Sekundäranalyse und Fallbeispiel. Sie analysiert die Auswirkungen der Einführung des Privatfernsehens auf die Programmangebote und befasst sich mit der Frage, ob die inhaltliche Konvergenz von öffentlich-rechtlichen und privaten Programmen heute größer ist denn je. Die Arbeit bezieht sich auf aktuelle Forschungsergebnisse und stellt einen Vergleich zwischen verschiedenen Studien zur Konvergenzthese dar.
Häufig gestellte Fragen
Wann startete das Privatfernsehen in Deutschland?
Das Privatfernsehen startete am 1. Januar 1984 mit dem Sender PKS (später Sat.1), gefolgt von RTL am nächsten Tag.
Was versteht man unter dem dualen Rundfunksystem?
Es bezeichnet das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen Sendern (wie ARD, ZDF, ORF) und privaten, kommerziellen Anbietern.
Was besagt die Konvergenzhypothese im Fernsehmarkt?
Die Hypothese untersucht, ob sich die Programme von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern aufgrund des Wettbewerbs inhaltlich immer ähnlicher werden.
Wie hoch ist der Marktanteil des ORF in Österreich (Stand 2007)?
Im Jahr 2007 erreichten die beiden Programme ORF 1 und ORF 2 zusammen einen Marktanteil von über 43 Prozent.
Welche rechtlichen Vorgaben sichern die Qualität im Rundfunk?
In Deutschland ist dies der Rundfunkstaatsvertrag und in Österreich das ORF-Gesetz, die Vielfalt und Qualität insbesondere im öffentlich-rechtlichen Bereich gewährleisten sollen.
- Quote paper
- Bakk. Komm. BA Josef Schopf (Author), 2010, 25 Jahre danach: Untersuchung inhaltlicher Konvergenzvorgänge im deutschen und österreichischen Fernsehmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264533