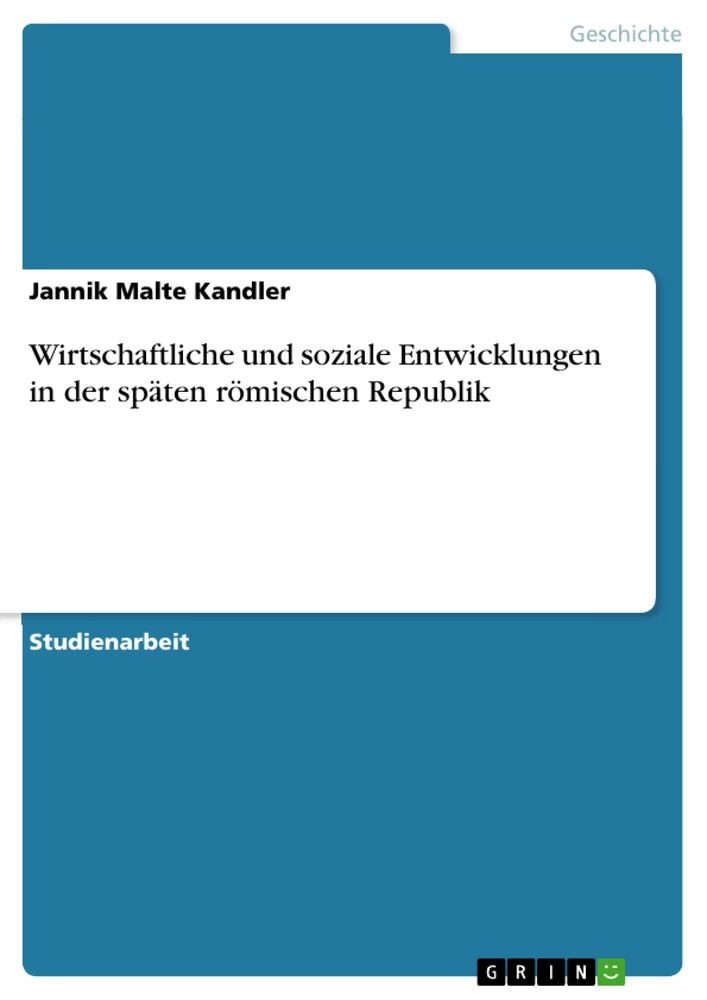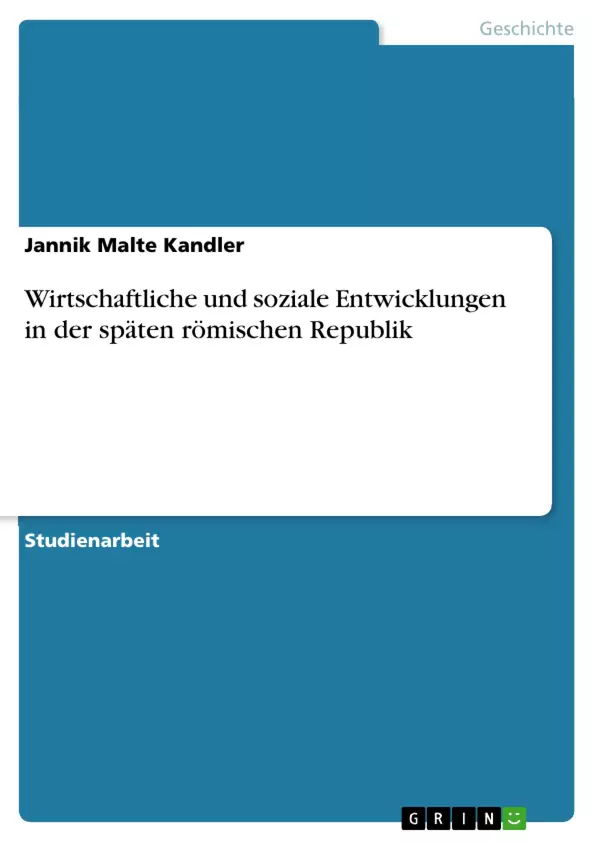Das Ziel dieser Arbeit soll sein, wesentliche Entwicklungstendenzen im Bereich der
römischen Ökonomie und Sozialordnung, sowie ihre Interdependenzen für den Zeitraum der
Römischen Republik ab den großen Eroberungskriegen, also ab dem 2. Jahrhundert v. Chr.,
aufzuweisen. Dieser Zeitraum ist, gerade auch im Hinblick auf die Gesamtgeschichte Roms,
deshalb von besonderer Bedeutung, weil in diesem eine Umschichtung bzw. eine
Differenzierung der Gesellschaft stattfand in einer Weise, wie es sie in zuvor bestehenden
römischen Sozialordnungen nicht gegeben hatte.2 Viele Autoren sehen genau in diesen
Entwicklungen wesentliche Gründe für die Krise der späten Republik, die anschließend in das
Prinzipat mündete, was die genauere Betrachtung jener Veränderungen notwendig macht.
„Latifundia perdidere Italiam” – die Latifundien haben Italien vernichtet! – dieser Ausspruch
von Plinius kann als Andeutung dafür verstanden werden, was für weitreichende Folgen
genannte Entwicklungen tatsächlich nach sich zogen. Das Aufkommen großer Landgüter in
der späten Republik steht in dem gleichen historischen Zusammenhang wie die erwähnte
Landflucht der Bauern. Welche ökonomische Dynamik lag aber all dem zugrunde und welche
sozialen Verhältnisse resultierten hieraus? – Dieser Frage wollen wir in der folgenden Arbeit
nachgehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen nach dem Zweiten Punischen Krieg
2.1. Die spätrepublikanische Geldwirtschaft und die Entwicklungen in der Landwirtschaft
2.2. Die ökonomischen und sozialen Verhältnisse in der Stadt Rom
3. Schlussbetrachtung
4. Literaturverzeichnis
5. Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welcher Zeitraum wird in dieser Arbeit untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die späte römische Republik ab dem 2. Jahrhundert v. Chr., beginnend mit den großen Eroberungskriegen.
Was bedeutet der Satz „Latifundia perdidere Italiam“?
Dieser Ausspruch von Plinius bedeutet „Die Latifundien haben Italien vernichtet“ und bezieht sich auf die negativen Folgen der Entstehung riesiger Landgüter für die römische Gesellschaft.
Warum kam es zur Landflucht der Bauern?
Durch die ökonomische Dynamik und das Aufkommen der Latifundien konnten kleine Bauernhöfe nicht mehr konkurrieren, was zu einer massiven Abwanderung in die Stadt Rom führte.
Welche Rolle spielte die Geldwirtschaft nach dem Zweiten Punischen Krieg?
Die Arbeit untersucht, wie die Entwicklung der Geldwirtschaft die sozialen Verhältnisse und die Landwirtschaft in Italien grundlegend veränderte.
Führten diese Entwicklungen zur Krise der Republik?
Ja, viele Historiker sehen in der sozialen Umschichtung und den ökonomischen Spannungen wesentliche Gründe für den Untergang der Republik und den Übergang zum Prinzipat.
- Citar trabajo
- Jannik Malte Kandler (Autor), 2012, Wirtschaftliche und soziale Entwicklungen in der späten römischen Republik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264558