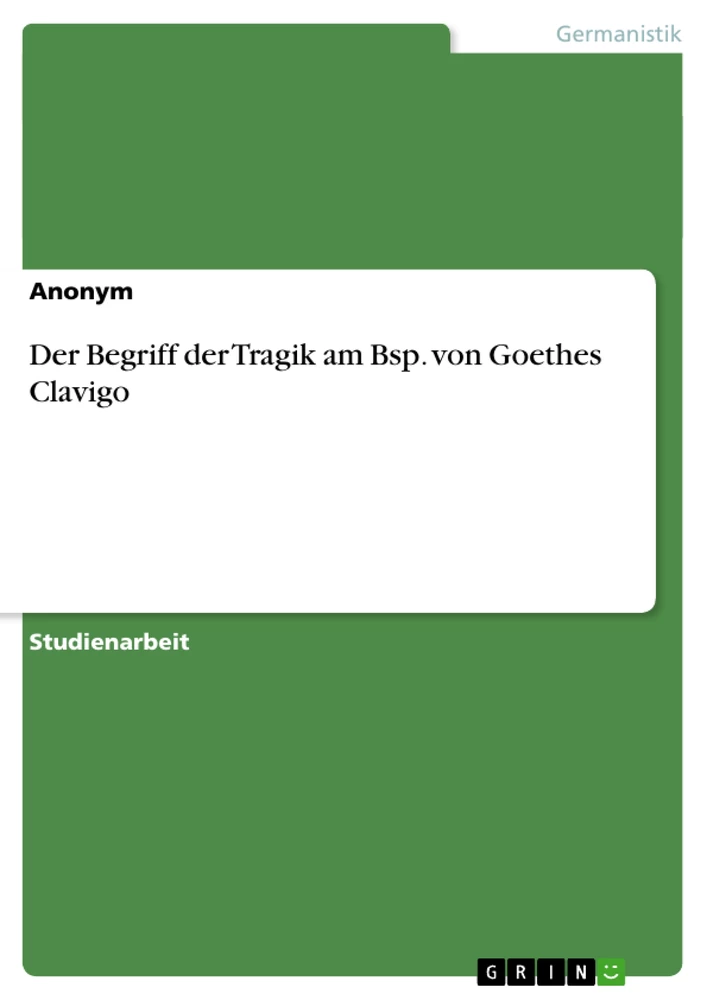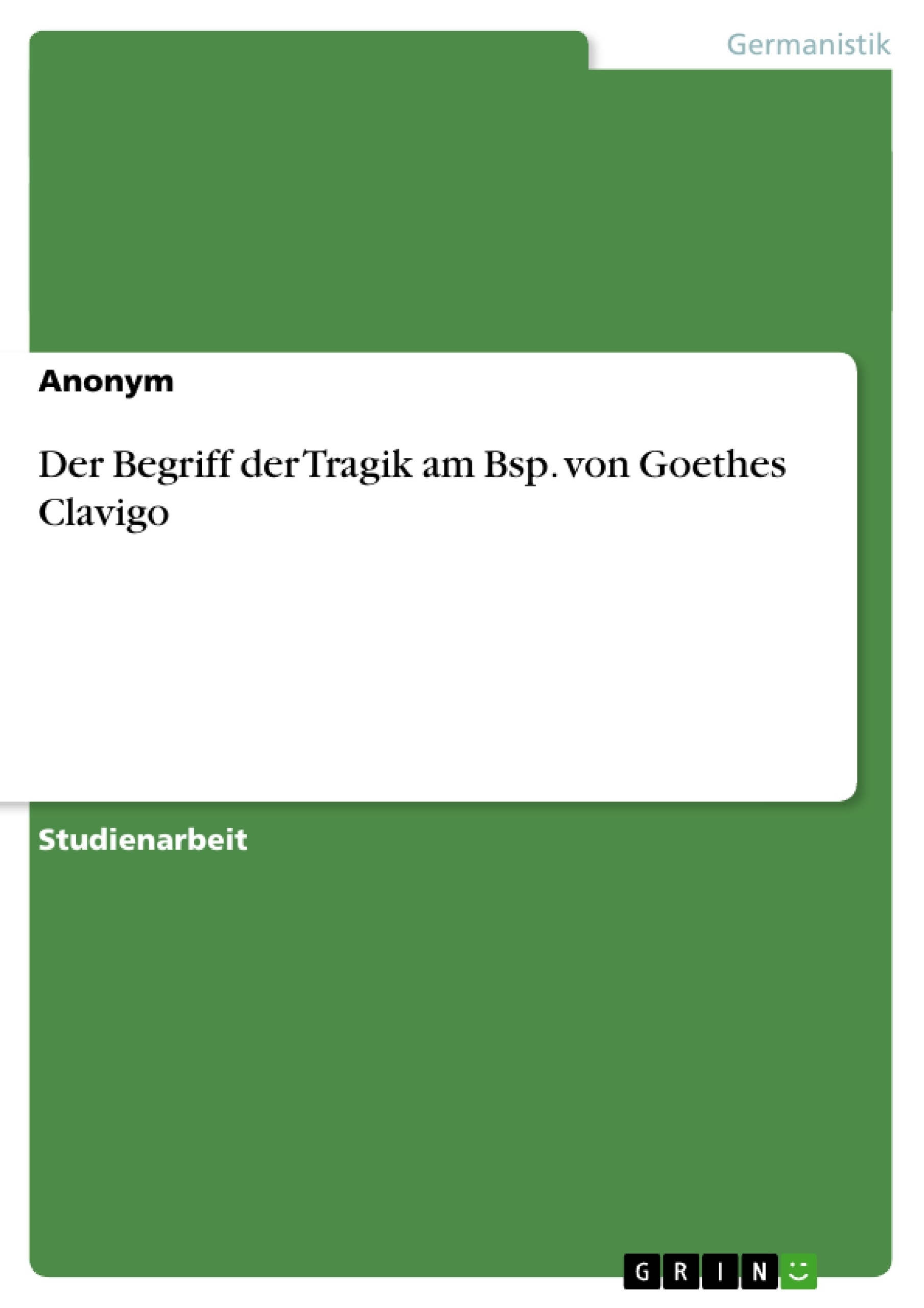Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit Goethes Drama
„Clavigo“, dem Nachfolger des „Götz von Berlichingen“,
welches der Autor selbst als „kleinere faßliche Produktion“1
bezeichnete. Als Vorlage dienten Goethe hierbei die Memoiren
eines Zeitgenossen, des französischen Kaufmanns und
Schriftstellers Pierre Beaumarchais, die ihn zur Verarbeitung
dieses Gegenwartsstoffes inspirierten.
Die Dramenhandlung beruht demzufolge auf einer wahren
Begebenheit, die sich nach den dichterischen Eingriffen des
Verfassers folgendermaßen darstellt:
Clavigo, mittlerweile Archivar am Hof des Königs und
erfolgreicher Herausgeber, unterhielt in dem Zeitraum, als er
- noch mittellos und unbekannt - versuchte, sich in Spanien
einen Namen zu machen, eine Beziehung zu Marie Beaumarchais.
Während dieser Liaison verspricht er Marie, einer mit ihrer
Schwester Sophie, inzwischen verheiratete Guilbert,
zugezogene Französin, sie nach Verbesserung seiner
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage zu heiraten. Als
er dieser Vereinbarung trotz seines sozialen Aufstiegs nicht
nachkommt, erwartet ihn der zu Hilfe gerufene Bruder Maries,
dessen Sinn nach Rache und Rehabilitation der Schwester
steht. Clavigo willigt ein, eine von Beaumarchais aufgesetzte
Schulderklärung zu unterzeichnen, einigt sich allerdings mit
ihm darauf, den Versuch zu machen, Marie zurückzugewinnen.
Nachdem dieses tatsächlich glückt, gelingt es jedoch Clavigos
Freund und Vertrautem Carlos, Clavigo erneut umzustimmen und
ihn zur Intrige gegen Beaumarchais anzustiften. Marie stirbt,
nachdem sie davon erfährt. Im Schlußakt trifft Clavigo auf
den Leichenzug; am Grab Maries versetzt ihm Beaumarchais den
Todesstoß – und dennoch steht der Ausgang des Dramas im Zeichen der Versöhnung, wie die folgende Analyse des Stoffes
zeigen wird.
Der Titel der Arbeit weist darauf hin – Gegenstand der Arbeit
ist die tragische Substanz des Stückes. Die Vorgehensweise
wird dabei wie folgt verlaufen: [...]
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- I. DER BEGRIFF DER TRAGIK IM SPIEGEL DER SEKUNDÄRLITERATUR ANHAND VON AUSGEWÄHLTEN BEISPIELEN
- II. ZU GOETHES VERSTÄNDNIS DES TRAGISCHEN
- III. DIE GESTALTUNG DER FIGUREN IM HINBLICK AUF DIE TRAGIK IM ,,CLAVIGO"
- III. 1. CLAVIGO
- III.2. CARLOS
- IV. ASPEKTE DER HANDLUNG UNTER DEM GESICHTSPUNKT DER TRAGIK - MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES SCHLUSSES –
- NACHWORT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Goethes Drama „Clavigo“ im Hinblick auf seine tragische Substanz. Die Arbeit untersucht zunächst den Begriff der Tragik anhand ausgewählter theoretischer Ansätze. Anschließend wird Goethes Verständnis des Tragischen beleuchtet, um dann die tragischen Elemente in der Figuren- und Handlungsstruktur von „Clavigo“ zu untersuchen. Die Analyse wird dabei auf die Frage eingehen, ob und inwiefern sich Goethes praktische Umsetzung des Tragischen mit den theoretischen Überlegungen deckt.
- Begriffsbestimmung der Tragik in der Sekundärliteratur
- Goethes Verständnis des Tragischen
- Tragische Elemente in den Figuren von „Clavigo“
- Analyse der Handlungsstruktur im Hinblick auf das Tragische
- Vergleich zwischen theoretischen Ansätzen und praktischer Umsetzung in „Clavigo“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Hausarbeit beleuchtet verschiedene Ansätze zur Definition des Begriffs „Tragik“. Emil Staiger definiert Tragik als die Entziehung der Basis der menschlichen Existenz, während Wolfgang Kayser die Tragödie als ein Handlungsdrama betrachtet, das einer scheinbar sinnlosen Untergangssituation einen Sinn verleiht.
Im zweiten Kapitel wird Goethes Verständnis des Tragischen anhand seiner eigenen Aussagen und seiner Dramen beleuchtet.
Kapitel drei untersucht die Figuren des Dramas „Clavigo“ unter dem Aspekt der Tragik. Es werden dabei die Figuren Clavigo und Carlos im Detail analysiert, wobei besonderes Augenmerk auf ihre Handlungen und Motivationen gelegt wird.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Handlungsstruktur des Dramas und analysiert die Tragik im Kontext der Handlungsmotive und -entwicklung. Hierbei wird auch auf den Schluss des Dramas eingegangen.
Schlüsselwörter
Tragik, „Clavigo“, Johann Wolfgang Goethe, Emil Staiger, Wolfgang Kayser, Handlungsdrama, Figurentragödie, Schuld, Versöhnung, Handlungsstruktur, Figurencharakterisierung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Goethes Drama „Clavigo“?
Es behandelt den Aufstieg und Fall des Archivars Clavigo, der seine Verlobte Marie Beaumarchais aus Ehrgeiz verlässt, was schließlich zum tragischen Tod beider führt.
Wie definiert Emil Staiger den Begriff der Tragik?
Staiger sieht die Tragik in der Entziehung der Basis der menschlichen Existenz, wenn ein Mensch an den Grundfesten seines Seins scheitert.
Welche Rolle spielt die Figur des Carlos?
Carlos fungiert als Clavigos Freund und Versucher. Er verkörpert den rücksichtslosen Ehrgeiz und stiftet Clavigo zur Intrige gegen Marie an, was die Katastrophe auslöst.
Basiert „Clavigo“ auf einer wahren Begebenheit?
Ja, Goethe nutzte die Memoiren von Pierre Beaumarchais als Vorlage, der tatsächlich nach Spanien reiste, um die Ehre seiner Schwester Marie zu retten.
Warum steht der Schluss des Dramas im Zeichen der Versöhnung?
Trotz des gewaltsamen Endes am Grab deutet die Analyse darauf hin, dass die Charaktere in ihrem gemeinsamen Untergang eine Form von moralischer Klärung oder Versöhnung finden.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 1999, Der Begriff der Tragik am Bsp. von Goethes Clavigo, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26462