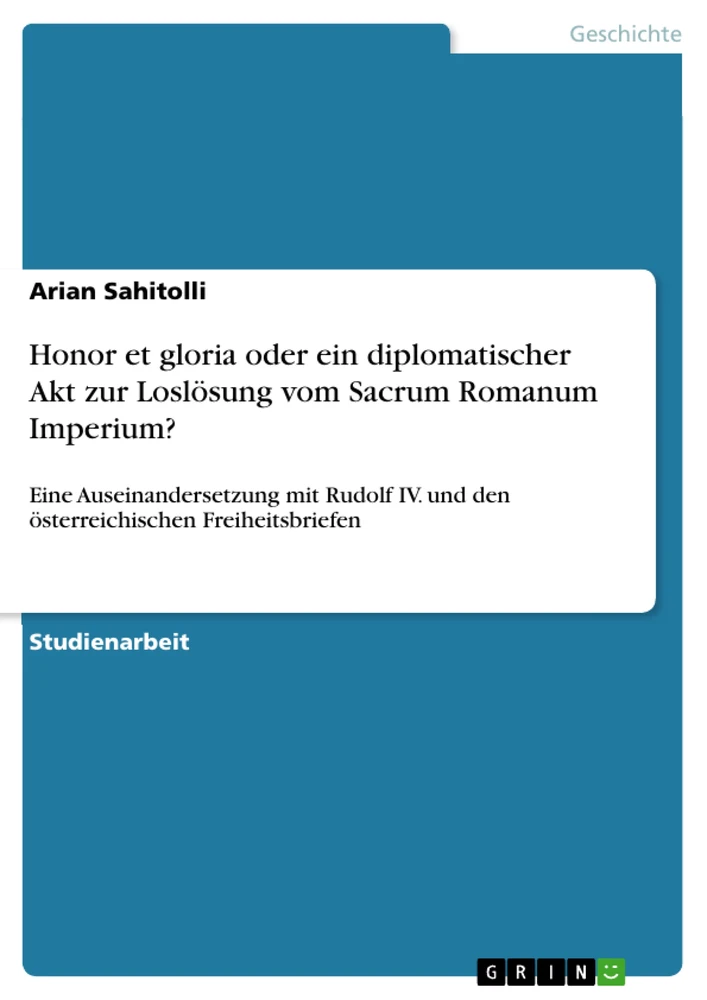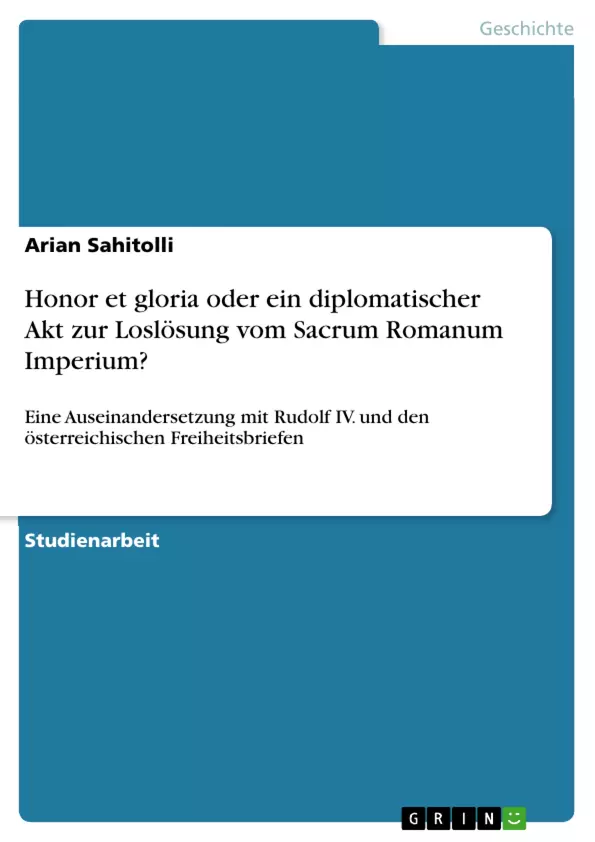Wie konnte das Mittelalter auf dem Gebiet der bildenden Kunst und der Literatur wie auf dem Gebiet der Geschichte so viele Fälschungen hervorbringen, obwohl es, wie Fritz Kern einprägsam formuliert hat, ,,eine eminente Zeit des Glaubens“ war?In Anlehnung an Furhmann erscheint tatsächlich dieses angedeutete Bild von der Spannbreite der Fälschungsaktionen noch düsterer, wenn man bedenkt, das bis in das hohe Mittelalter hinein die Täter nahezu ausnahmslos geistlichen Standes gewesen sein dürften, denn bis zur Entstehung einer bürgerlichen Kultur waren meist nur Kleriker schreibkundig.Trotz der Androhung hoher Strafen3 schreckte man angesichts des Ausmaßes an Fälschungsaktionen4 scheinbar nicht davor zurück, das Recht und den Wahrheitsbegriff nach den eigenen Vorstellungen zu deuten. Aber dennoch haben wir Historiker ein ambivalentes Verhältnis gerade zu den Urkundenfälschungen: Auf der einen Seite finden wir diese Fälschungen zu tiefst faszinierend und allemal interessanter als die vielen vertrauenswürdigen Originale. Auf der anderen Seite empfinden wir sie als unmoralisch und verwerflich.
In dieser Arbeit wird im Mittelpunkt der thematischen Auseinandersetzung eine weltliche Fälschungsaktion stehen, die erst fast fünf Jahrhunderte später durch den Historiker Wilhelm Wattenbach5 als solche entlarvt werden konnte: Die österreichischen Freiheitsbriefe. Dieser von Rudolf IV., dem Herzog Österreichs, der von 1358 bis 1365 die Regierungsgeschäfte gelenkt hatte, in Auftrag gegebene Fälschungskomplex entstand in der habsburgischen Kanzlei im Winter 1358/1359 und ist besonders deswegen interessant, weil es seit der Anerkennung durch Friedrich III. eine beeindruckende historische Wirkmächtigkeit für die Zukunft eröffnet hat.6 Im Zentrum dieser Arbeit wird daher die Frage nach der Absicht der österreichischen Freiheitsbriefe stehen. Wollte Rudolf IV. den für das Mittelalter in besonderer Weise wichtigen honor et gloria ausbauen oder möglichweise zurückerobern, oder ging es ihn eventuell um die Loslösung seines Herzogtums Österreich vom Reich?
Die These, dass die Handlungsweise Rudolfs IV. besonders vor dem Hintergrund der enormen Bedeutung der Zeremonien, Rituale und Symbole im Rahmen der dynastischen Konkurrenz zu betrachten ist, soll diese Arbeit umrunden. Auf der Basis einer tiefgründigen Auseinandersetzung mit den lateinischen Originalquellen, die in der Forschung bisher noch nicht im Fokus standen, wird die Leitfrage dieser Arbeit im Schlussteil beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Fälschungen im eminenten Zeitalter des Glaubens
- 2. Die Erhabenheit Österreichs unter der Regenschaft der Habsburger
- 2.1 Rudolf IV. Die „fürstliche Majestät“ von Österreich
- 3. Die österreichischen Freiheitsbriefe im Spiegel seiner Zeit
- 3.1 Der Kampf mit der Feder. Rudolf IV. - Ein betrogener Betrüger?
- 3.2 Privilegien, Insignien, Titulatur- die österreichischen Freiheitsbriefe als Grundlage für einen „Reichsstreich\"?
- 4. Rudolf IV. Der Herausforderer des hegemonialen Königs Karl IV
- 4.1 Karls Reaktion auf die österreichischen Freiheitsbriefe- Hinters Licht geführt oder aufgedeckt?
- 4.2 Imitatio Karl IV.? Rudolfs IV. Beziehungen zu seinem luxemburgischen Widersacher.
- 5. Fazit: De justitia et jure- Rudolfs IV. Ringen um Rang und Einfluss im Reich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die österreichischen Freiheitsbriefe, eine Fälschungsaktion des österreichischen Herzogs Rudolf IV., die im Winter 1358/1359 in der habsburgischen Kanzlei entstand. Die Arbeit befasst sich mit der Frage nach der Absicht Rudolfs IV., ob er den „honor et gloria“ ausbauen oder die Loslösung Österreichs vom Reich anstrebte. Dabei wird der historische Kontext der Entstehung der Freiheitsbriefe sowie die Herrschaftsauffassung Rudolfs IV. und seine Beziehung zu Kaiser Karl IV. beleuchtet.
- Die Fälschungsaktionen im Mittelalter und ihre Bedeutung
- Die Herrschaftsauffassung Rudolfs IV. und die österreichischen Freiheitsbriefe
- Die Beziehung zwischen Rudolf IV. und Kaiser Karl IV.
- Die historische Entwicklung des Herzogtums Österreich im Spätmittelalter
- Die Rolle des „Privilegium minus“ in der Konzeption der österreichischen Freiheitsbriefe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und beleuchtet den Kontext von Fälschungen im Mittelalter. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Erhabenheit Österreichs unter den Habsburgern und fokussiert insbesondere auf die Persönlichkeit und Herrschaftsauffassung Rudolfs IV. Kapitel 3 analysiert die österreichischen Freiheitsbriefe im historischen Kontext und diskutiert die These, dass Rudolf IV. diese Fälschungen zur Durchsetzung eigener Machtansprüche genutzt hat. In Kapitel 4 wird die Reaktion Karls IV. auf die Freiheitsbriefe untersucht und die Beziehung zwischen den beiden Herrschern beleuchtet.
Schlüsselwörter
Österreichische Freiheitsbriefe, Rudolf IV., Karl IV., Fälschungen, Mittelalter, Herrschaftsauffassung, Habsburger, „honor et gloria“, Privilegium minus, Geschichte Österreichs, Spätmittelalter.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die „österreichischen Freiheitsbriefe“?
Es handelt sich um einen Komplex von Urkundenfälschungen, die Herzog Rudolf IV. im Winter 1358/1359 in Auftrag gab, um Österreich weitreichende Privilegien zu sichern.
Warum fälschte Rudolf IV. diese Dokumente?
Rudolf IV. wollte den Rang des Hauses Habsburg im Reich stärken, nachdem Österreich in der Goldenen Bulle von 1356 bei der Kurfürstenwürde übergangen worden war.
Wie reagierte Kaiser Karl IV. auf die Fälschungen?
Karl IV., ein versierter Machtpolitiker, erkannte die Fälschungen (unterstützt durch Gelehrte wie Petrarca) und verweigerte zunächst die Anerkennung der darin geforderten Rechte.
Wann wurden die Freiheitsbriefe als Fälschung entlarvt?
Obwohl sie jahrhundertelang als echt galten, entlarvte der Historiker Wilhelm Wattenbach sie erst im 19. Jahrhundert wissenschaftlich als Fälschungen.
Was war das Ziel: Unabhängigkeit oder Ehre?
Die Arbeit untersucht, ob es Rudolf IV. primär um „honor et gloria“ (Ehre und Ruhm) im dynastischen Wettbewerb oder um eine tatsächliche Loslösung vom Reich ging.
- Citation du texte
- Arian Sahitolli (Auteur), 2013, Honor et gloria oder ein diplomatischer Akt zur Loslösung vom Sacrum Romanum Imperium?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264773