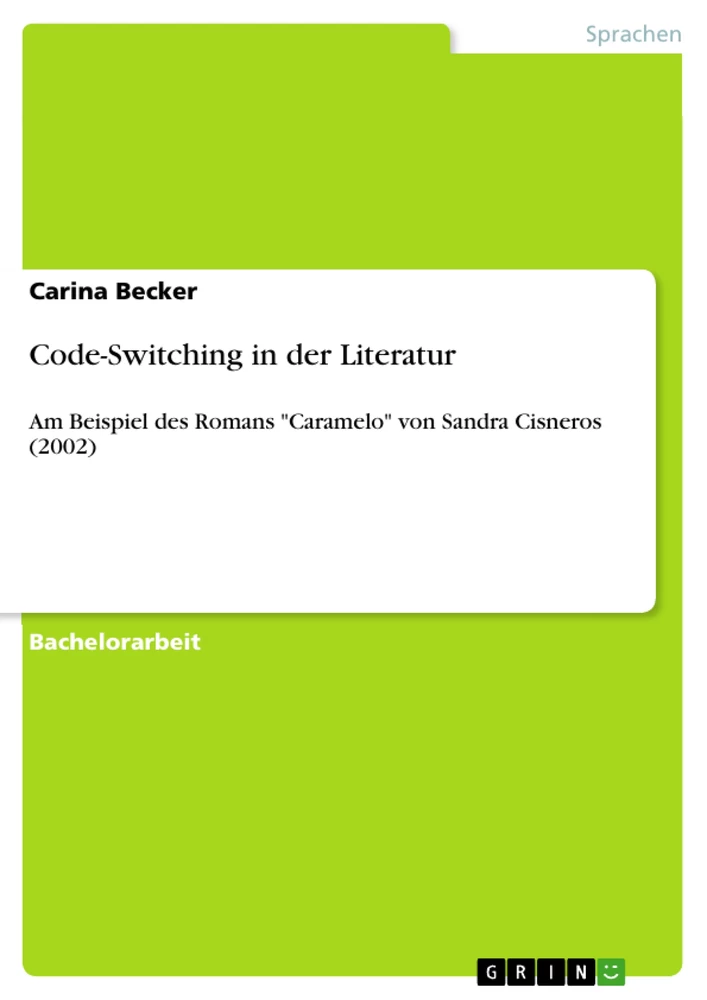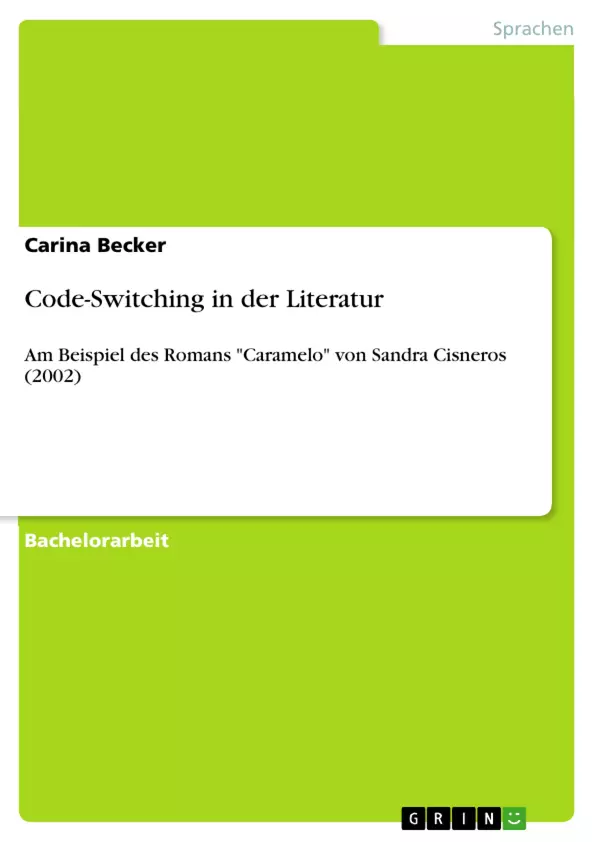Menschen, die mit mehr als einer Muttersprache aufwachsen oder in einer bilingualen Gesellschaft leben, sind nicht nur mit dem Aufeinandertreffen mehrerer Kulturen konfrontiert, sondern auch tagtäglich mit dem Sprachkontaktphänomen des Code-switchings. Der Wechsel zwischen zwei oder auch mehreren Sprachen ist der „Stempel“ multikultureller Gesellschaften. Es gibt heute kaum noch ein Land, in dem nur eine einzige Sprache gesprochen wird. Nicht nur in der zwischenmenschlichen, alltäglichen Kommunikation bilingualer Sprecher ist die Verwendung des Code-switchings häufig, auch in der modernen Literatur trifft man auf dieses sprachliche Phänomen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema des Code-switchings in der fiktiven Mündlichkeit anhand des zweisprachigen Romans „Caramelo” aus dem Jahr 2002 von Sandra Cisneros. Der Roman handelt von einer mexikanischen Familiengeschichte, erzählt aus der Sicht des jungen Mädchens Celaya (Lala) Reyes. Die Familie Reyes lebt in Chicago und fährt im Jahr 1962 im Sommerurlaub nach Mexico City, um dort die Großeltern zu besuchen. Celaya berichtet mittels Erzählungen der Verwandten über das Leben ihrer Großeltern, Eltern und Tanten.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedenen Sprachwechseltypen aus dem Roman herauszufiltern und unter anderem die Motivation für diese herauszuarbeiten. Wann, warum und wie wird von der Sprache A in die Sprache B gewechselt? Gibt es spezielle Bereiche, in denen der Sprachwechsel besonders häufig vorkommt? Trifft man auf Hinweise, die im Voraus einen Code-switch ankündigen?
Es werden das sprachliche Phänomen des Code-switchings in der Alltagssprache und die verschiedenen Sprachwechseltypen, welche im weiteren Verlauf dieser Arbeit anhand des Romans analysiert werden, vorgestellt. Ebenso wird auf die Erforschung und Anerkennung des Code-switchings, das häufig mit Interferenzen gleichgestellt wurde, eingegangen.
Nicht nur die unterschiedlichen Arten des Code-switchings werden erklärt, sondern auch sprachliche sowie soziale und kulturelle Motive des Sprachwechsels. Ist Code-switching identifikationsstiftend? Wird es angewandt, um die Emotionalität zu verstärken, einen Sprecher auszuschließen oder den Kontext besser zu beschreiben? Was ist „metaphorical” und was „situational” Code-switching? Gibt es immer wieder rekurrierende, spanische Elemente in dem Roman und was ist deren Funktion?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition: Code-switching in der Alltagssprache
- Wandel der Anerkennung des Code-switchings
- Interferenz versus Code-switch
- Formale und funktionale Aspekte des Code-switchings in der Alltagssprache
- Formale Aspekte des Code-switchings in der Alltagssprache
- Funktionale Aspekte des Code-switchings in der Alltagssprache
- Ausdrucksschwierigkeiten des Sprechers
- Identifikationsstiftendes Code-switching
- „Situational" Code-switching
- „Metaphorical" Code-switching
- Sprachliche Bedarfsdeckung
- Ausschluss von Sprechern
- Emotionalität und Code-switching
- Zweisprachigkeit in der Literatur
- Kontextualisierung nach Peter Auer
- Interaktionsteilnehmer
- Handlungsschemata
- Kontextualisierungshinweise
- Sprecher und Rezipient
- Adressat und Zuhörern
- Steigerung der Dringlichkeit
- Kommunikationsinhalt
- Beziehung der Gesprächspartner
- Konversatlonsanalyse : Part 1 , Kapitel 20 „Echando palabras '
- Analyse des ersten Abschnitts
- Analyse des zweiten Abschnitts
- Analyse des dritten Abschnitts
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Selbstständigkeitserklärung zur Bachelorarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht das Phänomen des Code-switchings in der Literatur am Beispiel des Romans „Caramelo" von Sandra Cisneros. Ziel ist es, die verschiedenen Sprachwechseltypen im Roman zu identifizieren und deren Motivationen zu analysieren. Die Arbeit betrachtet, wann, warum und wie zwischen den Sprachen gewechselt wird, ob es Bereiche gibt, in denen der Sprachwechsel besonders häufig vorkommt, und ob es Hinweise gibt, die einen Code-switch ankündigen.
- Code-switching in der Alltagssprache und Literatur
- Formale und funktionale Aspekte des Code-switchings
- Kontextualisierung und Konversationsanalyse
- Zweisprachigkeit und kulturelle Identität in „Caramelo"
- Analyse der fiktiven Mündlichkeit im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Code-switching ein und stellt den zweisprachigen Roman „Caramelo" von Sandra Cisneros als Untersuchungsgegenstand vor. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert die wichtigsten Punkte, die im weiteren Verlauf behandelt werden.
Das zweite Kapitel definiert den Begriff Code-switching und beleuchtet die Entwicklung seiner Anerkennung in der Sprachwissenschaft. Es grenzt Code-switching von Interferenz ab und zeigt die unterschiedlichen Bezeichnungen für das Phänomen auf.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit den formalen und funktionalen Aspekten des Code-switchings in der Alltagssprache. Es stellt die drei Code-switching-Typen nach Shana Poplack vor und erläutert deren Anwendung anhand von Beispielen aus „Caramelo". Anschließend werden verschiedene Funktionen des Code-switchings wie Ausdrucksschwierigkeiten, Identifikation, Situationsanpassung, kulturelle Besonderheiten, Ausschluss von Sprechern und die Vermittlung von Emotionalität vorgestellt und mit Beispielen aus dem Roman illustriert.
Kapitel 4 widmet sich der Zweisprachigkeit in der Literatur und zeigt auf, wie sie in verschiedenen Werken eingesetzt wird. Es werden die drei Typen der Zweisprachigkeit nach Georges Lüdi vorgestellt und dem Roman „Caramelo" zugeordnet. Der Abschnitt geht auf die Prinzipien der Kontextualisierung nach Peter Auer ein und erläutert deren Relevanz für die Konversationsanalyse.
Kapitel 5 analysiert einen Ausschnitt aus dem 20. Kapitel „Echando palabras" des Romans „Caramelo" mithilfe der Kriterien der Kontextualisierung nach Peter Auer. Der Streit zwischen den Eltern Zoila und Inocencio wird in drei Teilabschnitte unterteilt und analysiert. Die Analyse fokussiert auf die Interaktionsteilnehmer, das Handlungsschema, die Kontextualisierungshinweise, die Konstellation von Sprecher-Rezipient und Adressat-Zuhörer, die Steigerung der Dringlichkeit, den Kommunikationsinhalt und die Beziehung der Gesprächspartner. Besonderes Augenmerk liegt auf der Verwendung von Code-switches und deren Funktion in der Kommunikationssituation.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Code-switching, Zweisprachigkeit, Literatur, Sandra Cisneros, „Caramelo", Konversationsanalyse, Kontextualisierung, fiktive Mündlichkeit, kulturelle Identität, mexikanische Kultur, spanische Sprache, englische Sprache, Sprachwechseltypen, Funktionen des Code-switchings, intersententiales Code-switching, intrasententiales Code-switching, Ausdrucksschwierigkeiten, Identifikation, Situationsanpassung, kulturelle Besonderheiten, Ausschluss von Sprechern, Emotionalität, Beziehung der Gesprächspartner, Interaktionsteilnehmer, Handlungsschema, Kontextualisierungshinweise, Sprecher-Rezipient, Adressat-Zuhörer, Steigerung der Dringlichkeit, Kommunikationsinhalt.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Code-Switching in der Literatur?
Es bezeichnet den Wechsel zwischen zwei oder mehr Sprachen innerhalb eines literarischen Textes, oft um Multikulturalität und fiktive Mündlichkeit darzustellen.
Worum geht es in dem Roman „Caramelo“ von Sandra Cisneros?
Der Roman erzählt eine mexikanisch-amerikanische Familiengeschichte und nutzt Code-Switching zwischen Englisch und Spanisch, um die Identität der Protagonisten abzubilden.
Was sind die Motive für einen Sprachwechsel (Code-Switch)?
Motive können der Ausdruck von Emotionalität, die Identitätsstiftung, der Ausschluss von Gesprächspartnern oder die bessere Beschreibung kultureller Kontexte sein.
Was ist der Unterschied zwischen „situational“ und „metaphorical“ Code-Switching?
Situationales Code-Switching reagiert auf eine Änderung der Sprechsituation. Metaphorisches Code-Switching nutzt den Sprachwechsel als Stilmittel, um die Bedeutung oder soziale Ebene zu verändern.
Ist Code-Switching dasselbe wie eine Interferenz?
Nein, während Interferenz oft als Fehler (Einfluss einer Sprache auf die andere) gesehen wird, gilt Code-Switching als kompetente Nutzung beider Sprachsysteme.
Wie hilft Code-Switching bei der Charakterisierung von Figuren?
Durch den Sprachwechsel können Herkunft, Bildungsstand und die emotionale Nähe oder Distanz zwischen den Figuren authentisch dargestellt werden.
- Citation du texte
- Carina Becker (Auteur), 2013, Code-Switching in der Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264870