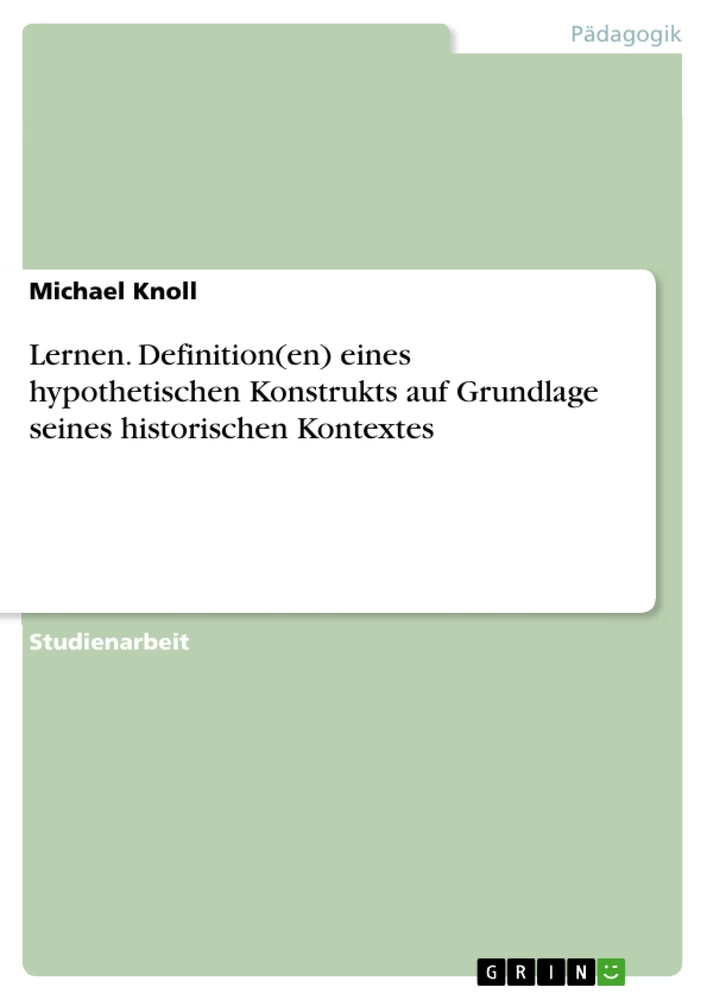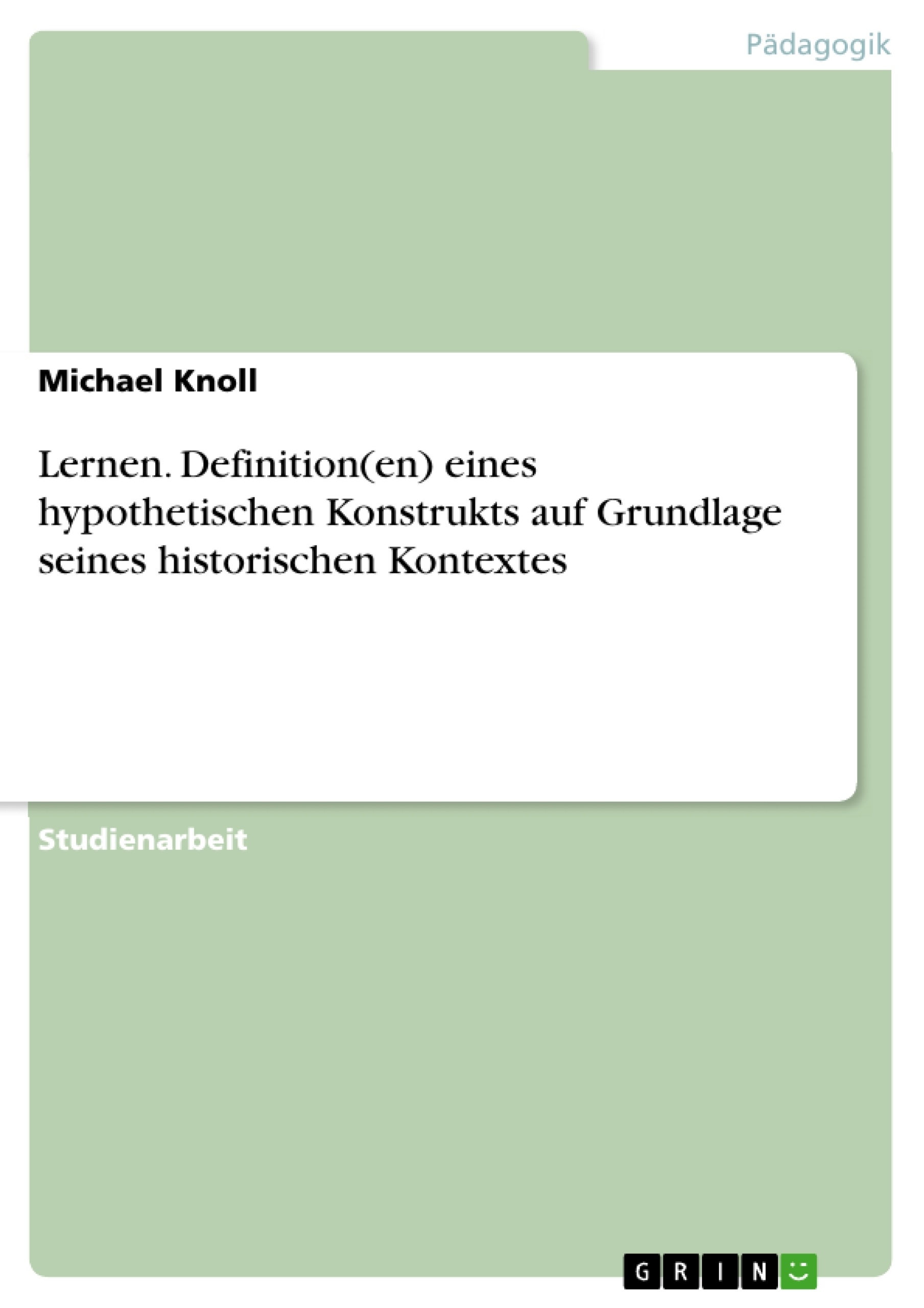Der Begriff Lernen ist ein hypothetisches Konstrukt. Das bedeutet zum einen, dass er nicht materiell fassbar ist und daher nur durch verschiedene Indikatoren erschlossen werden kann. Zum anderen führt dieser theoretische Zugang dazu, dass sich Lernen auf unterschiedliche Weisen definieren lässt. Die wissenschaftliche Forschung beschäftigt sich bis heute in verschiedenen Disziplinen mit der Frage, was lernen eigentlich bedeutet. Der Fokus dieser Arbeit liegt dabei auf der pädagogischen Perspektive, da sie im Rahmen des grundwissenschaftlichen Teils eines Lehramtsstudiums entstand.
In einer von Umfang her stark eingeschränkten Hausarbeit können nicht alle historischen und aktuellen Überlegungen angeführt werden. So wird an zahlreichen Stellen sowohl im historischen als auch im erziehungswissenschaftlichen Kontext auf weiterführende Literatur verwiesen. Die Entscheidung für die Auswahl der in der Arbeit gewählten Ansätze erfolgte auf Grundlage des von Frau Dr. Seifert im Sommersemester 2012 an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main gehaltenen Seminars „Was bedeutet Bildung?“
Im ersten Teil der Hausarbeit wird der Begriff des Lernens von verwandten Begriffen des Erziehungswissenschaften wie Bildung und Erziehung abgegrenzt. Im zweiten Teil werden diese Erkenntnisse genutzt, um behavioristische, kognitionspsychologische und konstruktivistische Lerntheorien vor dem jeweiligen historischen Hintergrund zu beschreiben. Im dritten Teil werden einige Definitionen des Begriffs Lernen vorgestellt und anhand der Ergebnisse der vorangegangenen Abschnitte kritisch hinterfragt. Im Schlusskapitel werden die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst und ein Versuch unternommen, die im Untertitel dieser Arbeit implizierte Frage nach einer eindeutigen Definition von Lernen zu beantworten.
Grundlegende Literatur waren die beiden Artikel Lernen und Neue Unterrichtskultur – Veränderte Lehrerrolle von Herbert Gudjons sowie der Sammelwerksbeitrag Lernen von Jörg Dinkelaker.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Lernen in Abgrenzung von Bildung und Erziehung
- Wissenschaftliche Lerntheorien in ihrem historischen Kontext
- Behaviorismus
- Kognitionspsychologie
- Konstruktivismus
- Definitionen von Lernen
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Begriff „Lernen“ als hypothetisches Konstrukt, indem sie dessen Definitionen im Kontext seiner historischen Entwicklung beleuchtet. Der Fokus liegt auf der pädagogischen Perspektive. Die Arbeit grenzt den Begriff „Lernen“ von verwandten Begriffen wie „Bildung“ und „Erziehung“ ab und analysiert verschiedene Lerntheorien.
- Abgrenzung des Begriffs „Lernen“ von „Bildung“ und „Erziehung“
- Analyse behavioristischer Lerntheorien
- Beschreibung kognitionspsychologischer und konstruktivistischer Lerntheorien
- Präsentation und kritische Hinterfragung verschiedener Definitionen von Lernen
- Zusammenfassende Betrachtung und Versuch einer Definition von Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Begriff „Lernen“ als hypothetisches Konstrukt, das nur über Indikatoren erschlossen werden kann und daher unterschiedliche Definitionen zulässt. Die Arbeit konzentriert sich auf die pädagogische Perspektive und verweist auf die begrenzten Möglichkeiten einer Hausarbeit, alle relevanten Aspekte abzudecken. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Abgrenzung des Lernens von Bildung und Erziehung, die Darstellung verschiedener Lerntheorien und die kritische Betrachtung von Lerndefinitionen umfasst.
1. Lernen in Abgrenzung von Bildung und Erziehung: Dieses Kapitel differenziert den Begriff „Lernen“ von „Bildung“ und „Erziehung“. Während Lernen als wertneutrale Verhaltensänderung definiert wird, betonen Bildung und Erziehung die intentionale Vermittlung von Werten und Normen. Bildung wird mit der Aneignung von Wissen in Verbindung gebracht, während Erziehung das Erlernen sozialer Verhaltensweisen umfasst. Der Text unterstreicht die Unterschiede und die Bedeutung des historischen Kontextes für die jeweilige Definition.
2. Wissenschaftliche Lerntheorien in ihrem historischen Kontext: Dieses Kapitel befasst sich mit behavioristischen, kognitionspsychologischen und konstruktivistischen Lerntheorien. Es beleuchtet den historischen Kontext jeder Theorie und deren Einfluss auf das Verständnis von Lernen. Die jeweiligen Ansätze werden in ihren Grundzügen erläutert, wobei der Fokus auf deren Bedeutung für die pädagogische Praxis liegt und auf weiterführende Literatur verwiesen wird. Der Abschnitt hebt die Entwicklung des Lernverständnisses im Laufe der Zeit hervor und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für das pädagogische Handeln.
Schlüsselwörter
Lernen, Bildung, Erziehung, Behaviorismus, Kognitionspsychologie, Konstruktivismus, Lerntheorien, Verhaltensänderung, Wissensaneignung, pädagogische Perspektive, historischer Kontext, Definitionen.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Lernen - Ein Überblick
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick zum Thema „Lernen“. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der pädagogischen Perspektive und der Abgrenzung von Lernen zu Bildung und Erziehung. Die Arbeit analysiert verschiedene Lerntheorien (Behaviorismus, Kognitionspsychologie, Konstruktivismus) und präsentiert und hinterfragt kritisch verschiedene Definitionen von Lernen.
Welche Lerntheorien werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt die behavioristischen, kognitionspsychologischen und konstruktivistischen Lerntheorien. Für jede Theorie wird der historische Kontext beleuchtet und deren Bedeutung für die pädagogische Praxis erläutert. Es wird auf weiterführende Literatur verwiesen.
Wie wird der Begriff „Lernen“ definiert und abgegrenzt?
Die Hausarbeit grenzt den Begriff „Lernen“ von „Bildung“ und „Erziehung“ ab. Lernen wird als wertneutrale Verhaltensänderung definiert, während Bildung die Aneignung von Wissen und Erziehung das Erlernen sozialer Verhaltensweisen betont. Die Arbeit unterstreicht die Unterschiede und die Bedeutung des historischen Kontextes für die jeweilige Definition. Die Hausarbeit präsentiert und hinterfragt kritisch verschiedene Definitionen von Lernen und versucht abschließend eine eigene Definition zu formulieren.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit umfasst eine Einleitung, einen Hauptteil (mit den Unterkapiteln: Lernen in Abgrenzung von Bildung und Erziehung; Wissenschaftliche Lerntheorien in ihrem historischen Kontext mit den Unterpunkten Behaviorismus, Kognitionspsychologie und Konstruktivismus; Definitionen von Lernen) und Schlussbetrachtungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Lernen, Bildung, Erziehung, Behaviorismus, Kognitionspsychologie, Konstruktivismus, Lerntheorien, Verhaltensänderung, Wissensaneignung, pädagogische Perspektive, historischer Kontext, Definitionen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Begriff „Lernen“ als hypothetisches Konstrukt und beleuchtet dessen Definitionen im Kontext seiner historischen Entwicklung. Der Fokus liegt auf der pädagogischen Perspektive. Die Arbeit analysiert verschiedene Lerntheorien und versucht, eine umfassende Betrachtung des Begriffs „Lernen“ zu liefern.
- Quote paper
- Dr. Michael Knoll (Author), 2012, Lernen. Definition(en) eines hypothetischen Konstrukts auf Grundlage seines historischen Kontextes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264916