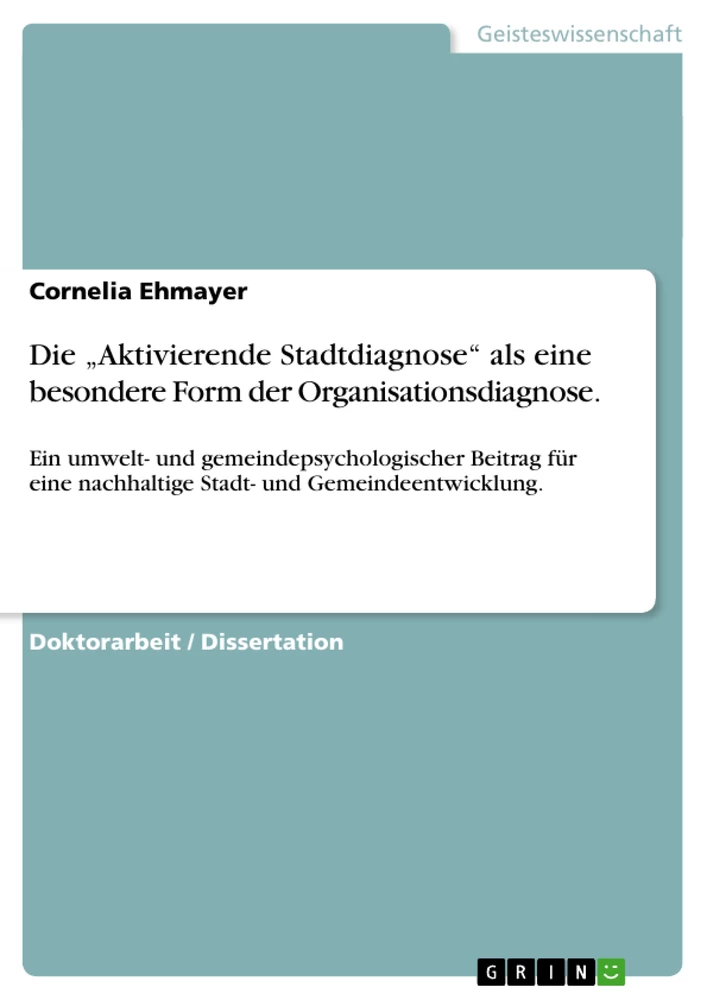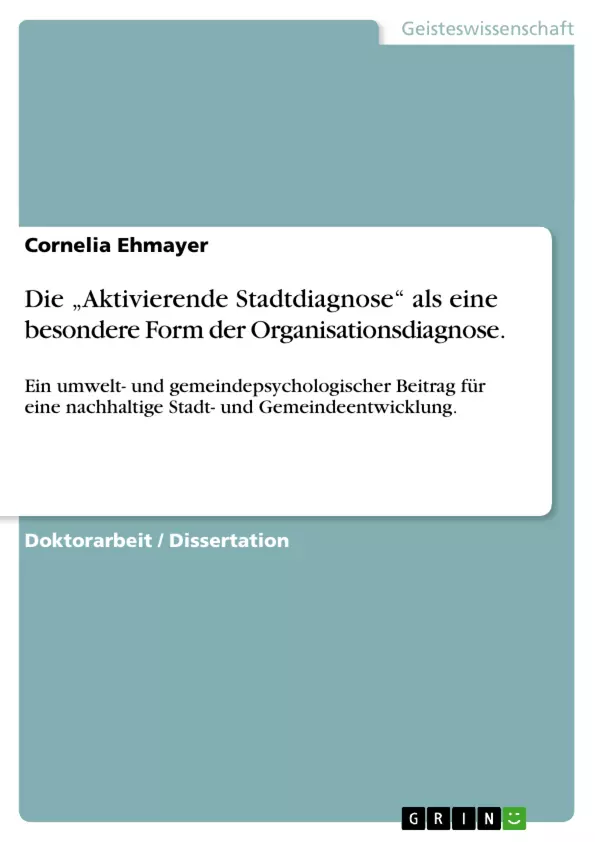Die Diagnostik kann als ein erfolgreiches Paradigma in der Psychologie, der Medizin und der Technologie angesehen werden. Der Bereich der Organisationsdiagnostik hat sich in den letzten Jahren nicht nur etabliert, sondern auch beständig weiterentwickelt. Was auf wissenschaftlicher Ebene fehlt, ist das Übertragen der Erkenntnisse der Organisationsdiagnostik auf das Feld der Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung. Wobei mit Gemeinde weder etwas Bauliches, noch die Bürokratie oder die Gebietskörperschaft als solche gemeint ist, sondern „das soziale Gemeinwesen“, also alle in einer Gemeinde wohnenden und arbeitenden Personen.
Mit dieser Arbeit wird das organisationsdiagnostische Verfahren „Aktivierende Stadtdiagnose“, das auf umwelt- und gemeindepsychologischen Konzepten und der Methodik qualitativer Sozialforschung beruht, theoretisch und empirisch belegt.
Im theoretischen Teil dieser Arbeit finden sich alle relevanten Theorien, Konzepte und Methoden, die der „Aktivierenden Stadtdiagnose“ zugrunde liegen. Dazu gehören Konzepte und Theorien der Umwelt-, Gesundheits- und Gemeindepsychologie ebenso wie neuere Erkenntnisse der Netzwerkforschung und vor allem der Organisationsdiagnostik. Die qualitative Sozialforschung mit ihren Konzepten und Methoden, mit einem Schwerpunkt auf der Grounded Theory und der Aktionsforschung, rundet den theoretischen Teil ab.
Im empirischen Teil wird die Methode „Aktivierende Stadtdiagnose“ in ihrem Ablauf detailliert vorgestellt. Da die „Aktivierende Stadtdiagnose“ als anwendungsorientierte Methode mit dem Anspruch entstanden ist, für nachhaltige Stadt- oder Gemeindeentwicklungsprozesse zu dienen, entwickelte sie sich in intensiver Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden in Österreich. Die unterschiedlichen Entwicklungsphasen sind von einem abwechselnden Rhythmus zwischen praktischer Anwendung und theoretischer Reflexion gekennzeichnet, wie es der Aktionsforschung eigen ist. Wesentliche Erkenntnisse, Veränderungen und Verbesserungen die sich aus den unterschiedlichen Entwicklungsphasen ergeben haben, werden im Anschluss an den empirischen Teil dargelegt.
Mit dieser Arbeit ist der Anspruch verbunden, dass die Methode "Aktivierende Stadtdiagnose" bei der Vorbereitung und Planung von zukunftsfähigen Prozessen in Städten und Gemeinden, vermehrt zur Anwendung kommt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Zielsetzung und Thesen
3 Theorien, Konzepte und Methoden
3.1 Diagnostik und Organisation
3.1.1 Definition und Herkunft
3.1.2 Psychologische Diagnostik
3.1.3 Organisationsdiagnostik
3.1.4 Organisationspsychologie
3.1.5 Organisationstheorien
3.1.6 Organisationsmethapern
3.1.7 Organisation
3.1.8 Lernende Organisation
3.1.9 Organisationsentwicklung & Organisationsberatung
3.2 Organisationsdiagnose
3.2.1 Diagnostizieren als theoriegeleiteter Prozess des Verstehens
3.2.2 Ziel und Zweck einer Organisationsdiagnose
3.2.3 Ablaufschritte einer Organisationsdiagnose
3.2.4 Methoden und Instrumente
3.2.5 Partizipation
3.2.6 Organisationales Commitment
3.2.7 Diagnostik – Gutachten
3.2.8 Qualitätssicherung
3.2.9 Exkurs: Qualitative Organisationsdiagnose nach Froschauer & Lueger (2009)
3.3 Nachhaltigkeit und Resilienz...
3.3.1 Definition...
3.3.2 Geschichte der Nachhaltigkeit
3.3.3 Lokale Agenda 21 und Wien
3.3.4 Resilienz
3.3.5 Resilienz und Nachhaltige Entwicklung
3.4 Nachhaltige Verhaltensänderung
3.4.1 Handlungsanreize
3.4.2 Intrinsische Motivation
3.4.3 Handeln als Ausgangspunkt für Verhaltensänderung
3.4.4 Motive und Lebensstile
4 Kurt Lewin als zentrale Figur zwischen Umweltpsychologie, Organisationsentwicklung und Aktionsforschung
4.1.1 Die Wechselwirkung zwischen Psychologie und Umwelt vor Lewin
4.1.2 Kurt Lewin‘s ganzheitliche Betrachtung menschlichen Verhaltens
4.1.3 Von Lewin über Barker zur Umweltpsychologie
4.2 Umwelt & Lebensraum
4.2.1 Umweltwahrnehmung und Umweltbewertung
4.2.2 Lebensraumbezogene Bedürfnisse
4.2.3 Raumbeanspruchung
4.2.4 Umweltaneignung
4.2.5 Identifikation mit der Umwelt
4.2.6 Ortsbindung
4.2.7 Ortsidentität
4.2.8 Gefallenseindruck
4.2.9 Nachbarschaft
4.3 Soziale Netzwerke und Gemeinwesen
4.3.1 Das Netzwerkkonzept in den Sozialwissenschaften
4.3.2 Historische Vorläufer des Netzwerkkonzepts
4.3.3 Netzwerkanalyse
4.3.4 Beziehungen und Verhalten in sozialen Netzwerken
4.3.5 Besonderheiten von sozialen Netzwerken
4.3.6 Soziale Netzwerke im Gemeinwesen
4.3.7 Das Netzwerkkonzept in der Gemeindepsychologie
4.4 Qualitative Sozialforschung
4.4.1 Geschichte
4.4.2 Theoretische Positionen
4.4.3 Die Grounded Theory
4.4.4 Verfahren und Methoden zur Datenerhebung
4.4.5 Partizipative Aktionsforschung
4.4.6 Organisationsentwicklung und Aktionsforschung
4.4.7 Gütekriterien qualitativer Forschung
5 Von der Organisationsdiagnose zur Stadtdiagnose
6 Beschreibung der „Aktivierenden Stadtdiagnose“
6.1 Auftragsvergabe
6.2 Datenerhebung in der Gemeinde
6.2.1 Auswahl der Stichprobe
6.2.2 Zeitlich-methodisches Ablaufschema
6.2.3 Methodeninventar
6.2.4 Checklisten und Datencheck
6.3 Datenverarbeitung und Datenanalyse
6.3.1 Transkription und Dokumentation der Daten
6.3.2 Kodieren der Daten und Bilden von Kategorien
6.3.3 Die Analyse des Ist-Zustandes
6.4 Diagnose der Zukunftspotenziale
6.4.1 Themenanalyse mit Zukunftspotenzialen
6.4.2 Kommunegramm mit Zukunftspotenzialen
6.4.3 Zukunftspotenziale als Fragen formuliert
6.4.4 Zukunftspotenziale mit Aktionsfeldern kombiniert
6.4.5 Ergänzende spezielle Gemeindethemen
6.5 Öffentliche Präsentation der Ergebnisse
6.5.1 Reflexionsgespräch mit dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin
6.5.2 Der Zukunftsworkshop
6.6 Erstellen des Gemeindebefunds
6.6.1 Obligatorische Inhalte
6.6.2 Optionale Inhalte
6.7 Übergabe des Befundes an den Gemeinderat
7 Entwicklungsphasen und Verbesserungen (Evaluierung)
7.1 Erste Entwicklungsphase: Aktionsforschung
7.2 Zweite Entwicklungsphase: Anwendung
7.3 Dritte Entwicklungsphase: Evaluierung
7.4 Status Quo
8 Diskussion
8.1 Bezugnahme zu den Thesen
8.2 Beurteilung der Methode “Aktivierende Stadtdiagnose” nach sozialwissenschaftlichen Qualitätsstandards
8.2.1 Anwendung von organisationsdiagnostischen Qualitätskriterien
8.2.2 Anwendung von Qualitätskriterien qualitativer Sozialforschung
8.3 Stärken, Mängel und Kritikpunkte der eigenen Arbeit
8.4 Wissenschaftlicher Mehrwert und weiterer Forschungsbedarf
9 Zusammenfassung
10 Literatur
11 Anhang
11.1 Originalinterviews Baumgarten
11.1.1 Experteninterview einzeln
11.1.2 Gruppeninterview mit Jugendlichen
11.1.3 Straßeninterview
11.2 Lebenslauf
1 Einleitung
Die Diagnostik kann als ein erfolgreiches Paradigma in der Psychologie, der Medizin und der Technologie angesehen werden. Der Bereich der Organisationsdiagnostik hat sich in den letzten Jahren nicht nur etabliert, sondern auch beständig weiterentwickelt. Was auf wissenschaftlicher Ebene fehlt, ist das Übertragen der Erkenntnisse der Organisationsdiagnostik auf das Feld der Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung. Wobei mit Gemeinde weder etwas Bauliches, noch die Bürokratie oder die Gebietskörperschaft als solches gemeint sind, sondern im Sinne der Gemeindepsychologie „das soziale Gemeinwesen“, also alle in einer Gemeinde wohnenden und arbeitenden Personen.
Die Organisationsdiagnose ist ein wissenschaftlich etabliertes, methodisch wirksames Vorgehen, mit dem Veränderungsprozesse vorbereitet und geplant werden können. Im Verständnis der Organisationsdiagnostik sollte keine Veränderungsmaßnahme ohne Diagnose erfolgen. Diagnostiziert werden vor allem Personen sowie institutionelle Abläufe und Strukturen. Für Organisationen als Gesamtheit werden nach wie vor kaum Diagnoseverfahren entwickelt. Ebenso gab es in der Entstehungszeit der „Aktivierenden Stadtdiagnose“ für Städte und Gemeinden keine geeignete organisationsdiagnostische Methode, mit der ein Veränderungsprozess vorbereitet und geplant werden konnte.
Die Entwicklung der "Aktivierenden Stadtdiagnose" begann 1998 im Forschungsschwerpunkt Kulturlandschaftsforschung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit dem Projekt „Kulturlandschaftsforschung und Agenda 21“. Als Ausgangsmethode diente die „Community Diagnosis – Profile Analysis“ der Gemeindepsychologin Donata Francescato (1996). Da das zu entwickelnde Diagnoseverfahren in einem beraterischen Kontext – für das Implementieren von Lokalen-Agenda-21-Prozessen in Städten und Gemeinden – angewendet werden sollte, war der Einsatz von qualitativen Methoden naheliegen. In der Organisationspsychologie gab und gibt es jedoch wenig Erfahrung mit qualitativen Zugängen, so dass auf bewährte Methoden der qualitativen Sozialforschung zurückgegriffen wurde. Diese haben sich von Anfang an bewährt und wurden im Laufe der Zeit weiterentwickelt und verfeinert.
Den theoretischen Hintergrund bildeten von Beginn an Konzepte und Methoden der jüngeren Umwelt- und Gemeindepsychologie ebenso wie Konzepte und Methoden der älteren Sozialpsychologie – insbesondere jene, die vom interdisziplinär arbeitenden und denkenden Theoretiker, Forscher und Praktiker Kurt Lewin ausgegangen sind. Die gesellschaftliche Anbindung erfolgte an das Konzept der nachhaltigen Entwicklung, wie sie in der Agenda 21 formuliert wurde.
Dass die Methode in der Praxis funktioniert hat sie in den letzten 15 Jahren bewiesen.
Zielsetzung dieser Arbeit ist nun, das organisationsdiagnostische Verfahren „Aktivierende Stadtdiagnose“, das auf umwelt- und gemeindepsychologischen Konzepten und der Methodik qualitativer Sozialforschung beruht, theoretisch und empirisch zu belegen.
Im theoretischen Teil dieser Arbeit finden sich alle relevanten Theorien, Konzepte und Methoden, die der „Aktivierenden Stadtdiagnose“ zugrunde liegen. Dazu gehören Konzepte und Theorien der Umwelt-, Gesundheits- und Gemeindepsychologie ebenso wie neuere Erkenntnisse der Netzwerkforschung und vor allem der Organisationsdiagnostik. Die qualitative Sozialforschung mit ihren Konzepten und Methoden, mit einem Schwerpunkt auf der Grounded Theory und der Aktionsforschung, rundet den theoretischen Teil ab.
Im empirischen Teil wird die Methode „Aktivierende Stadtdiagnose“ in ihrem Ablauf detailliert vorgestellt. Da die „Aktivierende Stadtdiagnose“ als anwendungsorientierte Methode mit dem Anspruch entstanden ist, für nachhaltige Stadt- oder Gemeindeentwicklungsprozesse zu dienen, entwickelte sie sich in intensiver Zusammenarbeit mit den Gemeinden. So sind die unterschiedlichen Entwicklungsphasen gekennzeichnet von einem abwechselnden Rhythmus zwischen praktischer Anwendung und theoretischer Reflexion, wie es der Aktionsforschung eigen ist. Wesentliche Erkenntnisse, Veränderungen und Verbesserungen die sich aus den unterschiedlichen Entwicklungsphasen ergeben haben, werden im Anschluss an den empirischen Teil dargelegt.
In der abschließenden Diskussion wird auf die eingangs formulierten Thesen eingegangen, werden Stärken und Schwächen der Methode besprochen; schließlich wird eine Beurteilung der Methode nach wissenschaftlichen Qualitätskriterien vorgenommen.
Mit dieser Arbeit verbinde ich die Hoffnung, dass die Methode "Aktivierende Stadtdiagnose" bei der Vorbereitung und Planung von zukunftsfähigen Prozessen in Städten und Gemeinden, vermehrt zur Anwendung kommt.
2 Zielsetzung und Thesen
Zielsetzung dieser Arbeit ist, das organisationsdiagnostische Verfahren „Aktivierende Stadtdiagnose“, das auf umwelt- und gemeindepsychologischen Konzepten und der Methodik qualitativer Sozialforschung beruht, theoretisch und empirisch zu belegen.
Die Methode „Aktivierende Stadtdiagnose“ wurde entwickelt, weil entsprechende Verfahren fehlten, mit denen sich Gemeinden und Städte als Gesamtorganisationen diagnostizieren lassen. Die Diagnose sollte dazu dienen, eine nachhaltige Entwicklung, wie sie in der UN-Agenda 21 für Kommunen empfohlen wird, für einen Wiener Gemeindebezirk vorzubereiten und zu planen. Eine wesentliche Aufgabe war, möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Prozess einzubinden. Zusätzlich mangelte es an geeigneten Instrumenten, mit denen das im Bezirk vorhandene, aber nicht sichtbare, Netzwerk an Beziehungen erhoben und dargestellt werden konnte.
Der Entwicklung der Methode lagen folgende Thesen zugrunde:
These 1: Es gibt einen Mangel an qualitativer Organisationsdiagnostik von Gesamtorganisationen (ganzheitliche Diagnostik).
These 2: Es gibt einen Mangel an qualitativen Diagnoseverfahren, die für eine nachhaltige Stadt- und Gemeindeentwicklung herangezogen werden können.
These 3: Es gibt einen Mangel an nachvollziehbaren qualitativen methodischen Vorgehensweisen für urbane Einheiten mit Gemeindegrößen bis zu 50.000 Personen.
These 4: Es gibt einen Mangel an Methoden, die das kommunale Beziehungsnetzwerk sichtbar machen können. Theorien, Konzepte und Methoden
Der theoretische Teil behandelt jene Theorien, Konzepte und Methoden, die der „Aktivierenden Stadtdiagnose“ zugrunde liegen.
3.1 Diagnostik und Organisation
In diesem Kapitel wird eine Verbindung zwischen psychologischer Diagnostik und Organisation hergestellt. Mit der Diagnose von Organisationen beschäftigt sich die Organisationsdiagnostik, welche Organisationen als lernfähige, soziale Gebilde versteht, die als solche auch diagnostiziert werden können.
Es zeigt sich, dass Organisationen als Gesamtheit bislang kaum im Zentrum wissenschaftlicher und organisationspsychologischer Betrachtungen stehen und Ansätze zur Diagnostik von Gesamtorganisationen nach wie vor defizitär sind. Bei den Diagnosemethoden wird ein Mangel an qualitativen Verfahren erkennbar, die sich nach wissenschaftlichen Qualitätsstandards beurteilen lassen.
3.1.1 Definition und Herkunft
Diagnostik wird als Erkenntnisgewinn, um Handeln zu optimieren beschrieben (Hossiep & Wottawa, 1993). Zugleich wird unter Diagnostik eine Methodenlehre ohne Erkenntnisgewinn (Krohne & Hock, 2007) verstanden. Der pragmatische Zugang bezeichnet damit einfach das Durchführen einer Diagnose (Fisseni, 1997).
Die historischen Wurzeln der Diagnostik gehen bis nach China, in die Zeit 300 v. Chr. zurück. Für die Aufnahme in den öffentlichen Dienst wie auch für regelmäßige Leistungskontrollen wurde ein Testprogramm entwickelt, dessen Vorläufer jedoch vor etwa 3000 bis 4000 Jahren entwickelt wurden. Dieses wurde im Laufe der Jahrhunderte modifiziert aber es blieb in China jedoch in seiner Grundstruktur bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts in Gebrauch. Das chinesische Testsystem wurde von den Engländern für die Auswahl von Mitarbeitern für die East India Company übernommen, modifiziert, ins Heimatland gebracht und führte 1855 zur Einführung eines „kompetitiven Prüfungssystems für den öffentlichen Dienst in Großbritannien“ (Krohne & Hock, 2007, S. 11).
Am Anfang der Entwicklung der modernen Diagnostik stand das Bemühen um die generelle Messung psychischer Merkmale. Es wurde also nicht nach interindividuellen Unterschieden gesucht, sondern nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten. Als zentral gilt das Werk Fechners „Elemente der Psychophysik“ aus dem Jahre 1860. Die Erforschung von systematischen Unterschieden zwischen Menschen beginnt mit den Arbeiten Francis Galtons (1822–1922) in seinem anthropometrischen Laboratorium. Galton, der ein Verwandter Darwins war, war von der Evolutionstheorie stark beeinflusst und interessierte sich in diesem Zusammenhang besonders für das Erfassen der menschlichen Fähigkeiten (Krohne & Hock, 2007; Lück ,1991; DuBois, 1970).
Das Wort Diagnostik geht nach Fisseni (1997) auf das griechische Verb „diagignoskein“ zurück, welches unterschiedliche Aspekte eines kognitiven Vorgangs vom Erkennen bis zum Beschließen, bezeichnet. Die Begriffe Diagnose und Diagnostik im Laufe der Geschichte eine Veränderung erfahren und bezeichnen nun etwas im medizinischen Sinne die Lehre und die Fertigkeit „Krankheiten zu erkennen und sie Ursachen oder Ursachensyndromen zuzuordnen“ (S. 3).
Für Bornewasser (2009) stellt die Diagnostik ein „sehr erfolgreiches Paradigma der wissenschaftlichen Forschung im Bereich von Medizin und Psychologie dar. Dabei geht es vornehmlich darum, die einzusetzenden Messinstrumente für die individuelle Diagnostik zu verfeinern und dadurch Sensitivität, Spezifität und Prädiktivität zu verbessern“ (S. 74). Das Besondere an der Diagnostik ist nach Bornewasser die Erkenntnis von unter einer undurchsichtigen Oberfläche gegebenen Zuständen. Nach Hossiep & Wottawa (1993) ist Diagnostik Erkenntnisgewinnung mit dem Ziel, Handeln zu optimieren.
Der Einsatz diagnostischer Verfahren hat in der Psychologie Tradition, wobei es lange Zeit um die Beurteilung individueller Merkmale und um die Beantwortung der Frage ging, wie und in welchem Ausmaß sich ein Mensch von anderen unterscheidet. Mittlerweile ist die Diagnose von Gruppen, sozialen Systemen und Situationen eine wichtige Aufgabe der Diagnostik geworden (Krohne & Hock, 2007).
3.1.2 Psychologische Diagnostik
Mit psychologischer Diagnostik, auch Psychodiagnostik genannt, wird nach Pawlik (2006) ein vornehmlich anwendungsbezogenes Methodenfach bezeichnet, das interindividuelle und intraindividuelle Unterschiede im Verhalten und Erleben erfasst –mit dem Ziel, möglichst präzise Vorhersagen künftigen Verhaltens und Erlebens zu treffen.
Fisseni (1997) definiert die psychologische Diagnostik als das „systematische Sammeln und Aufbereiten von Informationen mit dem Ziel, Entscheidungen und daraus resultierende Handlungen zu begründen, zu kontrollieren und zu optimieren“ (S. 4). Für ihn bedeutet Diagnostik in der Psychologie „die Lehre von den Methoden und Verfahren der sachgemäßen Durchführung einer Diagnose“ (S. 4). Es werden dabei relevante Charakteristika von Merkmalsträgern, das sind Einzelpersonen genauso wie Institutionen, zu einem Urteil integriert. Dieses Urteil soll dazu beitragen, praktische Probleme zu lösen.
Nach Hossiep & Wottawa (1993) wird von psychologischer Diagnostik gesprochen, wenn „für die diagnostische Informationsgewinnung Methoden eingesetzt werden, die dem Bereich der wissenschaftlichen Psychologie zuzuordnen sind“ (S. 131). Die psychologische Diagnostik liefert Entscheidungshilfen, die dazu beitragen sollen, eine möglichst optimale Verbesserung einer Situation zu erreichen. Hossiep & Wottawa sehen die psychologische Diagnostik nicht als eine eigenständige wissenschaftliche Disziplin, sondern eher als eine Technologie. Wichtig ist demnach die Unterscheidung zwischen „wissenschaftlicher Teildisziplin“ und „Methodologie“ hinsichtlich der Bewertungskriterien. Wird die Diagnostik als Wissenschaft betrachtet, werden ihre Aussagen im Hinblick auf Erkenntnisgewinn und „Wahrheit“ bewertet; ist sie eine Technologie, dann ist das entscheidende Bewertungskriterium „die Brauchbarkeit, also der Nutzen, der mit der jeweiligen Aussage bzw. dem angewandten Instrument der psychologischen Diagnostik erzielt werden kann“ (S. 133). Der Nutzenaspekt wäre in diesem Fall zu erheben. Generell ist die Diagnostik in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, technischen Möglichkeiten, wirtschaftlichen Aspekten und Werthaltungen zu betrachten.
Für (Krohne & Hock, 2007) ist die psychologische Diagnostik eine Methodenlehre innerhalb der Psychologie und stellt primär ein System von Verfahrensweisen im Dienste der Angewandten Psychologie dar. Es geht um das Erfüllen eines praktischen Auftrags. Diagnostizieren ist kein Erkenntnisvorgang, sondern ein „Handlungs- und Entscheidungsprozess“ (vgl. S. 1).
Gemeinsam ist allen diesen Ansätzen, dass sie die Aufgabenstellung der Diagnostik bei der Optimierung von praktischen Problemlösungen sehen.
3.1.3 Organisationsdiagnostik
Die Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen Organisationsdiagnostik und Organisationsdiagnose ist in der Literatur nicht immer ganz eindeutig zu erkennen. Tendenziell lässt sich unter Organisationsdiagnostik die systematische Herangehensweise, also der Einsatz bestimmter Methoden in einer speziellen Abfolge verstehen. Die Diagnose ist das Ergebnis der jeweiligen gewählten Herangehensweise. Beiden, sowohl Organisationsdiagnostik als auch Organisationsdiagnose, kann jedoch ein prozessualer Charakter innewohnen (Borg, 2003; Froschauer & Lueger, 2009; Rotering-Steinberg, 1993; Waclawski & Church, 2002).
Lange Zeit stand die Einzelperson und ihr Verhältnis zur jeweiligen Organisation im Zentrum organisationsdiagnostischer Betrachtungen. Erst in den letzten 20 Jahren, seit Beginn der 1990er Jahre, ist eine deutliche Erweiterung der organisationspsychologischen Diagnostik zu beachten. Wobei nach Krohne & Hock (2007) die Ansätze zur Diagnostik bei Gruppen und Gesamtorganisationen nach wie vor defizitär sind. Dies hängt mit dem subjektiven Zugang bei der Erhebung entsprechender Daten zusammen. Es gibt, so scheint es, nach wie vor zu wenig Erfahrung mit qualitativen Zugängen, die für das Erheben von subjektiven Daten geeignet sind, was wiederum eine zu starke Konzentration auf quantitative Erhebungsmethoden, vor allem im Forschungskontext, zur Folge hat (Bornewasser, 2009; Felfe & Liepmann, 2008).
Die Bandbreite der Organisationsdiagnostik liegt zwischen einer Vorgehensweise mit dem Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und dem Ziel Informationen zu gewinnen, um Organisationen effektiv beraten zu können. Kleinmann & Wallmichrath (2004) verstehen die Organisationsdiagnostik als ein Kontinuum von Ansätzen, die in einem Extrem strikt forschungs- und im anderen Extrem strikt anwendungsorientiert sind. In diesem Zusammenhang sei auf Kurt Lewin (siehe dazu auch Kapitel „ Kurt Lewin als zentrale Figur zwischen Umweltpsychologie, Organisationsentwicklung und Aktionsforschung“) verwiesen, der es mit seinem Ansatz der Action Research – einer Kombination aus wissenschaftlicher und praktischer Tätigkeit – geschafft hat, die beiden Extreme miteinander zu verbinden. Wie bereits erwähnt, war er für die Umweltpsychologie ebenso wie für die Organisationsentwicklung von großer Bedeutung, da von ihm spezielle Methoden für die Diagnose von Organisationen, wie die Survey-Feedback-Methode entwickelt wurden. (Rosenstiel, Molt & Rüttinger, 2005)
Während über die Bandbreite der Organisationsdiagnostik gewisse Unsicherheiten bestehen und die Trennschärfe zwischen Diagnose und Diagnostik nicht immer gegeben ist, besteht nach Felfe & Liepmann (2008) weitgehende Einigkeit darin, Organisationsdiagnostik als einen zielgerichteten Prozess zu definieren. Dieser Prozess ist durch mehrere Abschnitte gekennzeichnet, bei dem relevante Merkmale und Prozesse der Organisation, die für ihr Funktionieren und ihre Effektivität von Bedeutung sind, abgebildet werden. Lawler, Nadler und Camman (1980) weisen darauf hin, „dass eine effektive Organisation erst dann aufgebaut werden kann, wenn man versteht, wie die Organisation funktioniert“ (zit. nach Felfe & Liepmann, 2008, S. 13). Damit ist Organisationsdiagnostik jene Herangehensweise, die durch einen ausgewählten Zugang und dem Einsatz bestimmter Methoden, das Verstehen einer Organisation ermöglichen soll.
Die psychologische Organisationsdiagnostik beschäftigt sich weniger mit der Organisation als Gesamtes, sondern vor allem mit dem Erleben und Verhalten der Organisationsmitglieder (vgl. Felfe & Liepmann, 2008, S. 13). Sie wird also gewöhnlich auf Personen angewandt, kann aber auch „auf institutionelle Abläufe wie die Personalauswahl und sogar auf Aspekte der Organisationsstruktur (etwa auf die Führungssituation, das Informationsmanagement) bezogen werden. In diesem Sinne lassen sich individuelle und institutionelle Diagnostik unterscheiden“ (Amelang & Schmidt-Atzert, 2006, S. 74).
Nach Schuler (1993) gibt es wenig Ansätze mit dem Zugang eine Organisation als Gesamtes zu betrachten, über die eine Diagnose erstellt werden kann:
Unter allen Objekten der Organisationspsychologie dürfte jenes, das sie als Bestimmungswort kennzeichnet, die Organisation, am allerwenigsten von ihr behandelt worden sein. Das mag darin liegen, das dieses ominöse Konstrukt Organisation, das gleichzeitig Ursache wie Ergebnis menschlichen Handelns ist, diesem – oder den Denkschemata der Psychologen – ferner steht als alles übrige; auch die Unbestimmtheit des wissenschaftlichen Terrains mag dazu beitragen, dass sich Psychologen fremd fühlen unter den Politologen und Ökonomen, Betriebswirten und Soziologen, die sich ansonsten mit Organisationen beschäftigen. Dabei wird kaum in Frage gestellt, dass es sich hier um ein Gebiet handelt, auf dem es für Psychologen viel zu tun gibt, und dass sich hier beste Gelegenheit böte, der so gern akklamierten Interdisziplinarität zu ihrem Recht zu verhelfen. (S. 46)
Bornewasser (2009) kritisiert weiters, dass das Zentrieren der Psychologie auf Personenmerkmale dazu geführt hat, dass die Organisationsdiagnostik, im Gegensatz zur medizinischen und zur Psychodiagnostik, an einem Mangel an hochwertigen Testverfahren leidet. Daher können an die Organisationsdiagnostik nicht die gleichen Objektivitätsansprüche gestellt werden, wie an die individuell ausgerichtet Psychodiagnostik. Amelang & Schmidt-Atzert (2006) sowie Kieser (2006) kommen, ähnlich wie Bornewasser, zu dem Ergebnis, dass es kaum genormte Verfahrensweisen gibt und den Messinstrumenten daher keine Reliabilität und Validität zugesprochen werden kann (vgl. Amelang & Schmidt-Atzert, 2006, S. 79).
3.1.4 Organisationspsychologie
Die Organisationspsychologie wird als die Wissenschaft vom Erleben, Verhalten und Handeln des Menschen in Organisationen definiert (Rosenstiel, 2007). Sie befasst sich mit dem tätigkeitsbezogenen Erleben und Verhalten von Menschen in Organisationen – genauer gesagt damit, „das Verhalten zu beobachten, zu beschreiben und zu erklären, in Entscheidungszusammenhängen zu prognostizieren und durch gezielte Intervention zu verändern“ (Schuler, 1993, S. 42). Die Organisation als Gesamtes wird bei diesen Definitionen nicht als Gegenstand bzw. Arbeitsfeld der Organisationspsychologie erwähnt. Somit bestätigt sich auch die bereits mehrfach erhobene Kritik, dass sich die wissenschaftliche Psychologie zu sehr auf das Verhalten von Menschen und zu wenig auf Verhalten von Organisationen konzentriert (Bornewasser, 2009; Schuler, 1993).
Rosenstiel (2007) kennzeichnet die Arbeit von Organisationspsychologen, die große Ähnlichkeiten mit der Arbeit von Organisationsdiagnostikern oder Organisationsberatern aufweist, wie folgt:
- Es bedarf einer begründeten Theorie.
- Auf Grundlage dieser Theorie wird der Ist-Zustand erfasst, also „diagnostiziert“.
- Es gibt keine wertfreien Standpunkte, sondern man muss Stellung beziehen, um die Ziele (Sollwerte) für die Arbeit zu gewinnen.
- Abweichungen des diagnostizierten Ist-Zustands vom Soll-Zustand sind zum Anlass zu nehmen um zu therapieren bzw. zu intervenieren.
- Um wissenschaftlich begründet intervenieren zu können, also Interventionen verantworten zu können, muss Veränderungswissen erarbeitet werden.
- Um die Intervention zu überprüfen, sollte der Organisationspsychologe seine Interventionen evaluieren, was zugleich eine Intervention an Hand von expliziten bzw. impliziten Thesen ist. (vgl. S. 18ff.)
3.1.5 Organisationstheorien
„Welche Merkmale einer Organisation im Rahmen der Organisationsdiagnose erfasst und analysiert werden, hängt wesentlich von den Organisationstheorien ab, vor deren Hintergrund die Diagnose erfolgt“ (Felfe & Liepmann, 2008, S. 15).
In der wissenschaftlichen Literatur werden verschiedenste Organisationstheorien, basierend auf ihrer Herkunft, genannt. Bei organisationspsychologischen Theorien unterscheiden Holling & Kanning (2007) in:
(a) Historische Theorien (Taylorismus, Bürokratische Organisation nach Max Weber, Humanistische Theorie von Mc Gregor und partizipative Theorie von Likert),
(b) Lerntheorien (Operantes Konditionieren und Lernen am Modell, Lernende Organisation),
(c) Motivationstheorien (Bedürfnishierarchie nach Maslow, Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg, Mausner und Snyderman, VIE-Theorie von Vroom, Motivationstheorie von Porter & Lawler, Systemtheorie von Katz und Kahn),
(d) Führungstheorien, Handlungstheorie, Entscheidungstheorien (Normativ & Deskriptiv) und
(e) den Konstruktivismus. (S. 59ff.)
Ähnliche Einteilungen nehmen auch Kieser (2001), sowie Sanders & Kianty (2006) vor.
Insgesamt gibt es mehr als 100 Theorien, aber keine Supertheorie (Bornewasser, 2009; Holling & Kanning, 2007). Allerdings identifiziert BjØnness (2007) zwei dominierende Paradigmen in der Organisationsforschung: den Positivismus und den Konstruktivismus. Eine Organisation wird entweder als realistische Entität, die direkt analysiert werden kann, gesehen oder als Projektion menschlicher Vorstellung, die über die Analyse sprachlicher Prozesse des Behauptens und Kritisierens nur indirekt vermittelt werden kann.
Trotz der Vielfalt an vorhandenen Theorien bleibt die Kritik, dass es Organisationstheorien oft an wissenschaftlicher Genauigkeit mangelt, also auch ihr praktischer Nutzen gering ist. Begründet wird dies u.a. damit, dass der Geltungsbereich von Organisationstheorien wesentlich komplexer ist, als der vieler anderer psychologischer Theorien. Aber auch der Gegenstand der Organisation erlaubt nicht die gleichen Versuchsbedingungen, die sich beispielsweise in einem psychologischen Testlabor finden lassen, wodurch ein Mangel an Generalisierbarkeit der Ergebnisse schon von vornherein determiniert ist. Bei einem weiter gesetzten Verständnis von Organisationsdiagnostik, welches eine Integration verschiedenster Fachdisziplinen erfordert, steht kein in sich geschlossener theoretischer Rahmen zur Verfügung. Basierend auf diesen Tatsachen lässt sich die Frage aufwerfen, ob die vorhandenen theoretischen Grundlagen eine tragfähige Basis für eine wissenschaftlich fundierte Organisationsdiagnostik und Interventionen abgeben können. (Bornewasser, 2009; Felfe & Liepmann, 2008; Holling & Kanning, 2007; Krohne & Hock, 2007; Rosenstiel, 2007)
3.1.6 Organisationsmethapern
Der Versuch Organisationen als Ganzes zu verstehen, zeigt sich an den verschiedensten Organisationsmethapern, die von der Organisationsforschung verwendet werden. Ziel dieser Metaphern ist es, die zugrunde liegenden Forschungsperspektiven anschaulicher zu gestalten. „Organisationsmetaphern haben u.a. den Vorteil, dass sie gut zu kommunizieren sind und speziell im Fall von Beratungstätigkeit einen gemeinsamen Hintergrund für die beteiligten Akteure schaffen können“ (Felfe & Liepmann, 2008, S. 16).
Die wesentlichsten Organisationsmetaphern nach Scholl (2007) und Felfe & Liepmann (2008) sind:
(a) Die Ausbeutungsmetapher (Ressourcenverteilung, Gerechtigkeit, Macht),
(b) die Maschinenmetapher (Funktionalität und Effizienz),
(c) die Bedürfnismetapher (Motive, Zufriedenheit),
(d) die Problemlösemetapher (Entscheidungen),
(e) die Politikmetapher (Macht, Einfluss, Führung),
(f) die Organismusmetapher (Regelkreise und Autonomie),
(g) die Kulturmetapher (ungeschriebene Regeln und Gesetze),
(h) die Kostenmetapher (Investitionen, Kosten) und
(i) die Netzwerkmetapher (Strukturen, Kommunikationswege).
Erwähnenswert ist, dass Scholl (2007) seiner Metaphernbeschreibung ein Kapitel mit dem Titel „die Organisation als Akteur“ (S. 515f) voranstellt, wobei er dieses Verständnis nicht als Metapher bezeichnet, sondern als Faktum ansieht. Er begründet dies damit, dass Organisationen soziale Systeme sind, die Ziele verfolgen können und damit zu kollektivem Handeln fähig sind. Eine diesbezügliche Legitimation leitet er daraus ab, dass Organisationen im juristischen Sinne eigene Rechtspersönlichkeiten sind, die Verträge mit Individuen, anderen Organisationen und Staaten abschließen können. Dies macht sie im organisationspsychologischen Sinne zu korporativen Akteuren.
Das Bild von der Organisation als Akteur oder im psychologischen Sinne auch als Person oder Wesen, taucht im Zusammenhang mit Organisationsdiagnostik und Organisationsentwicklung immer wieder auf und es scheint gerade dort, wo es um die Diagnostik einer Organisation als Ganzheit und nicht als einzelner Teil innerhalb einer Organisation geht, ein hilfreiches Konstrukt zu sein.
3.1.7 Organisation
Nach Scholl (2007) ist es schwierig zu definieren was eine Organisation ist, weil mit diesem Begriff eine große formale Organisation genauso gemeint werden kann, wie der kleine Bioladen um die Ecke. Mit Organisation sind daher nicht nur Produktions- und Dienstleistungsbetriebe gemeint, sondern auch Behörden, Schulen, Vereine, etc. Er definiert eine Organisation als „[...] ein soziales Gebilde, das bestimmte Ziele verfolgt und formale Regelungen aufweist [...]“ (S. 516). Die Existenz formaler Regelungen unterscheidet Organisationen von informellen Gruppen. Bedingungen für die Zugehörigkeit einer Organisation sind vertragliche Regelungen, die nicht alle Lebensbereiche, sondern eine eng umgrenzte Leistungsanforderung erfassen. Familie und Staat sind aus seiner Sicht keine Organisationen.
Mit dieser Definition gehen auch Felfe & Liepmann (2008) konform, wobei sie der Organisation nicht nur Regeln, sondern auch eine regelbestimmende formale Struktur zuweisen. „Diese Struktur wiederum ist durch ein System von Regeln, welches die arbeitsteiligen Beziehungen zwischen Mitgliedern der Organisation festlegt und die Aktivitäten auf die Erreichung des verfolgten Zieles ausrichtet, gekennzeichnet“ (S. 13). Sie schlagen nach Kieser & Kubicek (1992) eine Definition vor, die sich als Ausgangspunkt für eine Organisationsdiagnose gut eignet: „Organisationen sind soziale Gebilde, die dauerhaft ein Ziel verfolgen, eine formale Struktur aufweisen, mit deren Hilfe die Aktivitäten der Mitglieder auf das verfolgte Ziel ausgerichtet werden“ (S. 16).
Rosenstiel (2007) sieht eine Organisation als ein „gegenüber ihrer Umwelt offenes System, das zeitlich überdauernd existiert, spezifische Ziele verfolgt, sich aus Individuen bzw. Gruppen zusammensetzt und eine bestimmte Struktur aufweist“ (S. 6). Bornewasser (2009) erweitert diesen Zugang, indem er Organisationen nicht nur einen zeitlichen, sondern auch einen räumlichen Charakter zuspricht. Mehr noch, Organisationen müssen konkrete Dinge sein (Firmenname, Gründungsurkunde), die Bestand haben, auch wenn Menschen ausgetauscht und Gebäude verändert werden. Sie zeichnen sich durch Konstanz im Wandel aus und behalten ihre Identität auch, wenn es im Verlauf der Zeit zu Veränderungen kommt. „Die Organisation ist vorgegeben und wird zunächst immer bestrebt sein, sich zu erhalten, Spannungen und Störungen der internen Ordnung auszuhalten und sich schließlich der externen Umwelt anzupassen. Diese interne Ordnung bildet den Kern einer jeden Organisation, den es zu schützen und zu erhalten gilt“ (Bornewasser, 2009, S. 42).
3.1.8 Lernende Organisation
Das Modell der lernenden Organisation geht vom ganzheitlichen Organisationsbegriff aus und versteht die Organisation als soziales Gefüge, das lernfähig ist. Der ganzheitliche Organisationsbegriff beinhaltet den gestaltpsychologischen Zugang der Übersummativität (siehe dazu auch Kapitel: „Die Wechselwirkung zwischen Psychologie und Umwelt vor Lewin“) aus dem sich ableiten lässt, dass eine Organisation als Gesamtes mehr ist als jede einzelne Person oder jede einzelne Abteilung für sich genommen. Von lernenden Individuen kann damit nicht automatisch auf eine lernende Organisation geschlossen werden, ebenso wenig wie von einem produktiven Mitarbeiter nicht auf eine produktive Organisation. Nach Bornewasser (2009) lassen sich Ganzheiten „ [...] nicht direkt, sondern nur über Attribute oder Eigenschaften erfassen. Sie werden als sogenannte holistische Merkmale gekennzeichnet. So lassen sich einer Organisation etwa die Attribute Struktur, Größe, Alter, Dichte oder Anpassungsfähigkeit zuschreiben.“ (S. 21).
Bei der lernenden Organisation wird der Wandel zum Normalfall, da Veränderung Teil der Organisation und der Systemprozesse ist. Es lässt sich eine indirekte Steuerung des Wandels beobachten, und Wandel muss als generelle Kompetenz der Organisation verstanden werden. Organisationen als offene Systeme in einer sich permanent ändernden Umwelt stehen stets vor der Aufgabe, äußere und innere Verhältnisse gegeneinander abzuwägen und zu entscheiden, ob externe Variationen dauerhafte Veränderungen signalisieren oder aber nur vorübergehende Erscheinungen darstellen (vgl. Bornewasser, 2009 S. 158; Felfe & Liepmann, 2008, S. 28).
Der Resilienzbegriff (siehe dazu auch Kapitel „Nachhaltige Verhaltensänderung“) legt nahe, dass Resilienz ein Merkmal von lernenden Systemen ist. Ein resilientes System wie eine Organisation, muss sich selbst unaufhörlich auf die Probe stellen, wenn es sich möglichst rasch an veränderte Umweltbedingungen anpassen will. Lernen und Innovation werden damit zu notwendigen Bedingungen der Kontinuität. (vgl. Lukesch et al.., 2010, S. 14)
Das Modell der lernenden Organisation bildet die theoretische Legitimierung für Veränderungsprozesse in Organisationen, wie sie von Organisationsberatern und Organisationsentwicklern initiiert und begleitet werden. Die Diagnose als erster Schritt spielt dabei eine entscheidende Rolle.
3.1.9 Organisationsentwicklung & Organisationsberatung
Nach Ed Schein (1990), einem der bekanntesten Mitbegründer des Feldes, ist Organisationsberatung sowohl eine Wissenschaft als auch eine Technologie; über allem steht für ihn jedoch, dass es sich um eine Philosophie handelt. Der philosophische Zugang dabei ist, einen effektiven Zugang zum Verständnis von Menschen in komplexen Systemen zu erhalten und Wege zu zeigen, wie sich Organisationen zum Wohle der Mitarbeiter und dadurch auch zum eigenen Nutzen verändern können. Organisationsentwicklung wird auf ein ganzes System angewendet und hat die Gesamtorganisation im Fokus (Fatzer, 2004, S. 2). Da Organisationsentwicklung oft mit Organisationsberatung gleichgesetzt wird (vgl. Fatzer, 2004; Rotering-Steinberg, 1993), soll an dieser Stelle ebenfalls keine wesentliche Unterscheidung getroffen werden .
Nach Rotering-Steinberg (1993) handelt es sich bei Organisationsentwicklung „um einen geplanten, gelenkten, systematischen Prozess, der zur Veränderung der Kultur, der Systeme und der Verhaltensweisen in der Organisation beitragen soll mit dem Auftrag, die Effektivität der Organisation bei der Lösung ihrer Probleme und dem Erreichen ihrer Ziele zu verbessern“ (S. 483).
Fatzer (2004) konkretisiert Organisationsentwicklung (OE):
- OE wird auf ein ganzes System angewendet,
- OE basiert auf Konzepten der angewandten Sozialwissenschaften, insbesondere der Aktionsforschung nach Kurt Lewin,
- OE ist mit geplantem Wandel beschäftigt, hat aber keine fixen Vorstellungen über Abläufe, wobei zur Unterstützung Phasenmodelle herangezogen werden,
- OE umfasst sowohl Planen als auch Umsetzen des Wandels,
- OE zielt auf die Verbesserung der Organisationseffizienz ab, wobei davon ausgegangen wird, dass eine lernfähige Organisation imstande ist, ihre eigenen Probleme zu lösen. (vgl. S. 2f)
Historisch gilt Kurt Lewin als der eigentliche Begründer der Organisationsentwicklung, der mit seinen Aktionsforschungs-Experimenten die Grundprinzipien von Gruppen und Organisationen beschrieb. Die ersten Organisationsentwicklungs-Experimente basierten auf Aktionsforschung, die damit ebenso die wissenschaftlich-historische Basis der Organisationsentwicklung darstellt. Das zyklische Vorgehen der Organisationsentwicklung findet sich auch in dieser Form der Forschung wieder hier im Wechsel zwischen Forschung, Praxis und Reflexion. Die ersten diesbezüglichen, berühmt gewordenen Experimente, sind die Hawthorne-Studien von Mayo (1950), die in den 1930er Jahren soziale Beziehungen, sowohl unter Mitarbeitern als auch zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten, als relevante Faktoren zum Erbringen von Unternehmensleistung propagierten. Basierend auf diesen Hawthorne-Studien entstand die Human-Relations-Bewegung, die zu einer zentralen Bewegung in der Organisationsentwicklung wurde.
Der komplexe Prozess der Organisationsentwicklung verläuft in der Praxis generell so, dass zuerst die Situation diagnostiziert wird, daraus Thesen abgeleitet und erst anschließend Prozesse des Wandels initiiert werden. Damit wird dem Instrument der Diagnose ein zentrale Rolle zugesprochen, denn auf ihren Ergebnissen bauen alle weiteren Maßnahmen auf (Bornewasser, 2009).
3.2 Organisationsdiagnose
Dieses Kapitel setzt sich vertiefend mit Organisationsdiagnosen und dem Diagnostizieren als theoriegeleiteten Prozess des Verstehens auseinander. Ziel und Zweck von Organisationsdiagnosen, Ablaufschritte, Methoden und Gutachtenerstellung werden detailliert beschrieben. Auf die zentrale Rolle der Einbindung der Betroffenen durch Beteiligung und die positiven Aspekte von Vollerhebungen wird näher eingegangen. Die qualitative Organisationsdiagnose als eine wissenschaftlich etablierte Vorgehensweise wird am Ende dieses Kapitels vorgestellt.
3.2.1 Diagnostizieren als theoriegeleiteter Prozess des Verstehens
In Betrieben, Unternehmen oder Organisationen ist beinahe jede Maßnahme auf irgendeine Form von Diagnose begründet, welche die Maßnahme legitimiert und damit Qualität, Ausmaß und Richtung bestimmt. Diagnose setzt Theorie voraus und diese regelt und bestimmt, was als Symptom, als Ursache oder Zusammenhang gilt. Die Theorie konstituiert den Gegenstand und regelt die daran ansetzenden Verfahren zur Veränderung (Bornewasser, 2009; Felfe & Liepmann, 2008).
Das Erstellen einer Diagnose ist ein Prozess des Verstehens, wie die Organisation in ihrem Ablauf und ihren Aufgaben und Prozessen funktioniert. Die Aufgabe im diagnostischen Prozess besteht in der zuverlässigen Erfassung der Symptomatik (der Ist-Soll-Diskrepanz), die anschließend in einem Zusammenhang gebracht wird. Forschung und praktische Arbeit unterscheiden sich danach, ob es schwerpunktmäßig auf das Erfassen des Ist-Zustandes (Diagnose) oder um die Veränderung in Richtung Soll-Zustand (Intervention) geht (Cummings & Worley, 2009; Rosenstiel, 2007).
Bei der Erstellung der Diagnose werden, ähnlich wie bei einem wissenschaftlichen Vorgehen, Arbeitsdiagnosen gebildet, die vielfältig kritisch geprüft und abschließend zu einer Diagnose zusammengefügt werden. Wobei der Diagnoseprozess, anders als bei einem technischen oder auch einem somatischen System, einen Eingriff darstellt „auf den sich das untersuchte soziale System einstellt und an dem es sogar aktiv mitwirkt“ (Amelang & Schmidt-Atzert, 2006 S. 79). Nach Cummings & Worley (2009) ist das Erstellen einer Organisationsdiagnose viel kollaborativer als es die medizinische Perspektive impliziert und beinhaltet auch nicht die Annahme, dass die Organisation krank sei.
Eine Diagnose ist also eine theoriegeleitete Gesamtbeurteilung einer problematischen Ist-Situation, die aus internen und externen Ursachen sowie den bisher erfolgten Abwehr- und Anpassungsleistungen der Organisation entstanden ist. Damit eine Gesamtbeurteilung gelingen kann, müssen Diagnostikerinnen und Diagnostiker die äußere Hülle durchdringen, um zu den inneren – offensichtlich nicht sichtbaren – Vorgängen zu gelangen (Bornewasser, 2009).
3.2.2 Ziel und Zweck einer Organisationsdiagnose
Organisationsdiagnosen werden in der Praxis vor allem als Reaktion auf aktuelle Unstimmigkeiten erstellt oder wenn das Unternehmen meint, vorhersehbaren Herausforderungen nicht gewachsen zu sein. Organisationsdiagnosen können aber auch als Basis für proaktive Veränderungsprozesse vorgenommen werden, also wenn sich eine Organisation auf mögliche herausfordernde Umweltbedingungen vorbereiten möchte (Bornewasser, 2009).
Grundsätzlich dient die Diagnose als Unterstützung für die Vorbereitung, Planung und Umsetzung von Veränderungsprozessen. Felfe & Liepmann (2008) formulierten dazu den zentralen Satz: „Keine Maßnahme ohne Diagnose“ (S. 23). Wobei Bornewasser (2009) darauf Bezug nimmt und ergänzt: „In diesem Sinn setzt jede Intervention nicht nur Diagnostik voraus, sondern jede erfolgreiche Diagnostik führt auch zur Intervention“ (S. 74). Fisseni (1997) verbindet ebenso die Begriffe Diagnostik und Intervention, indem er die Diagnostik als Methodik bezeichnet, die Problemlösungen anbietet und die Intervention ist für ihn das entsprechende Programm oder bezeichnet Maßnahmen, die eine Verhaltensänderung herbeiführen sollen (vgl. S. 5).
Zentrale Aufgabe von Organisationsdiagnosen, ist Veränderungsbedarfe zu erkennen und Problemfelder zu identifizieren, um daraus gezielte Maßnahmen ableiten zu können. Es geht also insbesondere darum festzustellen, inwieweit eine Systemveränderung anzustreben ist. (Felfe & Liepmann, 2008; Schuler, 2007)
Der Nutzen einer Organisationsdiagnose liegt darin, Informationen bereit zu stellen, die den Mitgliedern einer Organisation eine Basis für Entscheidungen liefern. Damit kommt der Organisationsdiagnose auch eine wichtige Legitimierungsfunktion zu, denn sie bewahrt die betrieblichen Akteure vor „blindem Aktionismus“, der auf Spekulationen und Mutmaßungen basiert“ (Felfe & Liepmann, 2008, S. 24).
Im wissenschaftlichen Sinn liegt das Ziel einer Organisationsdiagnose weniger im Vorbereiten eines Veränderungsprozesses, als die Ausgangssituation und die Veränderung im Prozess der Organisationsentwicklung so reliabel und valide wie möglich zu mehreren Messzeitpunkten zu erfassen. Wenn dies gelingt, kann die Organisationsdiagnostik zur Theorienbildung im Bereich der Organisationsbildung beitragen (vgl. Felfe & Liepmann, 2008, S. 23).
3.2.3 Ablaufschritte einer Organisationsdiagnose
In der Literatur findet sich eine Vielzahl von ähnlich gelagerten Varianten, wie ein Organisationsdiagnose generell ablaufen sollte (Schuler, 2007). Wie schon erwähnt, dient die Diagnose zur Vorbereitung einer Intervention, kann aber als Verfahren selbst bereits als Intervention gesehen werden.
Je nachdem ob es ein wissenschaftlicher Zugang ist oder ein praxisbezogener, wird dem Auftragsgespräch mehr oder weniger Bedeutung zugemessen. Als eine Kombination verschiedenster erprobter Konzepte (Schuler, 2007; Waclacwski & Church, 2002; Kühlmann & Franke, 1989) scheint folgendes Vorgehen praktikabel:
- Kontaktaufnahme,
- Vertragsabschluss,
- Datenerhebung,
- Datenverarbeitung,
- Interpretation der Daten (Diagnose),
- Präsentation der Ergebnisse,
- Erstellen eines schriftlichen Befundes,
- Abschluss der Diagnosephase.
-Diese Einteilung ist nicht als linearer Ablauf zu verstehen vor allem dann, wenn mit qualitativen Methoden ein zyklisches Vorgehen gewählt wurde.
3.2.4 Methoden und Instrumente
„Grundsätzlich setzen Diagnostik und Entwicklung einen Gegenstand voraus, der diagnostizierbar und veränderbar ist, und damit Ansatzpunkte für verfügbare Diagnose- und Entwicklungsinstrumente liefert“ (Bornewasser, 2009, S. 22).
In Abhängigkeit davon, in welchem Kontext die Organisationsdiagnose angewendet wird, unterscheidet sich auch die Auswahl der Methoden. Wird die Organisationsdiagnose in einem Forschungskontext angewendet, geht die Tendenz zu standardisierten Verfahren, wohl auch deshalb um den Anspruch nach Gütekriterien und Vergleichbarkeit zu entsprechen (Bornewasser, 2009; Felfe & Liepmann, 2008). Wird die Organisationsdiagnose in einem beraterischen Kontext angewendet, dann spielen qualitative Verfahren eine größere Rolle, da sie für das Vorbereiten von Veränderungsprozessen und dem Erfassen von Komplexität besser geeignet sind. Trotzdem ist eine generelle Tendenz in der Organisationsdiagnostik vorhanden, den Schwerpunkt auf quantitative Methodiken und logisch nachvollziehbare Prozesse zu legen (Bornewasser, 2009; Kamiske & Brauer, 2003; Toutenburg & Knöfel, 2008).
Es gibt eine Vielzahl von Methoden die für die Diagnostik von Organisationen eingesetzt werden; Moser (2007) nennt folgende häufig verwendete Methoden:
- Interviews,
- Fragebogen,
- Beobachtungen,
- Beurteilungsskalen,
- Simulationen,
- Nicht-reaktive Verfahren,
wobei seiner Meinung nach die Datenerhebung über das Internet zunehmend an Bedeutung gewinnt (S. 102ff).
Mit diagnostischen Methoden sollen jedoch nicht nur kritische Zustände erhoben werden, sondern auch Ergebnisse darüber entstehen, wie sich diese Zustände beheben lassen (vgl. Bornewasser, 2009, S. 73). Damit dienen organisationsdiagnostische Methoden nicht nur zur Vorbereitung einer Intervention sondern bekommen gleichzeitig auch eine präventive Funktion.
Wird im Rahmen der Organisationsdiagnostik oder von einer Organisationsentwicklung eine starke Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewünscht, dann nimmt das Instrument der Mitarbeiterbefragung eine zentrale Funktion ein (Felfe & Liepmann; 2008, Schuler, 2007). Begründet wird dies damit, dass das subjektive Erleben (Zufriedenheit, Motivation, etc.) entweder über die direkt betroffenen Personen erhoben werden kann (Selbstbericht), oder indem andere Personen befragt werden, die das Verhalten als Beteiligte direkt erleben (Fremdbericht) (vgl. Felfe & Liepmann, 2008, S. 41).
Die Mitarbeiterbefragung (MAB) ist eine systematische Vorgehensweise, bei der die Mitarbeiter von Organisationen nach ihren „Sichtweisen, Wahrnehmungen, Hoffnungen, Bewertungen, Befürchtungen oder Erinnerungen befragt werden – mit der Absicht, Daten über die Personen hinweg auszuwerten und das Erreichen von Organisationszielen zu unterstützen (vgl. Borg, 2003, S. 24).
Borg nennt fünf Haupttypen von Mitarbeiterbefragungen: Meinungsumfrage, Benchmarkingumfrage, Klimabefragung mit Rückspiegelung, Auftau- und Einbindungsmanagementprogramm und Systemtische MAB (S. 26). Die Klimabefragung mit Rückspiegelung entspricht dem Survey-Feedback-Ansatz der Aktionsforschung und zielt auf die Verbesserung des Betriebsklimas durch die Einbindung möglichst aller Mitarbeiterinnen ab.
Die Mitarbeiterbefragung kann in zwei Richtungen geführt werden: Entweder mehr messorientiert (mMAB) oder eher interventionistisch (iMAB). Eine interventionische MAB folgt einem bestimmten Zyklus, der jenem einer prozessorientierten Organisationsdiagnose sehr ähnlich ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Hauptabschnitte einer interventionistischen Mitarbeiterbefragung (iMAB) (innerer Kreis) und einer messorientierten Mitarbeiterbefragung (äußerer Kreis) nach Borg (2003, S. 28)
Im Zusammenhang mit dem Konzept einer Organisationsentwicklung wird von Borg (2003) jedenfalls die Vollbefragung empfohlen, wobei es dazu entsprechende Skills und Ressourcen braucht. „Vollbefragungen bedeuten immer eine volle Einbindung aller Mitarbeiter. Auch wenn diese sich im Einzelfall nicht an der MAB beteiligen, werden sie doch in der Vorbereitung der MAB angesprochen und in die Folgeprozesse involviert als Personen, die zumindest die Möglichkeit hatten sich zu äußern“ (S. 79). Vorteile sind neben der Datenakzeptanz, dass die größere Visibilität, die höhere Einbindung und die besseren Befunde von Vollbefragungen dazu führen, dass sie als Instrumente des Veränderungsmanagements deutlich mehr Schwung „Momentum“ erzeugen. Wichtig ist, den Schwung anschließend aufzunehmen und fortführen zu können (S. 77ff).
Borg (2003) erwähnt weiters, dass die MAB-Literatur generell nachdrücklich empfiehlt, MABs nur dann durchzuführen, wenn die „Befunde konsequent in Aktionen umgesetzt werden sollen“ (S. 363).
3.2.5 Partizipation
Partizipation (vom Lateinischen ‚partizipatio’) wird meist mit Teilhabe, Teilnahme, Beteiligung oder Mitwirkung übersetzt. Der Begriff Partizipation kommt aus den 1970er Jahren, wo er in Zusammenhang mit den Neuen Sozialen Bewegungen, der Öko- und Frauenbewegung entstanden ist. Partizipation beinhaltet die Forderung nach Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen an relevanten (politischen) Entscheidungsprozessen und damit Einfluss auf soziale und politische Rahmenbedingungen – insbesondere Jene, die traditionell von diesen Prozessen eher ausgeschlossen werden. In der Literatur findet sich der Begriff Partizipation vor allem im betrieblichen Sektor, im Bereich politischer Partizipation, im Gesundheitssektor, sowie in der wissenschaftlichen Forschung (Keupp, 1999a; Stark, 1996).
In der Diskussion um politische Teilhabe werden Fragen der Selbstermächtigung (Empowerment) von in der Gesellschaft diskriminierten Gruppen als Partizipationsziel beschrieben. Im forschungsorientierten Sektor geht es um die Integration von “Laien”, als Experten sowie ihrer Erfahrung und ihres Umweltwissens in die Untersuchungsprozesse. Eine besonders schöne Definition findet sich bei Baker & Hinton (1999): „Participation is a way of working and a way of relating to people that can be used in any situation. It is about shared responsibility, power and knowledge. It is a democratic way of getting things done” (S. 80).
[Partizipation ist eine Arbeitsweise mit und zwischen Menschen, die in jeder Situation zum Tragen kommen kann. Es geht dabei um geteilte Verantwortlichkeiten, um Wissen und um Macht. Es ist eine demokratische Art und Weise, die Dinge zu erledigen.]
Man unterscheidet zwischen direkter und indirekter Partizipation, also ob man persönlich oder durch gewählte Stellvertreter an der Entscheidungsfindung teilnimmt. Weiters lässt sich zwischen formalen, also rechtlich geregelten, und informellen Formen der Partizipation unterscheiden. Die "de jure"-Form bezeichnet jene durch die Verfassung vorgegebenen Normen zur Mitbestimmung. Die in einer Organisation tatsächlich stattfindende Partizipation wird auch "de facto"-Form genannt.
Partizipation in der Stadtentwicklung bedeutet die Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen, dazu bietet sich folgendes Stufenmodell der Partizipation an:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Stufenmodell der Partizipation (Lüttringhaus, 2000, S. 44)
Die Übergänge zwischen den unterschiedlichen Stufen der Partizipation sind fließend, auch können in einem Projekt mehrere Intensitäten zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchlaufen werden. Nach diesen Stufen der Partizipation und dem dahinter liegenden Verständnis kann eine Zusammenarbeit bis zu einer gleichberechtigten Partnerschaft reichen, wobei die letzte Entscheidung immer beim legitimierten Vertreter liegt.
Nach Scholl (2007) ist Partizipation in Organisationen ein brisantes Dauerproblem, da mit der Größe der Organisation die Gefahr wächst, dass die Bedürfnisse und Interessen der Nichtbeteiligten ignoriert oder missachtet werden. Entscheidungsrechte sind das wichtigste Machtpotenzial in Organisationen, wobei in den meisten Organisationen die tatsächliche Entscheidungsbeteiligung geringer ausfällt, als sie sein könnte. Damit werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unmündig gehalten. Und diese Machtkonzentration an der Spitze führt dazu, dass das innerbetriebliche Wissen und die damit verbundenen Fähigkeiten zu wenig genutzt werden. Partizipation ist ein wesentliches Instrument mit dem sich das Machtgefälle verringern und die Mündigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heben lässt.
Partizipation in Organisationen führt zu besseren Entscheidungen, bei partizipativen Arbeitsformen wird mehr gelernt und durch die Teilnahme an Entscheidungsprozessen können Bedürfnisse nach Kontakt und Anerkennung sowie zu selbstbestimmten Handeln befriedigt werden. Partizipation trägt zur Zufriedenheit in Organisationen bei. In diesem Zusammenhang zeigt sich Scholl (2007) verwundert „warum diese Vorteile immer wieder neu entdeckt werden müssen und in der Praxis oft vernachlässigt werden“ (S. 546). Er begründet dies damit, dass in Anlehnung an das „Eherne Gesetz der Oligarchie“ des Soziologen Robert Michels (1911) die Mächtigeren ihre Macht nicht teilen wollen, was mehrfach zur Nichtübernahme oder zum Abbruch erfolgreicher Partizipationsexperimente geführt hat.
Die Organisationsdiagnose beinhaltet die Möglichkeit eine partizipative Vorgehensweise bereits zu einem frühen Zeitpunkt zu etablieren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv einzubeziehen (Felfe & Liepmann, 2008; Bornewasser, 2009).
3.2.6 Organisationales Commitment
Die Commitmentforschung hat ihre Ursprünge in den fünfziger Jahren und ist seit mehreren Jahrzehnten in der Organisationsforschung verankert. Mit organisationalem Commitment wird „[...] die Verbundenheit oder Identifikation des Mitarbeiters mit seinem Unternehmen verstanden.“ [...] „Die Bindung kann durch ein hohes Maß an Verbindlichkeit und Loyalität, aber auch durch Gleichgültigkeit und Distanz geprägt sein. Ein hohes durchschnittliches Commitment kann auch als Ausdruck eine starken Zusammenhalts und einer ausgeprägten Unternehmensidentität verstanden werden.“ [...] „Es wird erwartet, dass sich Mitarbeiter mit hohem Commitment besonders engagieren, eine geringe Fluktuationsneigung aufweisen und ihrem Unternehmen, vor allem auch in schwierigen Zeiten ‘treu‘ bleiben.“ (Felfe & Liepmann, 2008, S. 89f). Besonders für jene Unternehmen, die flexibel und individualisiert agieren, gilt die Fähigkeit zur Bindung qualifizierter Beschäftigter an das Unternehmen mittlerweile als entscheidendes Erfolgskriterium (Gmür & Schwerdt, 2005; Westphal & Gmür, 2009).
Allen und Meyer (1991) haben unterschiedliche Linien der Commitmentforschung zu einem Drei-Komponenten-Modell zusammengeführt.
Die Komponenten bestehen:
- aus dem affektivem Commitment, das ist die Verbundenheit basierend auf Wünschen und Wollen,
- dem kalkulatorischem Commitment, diese Bindung basiert vorwiegend auf rationalen Erwägungen und
- dem normativen Commitment, das auf der Ansicht basiert, sozialen oder ethischen Normen entsprechen und sich verpflichtet fühlen zu müssen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Organisationales Commitment (Westphal & Gmür, 2009, S. 204)
Identifikation und Verbundenheit mit dem Unternehmen gilt vor allem, wenn affektives und normatives Commitment vorhanden ist. Eine Verbundenheit, die lediglich auf rationalem Kalkül sind beruht, lässt keine oder sogar negative Zusammenhänge zu erwarten (vgl. Felfe & Liepmann, 2008, S. 92). Der höchste Zusammenhang mit dem Unternehmenserfolg besteht mit dem affektiven Commitment. Ist dieses vorhanden, sind Mitarbeiter auch zu besonderem Engagement bereit. Weiters korreliert es signifikant positiv mit organisationsrelevanten Erfolgsfaktoren wie Arbeitsleistung, innovativen Ideen und organisatorischem Beteiligungsverhalten (Westphal & Gmür, 2009). Damit wird vorhandenes Commitment zu einem wichtigen Faktor bei Veränderungsprozessen in Unternehmen.
3.2.7 Diagnostik – Gutachten
Es gibt verschiedene Richtlinien, wie ein diagnostisches Gutachten zu erstellen ist und welche Informationen darin enthalten sein müssen. Dabei unterscheiden sich die psychologischen Gutachten der Individualdiagnostik nicht wesentlich von den Gutachten der Organisationsdiagnostik. Basierend auf Börner (2004), Westhoff & Kluck (2008) und Zuschlag (2006) sollte ein Gutachten folgende Punkte beinhalten:
- Formale Angaben: Anschreiben; Auftrag / Fragestellung; Übersicht über die eigene Untersuchung.
- Vorgeschichte: Resümee der Vorgeschichte; der vorliegenden Dokumente und jeglicher Informationsquellen, die herangezogen worden sind.
- Untersuchungsbericht: Beschreibung der Testverfahren; unpersönliche, sachliche Darstellung und Interpretation sämtlicher erhaltener Daten; Nachweise der genutzten Informationsquellen.
- Befund: Integration der einzelnen Ergebnisse zu einem sinnvollen Ganzen.
- Stellungnahme: Systematische Beantwortung jeder einzelnen Fragestellung und Empfehlung von Maßnahmen.
-Fisseni‘s (1997) Beschreibung des Ablaufs einer individualdiagnostischen Untersuchung klingt zwar relativ einfach, ähnelt in der Vorgehensweise jedoch weitestgehend organisationsdiagnostischer Untersuchungen und zeigt Parallelen zur Vorgehensweise der Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1998):
- Eine Fragestellung wird (vom Probanden) eingebracht und eine Lösung oder Beantwortung von einem Psychologen als Experten erwartet
- Die Fragestellung übersetzt der Psychologe in ein Untersuchungsszenario
- Die entsprechenden Untersuchungsverfahren werden bestimmt
- Es folgt eine Phase der Untersuchung
- Die erhobenen Daten werden ausgewertet, Ergebnisse verglichen und interpretiert
- Dann ist zu entscheiden, ob die gewonnen Informationen ausreichen, um die Ausgangsfrage zu beantworten oder ob neue Informationen einzuholen sind
- Reicht die Information aus, formuliert der Psychologe eine Antwort auf die zu Beginn gestellte Frage, erstellt eine Diagnose und gibt evtl. eine Prognose, unterbreitet einen Entscheidungsvorschlag und empfiehlt interventive Maßnahmen
- Soweit möglich, muss er sich des Erfolgs vergewissern und prüfen, ob seine diagnostisch-interventive Handlungssequenz in Erfolg mündet oder bei Misserfolg endete (Evaluierung). (S. 20f)
- Börner (2004) ergänzt noch um Hinweise zur Gutachtenerstellung:
- Die Begutachtung sollte der Persönlichkeitsstruktur des Probanden angemessen sein.
- Widersprüche und Kontraste aus den Testergebnissen sollten nicht als solche stehen bleiben und das Gutachten selbst darf nicht widersprüchlich sein.
- „Getroffene Aussagen sollen immer abgestützt sein, entweder durch interpretierbare Resultate in den psychologischen Verfahren oder durch die Informationen, die durch Anamnese, Exploration und Verhaltensbeobachtung gewonnen wurden. Dabei ist es wichtig, nicht bei einer Beschreibung der Symptomatik stehenzubleiben, sondern auf die dahinterliegende Problematik einzugehen. Alle Schlüsse sollten klar und verständlich gezogen werden“ (S. 13).
Abschließend wird von Börner nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der begutachtende Psychologe gegenüber dem Probanden und dessen Umwelt eine Verantwortung hat. Befund und Stellungnahme sind so objektiv wie möglich abzufassen und mit den empfohlenen Maßnahmen zur Lösung der Probleme des Probanden beizutragen.
Im Gegensatz zur Individualdiagnostik steht die Organisationsdiagnostik vor der Herausforderung, nicht nur eine Diagnose zu erstellen und sie mit einem Befund abschließen zu müssen, sondern es sind Veränderungsmaßnahmen ab- und einzuleiten. Organisationsdiagnostik verbindet also Diagnose und Therapie gleichermaßen, was eine gewisse (berufliche) Herausforderung darstellt. (vlg. Bornewasser, 2009, S. 79)
3.2.8 Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung in der Organisationsdiagnostik, wird immer wieder als unvollständig beschrieben vor allem auch deshalb, weil sich im Feld nicht dieselben Bedingungen vorfinden lassen wie im Labor. Zumeist orientieren sich die Gütekriterien an quantitativen Messdaten die in der Organisationsdiagnostik zum Einsatz kommen, sich aber nur auf Teiluntersuchungen beziehen.
Felfe & Liepmann (2008) empfehlen in diesem Zusammenhang Leitlinien aus der Individualdiagnostik direkt auf die Organisationsdiagnostik zu übertragen. Als übergeordnete Maxime sehen sie Transparenz und Offenheit für alle Beteiligten, wobei sich diese sowohl auf den Auftrag als auch auf die Ziele der Organisationsdiagnose beziehen (S. 123). Damit die Überprüfbarkeit gewährleistet ist, soll das Vorgehen theoriegeleitet und die verwendeten Begriffe und Konstrukte wissenschaftlich fundiert sein. Die Konzepte sollen empirisch erfolgreich überprüft werden, womit auch die Frage der Validität (Gültigkeit) der eingesetzten Verfahren angesprochen ist. Die Validität der Ergebnisse wird oft im Zusammenhang mit der Repräsentativität gestellt. „Es besteht die Gefahr, dass bestimmte Gruppen überproportional vertreten und andere unterrepräsentiert sind [...] Das Problem, dass Stichprobeneffekte die Befundlage beeinflussen, kann prinzipiell nur bei einer Vollerhebung ausgeschlossen werden“ (Felfe & Liepmann, S. 43). Bezüglich der Objektivität und Zuverlässigkeit beziehen sie sich vornehmlich auf standardisierte quantitative Verfahren und empfehlen die Verwendung von Skalen. Bei der Prozess- und Verfahrensqualität sind Bedingungen einzuhalten, die eine überprüfbare Gestaltung der Abläufe und Verfahren sicherstellen. „Es müssen Informationen zu den eingesetzten Verfahren vorliegen, d.h. die Zielsetzungen und Anwendungsbereiche der Verfahren sind zu skizzieren, der Hintergrund des jeweiligen ist zu benennen und die Gütekriterien müssen dokumentiert werden“ (Felfe & Liepmann, S. 124).
Für das Überprüfen der Wirksamkeit einer Interventionsmaßnahme bietet sich die Evaluation an, wobei nach Bornewasser (2009) die Diagnostik, die Interventionsmaßnahme und die Evaluation eine Einheit bilden; so stellt „die Evaluation den abschließenden Baustein von Veränderungsprozessen dar“ (S. 262). Systematische Evaluierungen von Veränderungsprozessen werden jedoch vernachlässigt, was einerseits in der Komplexität der zu evaluierenden Vorgänge liegt und andererseits im Mangel an nachvollziehbaren und rasch einsetzbaren Verfahren (vgl. Bornewasser, S. 268).
3.2.9 Exkurs: Qualitative Organisationsdiagnose nach Froschauer & Lueger (2009)
Obwohl die „Aktivierende Stadtdiagnose“ zeitlich rund 10 Jahre vor dem Artikel von Froschauer & Lueger (2009) entstanden ist, finden sich erstaunlich viele Parallelen sowohl beim grundsätzlichen Verständnis zur Methode als auch zur methodischen Vorgehensweise selbst. Deshalb werden an dieser Stelle jene Aspekte der qualitativen Organisationsdiagnose (q_OD) hervorgehoben, welche die stärksten Parallelen zur „Aktivierende Stadtdiagnose“ aufweisen.
- Die q_OD ist eine theoretisch und methodisch abgesicherte Vorgehensweise, mit der ein differenziertes Verständnis erlangt werden kann, das zur Stabilisierung und Veränderung von Organisationen nötig ist (vgl. S. 250). „Eine Organisationsdiagnose zu erstellen bedeutet primär, das auf der Basis von theoretischen Überlegungen unter Zuhilfenahme systematischer Erkenntnismethoden erlangte Verständnis der sozialen Dynamik eines Unternehmens auf praktische Probleme anwendbar zu machen“ (S. 259).
- Die q_OD konzentriert sich vorrangig auf jene Faktoren, die den Erfolg von Unternehmen ausmachen.
- Die q_OD ist für verschiedenste Praxisanwendungen einsetzbar – u.a. auch als Analyse der Entwicklungspotenziale eines Unternehmens (vgl. S. 250).
- Eine q_OD bezieht sich nie auf eine objektive gegebene Realität, sondern rekurriert auf eine kollektiv geteilte Betrachtungsweise von Organisationen. Sie konzentriert sich darauf, wie eine Organisation als Kollektiv ihre Umwelt beobachtet, welche Relevanzkriterien sie dabei einsetzt, welche Schlussfolgerungen sie daraus zieht und welche Handlungsdynamik sich daraus ergibt (vgl. S. 260 ff).
- Eine q_OD orientiert sich an der Wahrnehmung der Organisation durch ihre Akteure. Dahinter steht das Verständnis einer sozialen Wirklichkeitskonstruktion, die als aktiver Prozess der Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung verstanden werden kann (vgl. S. 260 ff).
- Die Vorgehensweise bei der q_OD ist offen. Es wird zuerst untersucht, welche Faktoren für das Verständnis der jeweiligen Organisation zentral sind. Die systemtheoretische Perspektive gibt hierfür methodologische Anknüpfungspunkte vor (vgl. S. 252).
- Eine q_OD zentriert sich auf die Identifikation jener Schlüsselelemente, die für das Verständnis der spezifischen Funktionsweise und der Entwicklungspotenziale besonders relevant sind. Es rücken Fragen in den Vordergrund, die sich mit der Identität einer Organisation, den internen Kräfteverhältnissen und dem Umgang mit Wissen und Kompetenzen befassen oder sich auf das Erkennen und Bewältigen von Irritationen oder Anforderungen beziehen (vgl. S. 260ff).
- Eine q_OD erfüllt vier eng miteinander zusammenhängende Funktionen: Sie kann (a) als Instrument zur systematischen Reflexion in der Organisation dienen. Mit ihr ist (b) eine formative Evaluierung von Organisationsprozessen und (c) eine summative Evaluierung von Interventionen möglich. Sie dient aber auch (d) als Instrument zur Analyse von Entwicklungspotenzialen. In diesem Zusammenhang wird von den Autoren betont, dass es sinnvoller ist eine q_OD extern zu vergeben, da dies bei seriöser Durchführung eine eigenständigere Sicht ermöglicht. Wie sehr diese Außensicht von der Organisation akzeptiert wird, hängt vom „erlangten Vertrauen seitens der Organisationsmitglieder und von der Herstellung von Anschlussfähigkeit an das Unternehmen im gesamten Prozess der Diagnoseerstellung ab“ (S. 259).
- Methodisch orientiert sich die q_OD an den grundlegenden Prinzipien der qualitativen Sozialforschung: Offenheit, Kommunikation, Prozessualität und Reflexivität (S. 270f).
- Der Ablauf der q_OD verläuft in folgenden Phasen: In der (a) Planungsphase werden Grundsatzentscheidungen getroffen und die Diagnoseplanung gemacht wird. Darauf folgt (b) eine Orientierungsphase, bei der mit Einstiegsgesprächen begonnen wird, wobei eine inhaltliche und methodische Diagnosestrukturierung stattfindet. Anschließend folgen (c) die Diagnosezyklen, die abwechselnd von Erhebungen, Interpretationen, Prüfverfahren und Zwischenbilanzen geprägt sind. Dies entspricht sehr stark der Vorgehensweise der Grounded Theory und findet sich auch bei der „Aktivierenden Stadtdiagnose“ wieder. Nach dem Abschluss der Diagnose und der Bewertung der Ergebnisse folgt (d) die Ergebnispräsentation. Hier werden die Ergebnisse in verständlicher Weise an die Organisation rückgemeldet. Der Anschluss an die Wissenschaft erfolgt durch die Reflexion im wissenschaftlichen Kontext (vgl. S. 278f).
- An geeigneten Erhebungs- und Interpretationsverfahren werden empfohlen: (a) die Beobachtung, systematisch und unsystematisch, zur Verflechtung verschiedenster Materialien; (b) die Artefaktanalyse, dazu zählen Bilder, Werbematerialien, Architektur, Protokolle, Texte, Einrichtung von Räumen, Organigrammen, etc; (c) die Strukturdatenanalyse, dazu zählen Entstehungsgeschichte, Strukturmerkmale wie Geschlechterverhältnis-Verteilung, Altersverteilung u.ä. Der Vorteil dieser Daten ist, dass sie nicht durch Erhebungsaktivitäten verändert werden. (d) Gespräche, entweder formell als Interviews oder informell geführt, sind das zentrale Erhebungsinstrument. Laut Autoren werden offene Gruppen- bzw. Einzelgespräche am häufigsten geführt. Bei der Auswertung der Gespräche werden drei Möglichkeiten der Interpretation angeführt, die Feinstrukturanalyse, die Systemanalyse und die Themenanalyse. Die Themenanalyse eignet sich besonders zur Analyse des Hintergrunds eines sozialen Systems und der Spezifika und des Zusammenhangs verschiedenster Themen. Der Vorzug liegt in der Möglichkeit, größere Textmengen systematisch zu bearbeiten (S. 286ff).
- Für die Ergebnispräsentation wird eine Bewertung vorgenommen, die zu praktischen Anforderungen anschlussfähig ist (vgl. S. 255).
- Der besondere Vorzug von Organisationsdiagnosen liegt in Wahrnehmung von Entwicklungschancen der jeweiligen Organisation (vlg. S. 256).
3.3 Nachhaltigkeit und Resilienz
Dieses Kapitel bezieht sich auf den, im vorigen Kapitel forumulierten Anspruch, dass eine fundierte Diagnose auch Theorie voraussetzt. Es wird davon ausgegangen, dass für eine sich an der Praxis orientierende Diagnosemethode nicht nur wissenschaftliche Theorien, sondern auch gesellschaftspolitische Konzepte notwendig sind. Im konkreten Fall bietet sich das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung an, das zu Beginn dieses Kapitels vorgestellt wird. In weiterer Folge wird die Verbindung zwischen dem Konzept der Nachhaltigkeit mit dem erst in jüngerer Zeit diskutierten Resilienzkonzept hergestellt.
3.3.1 Definition
Die Suche im Internet im Mai 2012 mit dem Begriffspaar „Nachhaltige Entwicklung“ ergab 2,7 Millionen Treffer. Daraus lässt sich ersehen, welche Verbreitung das Konzept und der Name seit seiner Entstehung im 18. Jahrhundert mittlerweile gefunden haben.
Stellvertretend für viele mehr oder weniger komplexe Definitionen sei an dieser Stelle die einfache, aber doch treffende Formulierung des deutschen Rats für Nachhaltige Entwicklung angeführt: „Wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben." (Lexikon der Nachhaltigkeit, 2012)
3.3.2 Geschichte der Nachhaltigkeit
Die Geschichte der Nachhaltigkeit beginnt im 18. Jahrhundert. Am kursächsischen Hof in Freiberg formulierte Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz verschiedene Grundsätze wie ausreichende Holzmengen für den Bau von Silberminen dauerhaft zur Verfügung stehen. Es sollte gewährleistet werden, dass nicht mehr Bäume geschlagen werden, als wieder nachwachsen können (Ehmayer, 2010b; Grunwald & Kopfmüller, 2006; Ritt, 2002).
1983, etwa 200 Jahre später, gründeten die Vereinten Nationen die „World Commission on Environment and Development“ (WCED). Ihr Auftrag war die Erstellung eines Perspektivenberichts für eine langfristige, tragfähige und umweltschonende Entwicklung der Welt. Zur Vorsitzenden wurde die damalige Ministerpräsidentin von Norwegen, Gro Harlem Brundtland, gewählt. 1987 veröffentlichte die WCED ihren als Brundtland-Report bekannt gewordenen Zukunftsbericht Our Common Future, der die internationale Debatte über Entwicklungs- und Umweltpolitik maßgeblich beeinflusste.
Der Abschlussbericht der Brundtland-Kommission ist deswegen so bedeutend, weil hier erstmals ein Leitbild für eine nachhaltige Entwicklung formuliert wurde. Die Kommission versteht darunter eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden. (Brundlandt Report, 1987; World Commission on Environment and Development, 2010). Vieles was im Brundtland-Bericht enthalten ist, hat bis heute Gültigkeit. Der Brundtland-Report war außerdem der auslösende Faktor für die Umweltkonferenz in Rio de Janeiro (1992) die als der Beginn der weltweiten Umsetzung des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung gesehen werden kann.
Über 15.000 Delegierte aus 178 Staaten, 115 teilnehmende Staats- und Regierungschefs sowie Vertreterinnen und Vertreter von Nicht-Regierungsorganisationen, haben die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) zur bislang größten internationalen Konferenz gemacht. Das Schlüsselwort war „Sustainable Development“, das mit „nachhaltige Entwicklung“, „zukunftsfähige“ oder „zukunftsbeständige Entwicklung“ übersetzt wird. Das zentrale Dokument dieser Konferenz war die sogenannte Agenda 21, ein Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert. In 40 Kapiteln werden die Wechselwirkungen zwischen Mensch, Umwelt und Entwicklung unter Einbeziehung ökologischer, sozialer und ökonomischer Aspekte beschrieben. Die Verbindung zwischen Ökonomie, Sozialem und der Ökologie ist der gesellschaftliche Meilenstein der Agenda 21, zu deren Umsetzung sich die unterzeichnenden Staaten in Rio verpflichtet haben (Lexikon der Nachhaltigkeit, 2012).
2002 fand in Johannesburg die Folgekonferenz des Weltgipfels von Rio statt. Der Slogan wandelte sich von „Agenda“ zur „Action“, also von der Tagesordnung zur Umsetzung. Die Diagnose von Rio de Janeiro über die existentielle Bedrohung durch eine Reihe globaler Entwicklungstrends wurde erneut bestätigt, vor allem internationale Gruppen von Expertinnen und Experten und Nicht-Regierungsorganisationen konstatierten eine im vergangenen Jahrzehnt nur unzureichend vollzogene Problemlösung (Cervinka & Schmuck, 2010).
Im Juni 2012 hat die dritte Nachfolgekonferenz, nach 1997 in New York und 2002 in Johannesburg, wiederum in Rio de Janeiro stattgefunden. Es wurde erwartet, dass die dort anwesenden Staats- und Regierungschefs der nachhaltigen Entwicklung wieder neuen Schwung verleihen. Rio+20 sollte außerdem bilanzieren, wie weit die Agenda 21 in den vergangenen zwanzig Jahren in der Praxis umgesetzt wurde und was damit erreicht werden konnte. Übrig geblieben ist ein eher enttäuschendes Ergebnis.
Das Abschlussdokument „The future we want“ wurde bereits auf den Vorbereitungstreffen ausgehandelt und am Abend vor dem Gipfel vorgelegt. Sowohl die EU, als auch viele EU-Staaten kritisierten das Dokument. Streitpunkte waren vor allem die Erhebung des UN-Umweltprogramms UNEP zu einer vollwertigen UN-Agentur sowie der Plan zum Meeresschutz, wobei auf hoher See Schutzgebiete eingerichtet werden sollen. Vor allem die USA und Venezuela waren gegen solche Pläne, da vor allem die USA eine Einschränkung der Mobilität ihrer Kriegsflotte befürchtete (Lexikon der Nachhaltigkeit, 2012).
Der österreichische Umweltminister Nikolaus Berlakovich hat seine Teilnahme am UN-Umweltgipfel Rio+20 in Rio de Janeiro medienwirksam absagt. Er begründete seine Nichtteilnahme damit, dass kein abschließendes Dokument vorgelegt wurde und die Konferenz zu Ende sei, bevor sie noch begonnen habe (Die Presse, 2012).
Das Auseinanderklaffen zwischen der Dringlichkeit einer gesellschaftlichen Veränderung und politischer Interessenkonflikte die alles verlangsamen, um nicht zu sagen verhindern, ist nicht neu und betrifft nicht nur das Thema der Nachhaltigen Entwicklung. Die aktuelle Finanzkrise und die gegenwärtige Situation der Überschuldung vieler Staaten zeigen jedoch, dass nachhaltiges Wirtschaften weiterhin ein Thema oder eine gesellschaftliche Herausforderung bleiben wird müssen, ebenso wie das Arbeiten an mehr sozialer Gerechtigkeit sowie der Umsetzung ökologischer Maßnahmen, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels weltweit abzufedern.
3.3.3 Lokale Agenda 21 und Wien
In der Lokalen Agenda 21 (dem 28. Kapitel der Agenda 21) wird den Städten und Gemeinden eine zentrale Aufgabe zur nachhaltigen gesellschaftlichen Veränderung zugeteilt. Im Originalwortlaut lautet dieses Kapitel „Local authorities initiatives in support of Agenda 21“ und besteht aus 7 Paragraphen, eingeteilt in „Basis for Action“ (Ausgangsbasis), „Objectives“ (Ziele) und „Activities“ (Aktivitäten). Abschließend werden die „Means of Implementation“ (Wege zur Umsetzung) skizziert (Vereinte Nationen, 1992). Die „Local Authorities“, damit sind vorwiegend politisch Verantwortliche und die Verwaltung gemeint, werden aufgefordert initiativ zu werden, indem sie die Agenda 21 unterstützen und ihren Beitrag zur Umsetzung leisten. Sie sollen unter Einbeziehung ihrer Bürgerinnen und Bürger Konzepte für eine nachhaltige Entwicklung erarbeiten. Das gesamte Kapitel 28 ist relativ kurz gehalten und lässt viel Interpretationsspielraum offen.
1994 fand in Aalborg (Dänemark) die erste Konferenz für nachhaltige Städte und Gemeinden statt. Es entstand ein weiteres zentrales Dokument, die „Charta von Aalborg“, die von Vertreterinnen und Vertretern von 80 Europäischen Städten und Gemeinden unterzeichnet wurde. Für Wien unterzeichnete Bürgermeister Dr. Michael Häupl, 1996 dieses Dokument. Damit hat sich die Stadt Wien freiwillig verpflichtet, einen Lokalen Agenda 21-Prozess in Wien einzuleiten.
1998 startete unter meiner Leitung das Pilotprojekt zur Lokalen Agenda 21 in Wien-Alsergrund im 9. Wiener Gemeindebezirk. Der gesamte Prozess basierte auf umwelt- und gemeindepsychologischen Konzepten mit dem Ziel, einen auf Zukunftsfähigkeit ausgerichteten Veränderungsprozess in Gang zu setzen, der von Politik, Verwaltung und Bevölkerung gemeinsam getragen war. Im Vordergrund standen von Beginn an konkrete Projekte und nicht abstrakte Konzepte, wobei der organisationsdiagnostische Ansatz: Diagnose vor Intervention, bereits hier zum Tragen gekommen ist (Ehmayer, 2000d).
Das „Pilotprojekt der Lokalen Agenda 21 in Wien-Alsergrund“ war jenes Projekt, bei dem das gemeindepsychologische Verfahren „Community-Diagnosis / Profile-Analysis“ der italienischen Gemeindepsychologin Donata Francescato erstmals für einen Lokalen Agenda 21 Prozess angewendet wurde (Ehmayer, 2000d).
Eine systematische Weiterentwicklung der Methode, fand annähernd zeitgleich im wissenschaftlichen Projekt „Kulturlandschaftsforschung und Agenda 21“ statt (Ehmayer, 1999a, 1999c, 2000c).
Die Erfolge des Pilotprojektes führten zur Entwicklung eines gesamtstädtischen Organisationsmodells für eine wienweite Lokale Agenda 21. Dieses Modell wurde im Mai 2002 vom Wiener Gemeinderat beschlossen und der „Verein Lokale Agenda 21 in Wien zur Förderung von Bürgerbeteiligungsprozessen“ als zentrale Koordinationsstelle eingerichtet.
3.3.4 Resilienz
Resilienz (lat. resilire) bedeutet soviel wie zurückspringen oder abprallen und ist ein Begriff aus der Kybernetik. Gemeint ist die Toleranz eines Systems gegenüber Störungen, wodurch das betreffende System in der Lage ist, nach einer Störung wieder in den ursprünglichen Zustand „zurückzuspringen“. Die deutsche Übersetzung lautet oft „Krisenfestigkeit“, wobei die Autoren meinen, dass mit diesem Begriff nicht alle wesentlichen Aspekte erfasst werden. Sie schlagen vor, bei dem Wort „Resilienz“ zu bleiben (vgl. Lukesch et al.., 2010, S.11f).
Interessant im Zusammenhang mit der Resilienz ist, dass sich mit ihr ein direkter Bezug zur Psychologie herstellen lässt. Die Resilienzforschung in der Psychologie beschäftigt sich vor allem mit der Frage, warum manche Kinder und Jugendliche in kritischen Lebensverhältnissen mehr Widerstandsfähigkeit oder Widerstandskraft entwickeln als andere. Nach Steinhausen (2006) wird mit dem Begriff der „Resilienz“ die personengebundene Protektivität bezeichnet, die sowohl als Immunschutz als auch als positives Selbstwertgefühl mit Pufferfunktion gegenüber der Entwicklung einer depressiven Störung in einer Phase besonderer lebensgeschichtlicher Belastungen wirksam wird (vgl. S. 34). Resilienz kann sich u.a. als kognitive, emotionale oder handlungsorientierte Kompetenz manifestieren, was bedeutet, dass unterschiedliche Resilienzen in einem jeweils unterschiedlichem Profil vorliegen, sodass nicht eine mit allen Belastungen kompatible Pufferung erfolgt. Neben der Resilienz als psychologischem Schutzfaktor gibt es die Vulnerabilität als psychologischen Risikofaktor. Vulnerabilität und Resilienz sind jedoch nicht isoliert voneinander zu betrachten, wenngleich die Schutzfaktoren nicht als Gegenpol der Risikofaktoren verstanden werden sollten (vgl. S. 47f). Resilienz wird hier mit psychischer Widerstandfähigkeit gleichgesetzt.
Neben der Psychologie ist das Resilienzkonzept vor allem in den Wissenschaftszweigen der Ökologie, der Sozialökologie und neuerdings auch in der Managementforschung rezipiert worden. Das Resilienzkonzept fokussiert stark auf die Frage, wie Systeme mit Störungen, Überraschungen, unerwarteten Entwicklungen und Unsicherheiten umgehen. Felgentreff, Kuhlicke & Westholt (2012) beschreiben vier verschiedene Ausprägungen von Resilienz:
- Die technische Resilienz wird als eine eher konservative Ausprägung des Resilienzkonzeptes gesehen. Gemeint ist die Fähigkeit eines Systems, externen Schocks und Einflüssen zu widerstehen und zu einem klar definierten Gleichgewichtszustand zurückzukehren.
- Die ökologische Resilienz ist deutlich dynamischer und geht von einem sich ständig ändernden Umfeld aus. Resilienz beschreibt hier ganz allgemein die Fähigkeit eines Systems, trotz dieser sich ständig ändernden Dynamiken zu bestehen und zu überleben.
- Die soziale Resilienz kann als genereller Umgang eines Systems mit Unsicherheiten gesehen werden. Dieser Ansatz geht davon aus, dass Unsicherheiten durch die Generierung neuen Wissens nicht reduzierbar sind.
- Die organisatorische Resilienz bezieht sich vor allem auf die Fähigkeit von Organisationen, in einem hochgradig dynamischen und riskanten Umfeld zu agieren, in dem schon kleinste Fehler und Unachtsamkeit katastrophale Folgen haben können (z.B. Raumfahrt, Flugzeugträger, Feuerwehren). (S. 71f)
Lukesch et al.. (2008) führen Resilienz auf das Zusammenspiel von sieben besonderen Eigenschaften bzw. Grundhaltungen zurück: (1) Optimismus, (2) Akzeptanz, (3) Lösungsorientierung, (4) Verlassen der Opferrolle, (5) Verantwortung übernehmen, (6) Netzwerkorientierung und (7) Zukunftsplanung.
Eine resilienzorientierte Strategie versucht durch Vorbereitung auf unerwartete und unvorhergesehene Ereignisse die Fähigkeit eines Akteurs oder Systems zu steigern. Eine solche Strategie setzt vor allem auf ein hohes Maß an Flexibilität. Dieses ist notwendig, da der jeweilige Kontext als dynamisch verstanden wird. Es wird davon ausgegangen, dass sich in einer unsicheren Zukunft nicht alle projizierten und erwarteten Entwicklungen realisieren (Felgentreff et al., 2012).
3.3.5 Resilienz und Nachhaltige Entwicklung
In jüngerer Zeit wird das Wort Resilienz vermehrt im Bereich der nachhaltigen Entwicklung eingesetzt (Held & Kümmerer, 2004; Kruse, 2009; Müller, 2011). Müller (2011) sieht Resilienz als das neue Schlagwort in der Diskussion zu Naturrisiken und Sozialkatastrophen schlechthin und meint weiters, dass das Wort Nachhaltigkeit durch das der Resilienz ersetzt werden könnte. Resilienz ist seiner Meinung nach auf internationaler Ebene besonders im Zusammenhang mit der Klimaveränderung ein prominentes Thema geworden. So stand der erste Weltkongress zur Anpassung von Städten an den Klimawandel in Bonn 2010, unter dem Motto „Resilient Cities“. Er wurde 2010 in Bonn abgehalten und von ICLEI, der weltweit größten Organisation in der sich Städte und Gemeinden für eine nachhaltige Entwicklung zusammengeschlossen haben, organisiert. Müller meint weiters, dass die Anfälligkeit für Krisen (Vulnerabilty) und Fähigkeit sich von Krisen oder Störungen zu erholen (Resilience) nicht nur Naturkatastrophen und den Klimawandel, sondern ganz besonders auch soziale Fragen betrifft. Er plädiert dafür, den Resilienzbegriff mehrdimensionaler und umfassender anzulegen und legt nahe, ihn in den Kontext der Nachhaltigkeit zu stellen. Unterstützt wird diese Sichtweise durch das Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, das 2010 unter dem Titel „die Resiliente Region“, auf eine breitere Perspektive dieses Zugangs hinweist. Es wird in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, Resilienz als den zentralen Schlüssel zu einer nachhaltigen Entwicklung zu sehen.
Deppisch und Schaerffer (2010) übertragen das Konzept der Resilienz auf die Stadtentwicklung und sehen es als eine Form des Krisenmanagements, insbesondere für große Städte an: „Großstädte zeigen eine außergewöhnliche Zahl von Komplexität in einem Netzwerk von ökologischen, sozialen, ökonomischen, kulturellen und politischen wechselseitigen Beziehungen“ (S. 25). Eine Folge davon ist, dass ihr Wachstum oder ihre Veränderungsprozesse eher auf chaostheoretischen Grundsätzen beruhen und damit immer weniger vorhersehbar werden. So lautet der Vorschlag der Autorinnen, eine nachhaltige Stadtentwicklung auf Basis eines Krisenmanagements anzugehen, d.h. Krisenpunkte ausfindig zu machen, daraus zu lernen und eine Strategie für das weitere Vorgehen zu entwerfen (vgl. S. 26).
Lukesch et al. (2010) haben ein Modell zur Steuerung von regionaler Resilienz entworfen und dazu Bewertungskriterien entwickelt. Dieses Modell besteht aus vier Komponenten und den ihnen zugeteilten Einflussfaktoren (S. 39 ff). Allen Einflussfaktoren werden „begünstigende Faktoren für regionale Resilienz“ zugeordnet.
Die vier Komponenten inklusive Einflussfaktoren sind:
(1) Die Nachhaltigkeitsdimensionen (Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft),
(2) die Steuerungsperspektiven (Strategie, Kooperation, Steuerungsstrukturen, Steuerungsprozesse, Lernen), (3) die Gestaltungsprinzipien (Diversität, Redundanz, Modularität, Feedback, Effizienz) und
(4) die Ausgleichsprinzipien (Soziale Kohäsion, Territoriale Kohäsion, Zukunftsfähigkeit).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine "Aktivierende Stadtdiagnose"?
Es ist ein organisationsdiagnostisches Verfahren zur Vorbereitung von Stadtentwicklungsprozessen, das auf umweltpsychologischen Konzepten und qualitativer Sozialforschung basiert.
Was unterscheidet dieses Verfahren von klassischer Organisationsdiagnostik?
Während klassische Diagnostik meist Betriebe untersucht, betrachtet die Stadtdiagnose die Gemeinde als "soziales Gemeinwesen" – also alle dort wohnenden und arbeitenden Menschen.
Welche Rolle spielt die Partizipation der Bürger?
Die Partizipation ist zentral. Durch qualitative Methoden wie Interviews und Workshops werden Bürger aktiv in die Diagnose von Ist-Zustand und Zukunftspotenzialen eingebunden.
Auf welchen theoretischen Grundlagen basiert die Methode?
Die Methode stützt sich auf die Aktionsforschung nach Kurt Lewin, die Grounded Theory, sowie Konzepte der Umwelt- und Gemeindepsychologie.
Was ist das Ziel des "Gemeindebefunds"?
Der Befund dient als wissenschaftliche Grundlage für den Gemeinderat, um zukunftsfähige und nachhaltige Entscheidungen für die Stadtentwicklung zu treffen.
- Quote paper
- Mag. Dr. Cornelia Ehmayer (Author), 2012, Die „Aktivierende Stadtdiagnose“ als eine besondere Form der Organisationsdiagnose., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264918