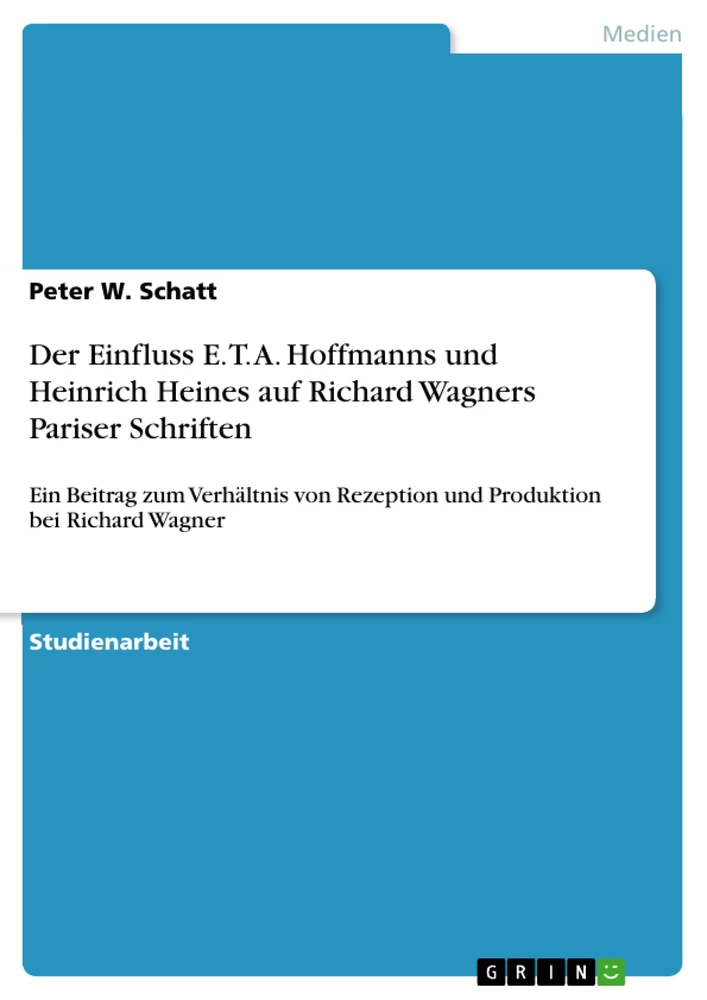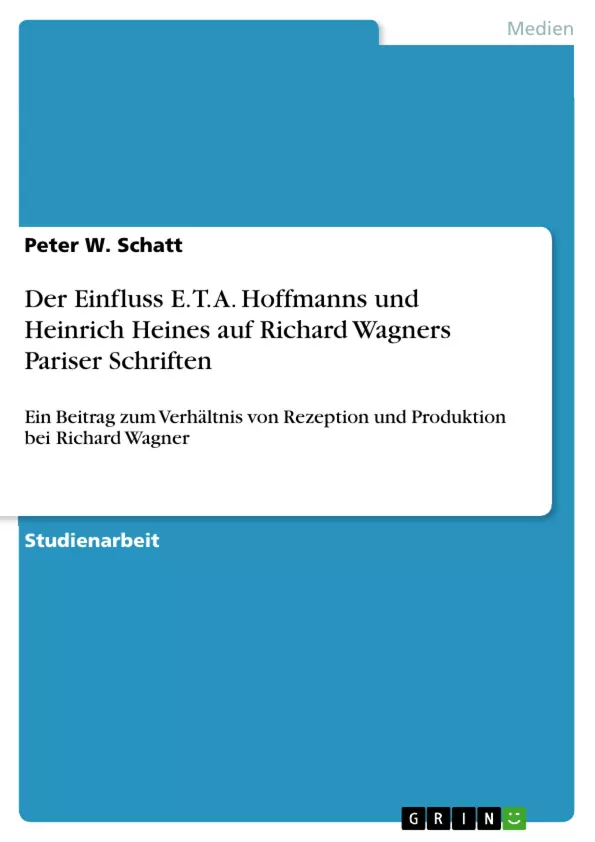Der Essay ist die überarbeitete Fassung eines Beitrags zum Hauptseminar von Carl Dahlhaus „Die Schriften Richard Wagners“ an der Technischen Universität Berlin aus dem Jahre 1983. Die Arbeit ist gleichwohl aktuell vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Universität Würzburg in diesem Jahr ein groß angelegtes Forschungsprojekt zu den Schriften Richard Wagners beginnt.
Am Beispiel der spezifischen Formen von Rezeption und Transformation der Werke E. T. A. Hoffmanns und Heinrich Heines, die an Wagners Pariser Schriften aufgezeigt werden, wird eine fundamentale Verarbeitungsweise Wagners mit vorliegenden Stoffen deutlich, die auch für die Texte seiner Opern bzw. Musikdramen wie für seine musikalische Produktionsweise relevant ist. Zugleich wird seine ästhetische Position als Ergebnis weniger einer philosophischen denn einer anthropologisch-persönlichen Reflexion charakterisiert: Zumindest in der Pariser Zeit ging es Wagner – was sich auch im Fliegenden Holländer abzeichnet – weniger um eine Musik- denn um eine Musiker-Ästhetik.
Inhalt
Vorbemerkung
1. Die Texte
1.1 Entstehung und Erstveröffentlichung
1.2 Selbsteinschätzung
2. Richard Wagners Vorbilder im Spiegel der autobiographischen Schriften
3. Der Einfluss E. T. A. Hoffmanns
3.1 Form
3.11 Rahmenhandlung
3.12 Kunstgespräch
3.2 Stoffe
3.3 Motive
3.4 Themen
3.5 Standpunkte
3.6 Stil
4. Der Einfluss Heinrich Heines
5. Zusammenfassung
6. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte E.T.A. Hoffmann auf Richard Wagner?
Wagner übernahm von Hoffmann formale Elemente wie die Rahmenhandlung und das Kunstgespräch sowie spezifische Stoffe und Motive für seine Schriften und Opern.
Was charakterisiert Wagners "Pariser Schriften"?
In diesen Texten zeigt sich eine Musiker-Ästhetik, die stärker auf anthropologisch-persönlicher Reflexion als auf reiner Philosophie basiert.
Welche Rolle spielt Heinrich Heine in Wagners Werk?
Heine beeinflusste Wagner vor allem in der Stoffwahl und der literarischen Transformation von Legenden, wie etwa beim "Fliegenden Holländer".
Wie verarbeitete Wagner seine literarischen Vorbilder?
Wagner nutzte spezifische Formen der Rezeption und Transformation, um fremde Stoffe in seine eigene ästhetische und musikalische Produktionsweise zu integrieren.
Sind Wagners autobiographische Schriften eine zuverlässige Quelle?
Die Arbeit untersucht Wagners Vorbilder im Spiegel seiner Autobiographien und zeigt auf, wie er seine Einflüsse selbst einschätzte und darstellte.
- Quote paper
- Peter W. Schatt (Author), 1983, Der Einfluss E. T. A. Hoffmanns und Heinrich Heines auf Richard Wagners Pariser Schriften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264930