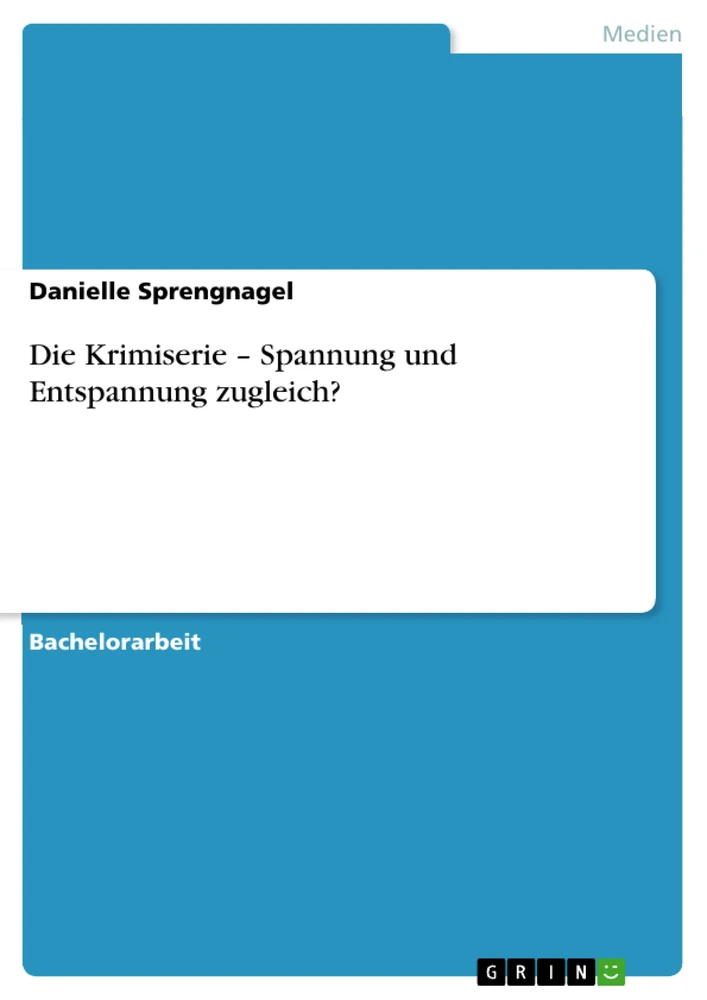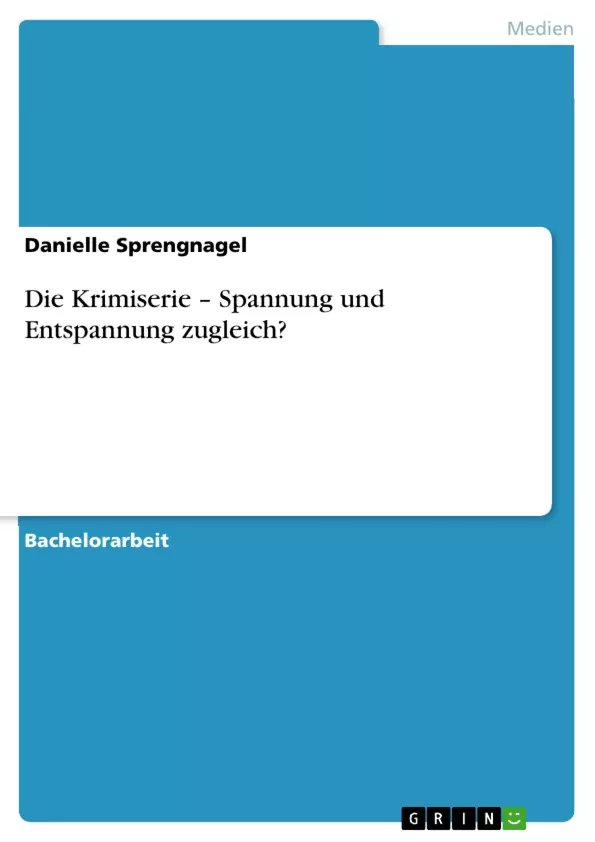Auffallend ist, dass sowohl im öffentlich rechtlichen als auch im privaten Fernsehen Krimiserien seit Jahrzehnten boomen und sich bei Jung und Alt an großer Beliebtheit erfreuen. „Weil der Krimi im Fernsehen so interessant für die Zuschauer ist, muss er es auch für die Wissenschaft sein“ meinte schon Viehoff in seinem Text „Der Krimi im Fernsehen“. Wenn ein Genre über seine inzwischen Jahrhunderte dauernde Gattungsgeschichte hinweg immer wieder diejenigen fasziniert und unterhält, die sich ihm zugewandt haben, dann muss daran etwas zu beobachten sein, was diesen Erfolg erklärt.
Ziel dieser Arbeit ist es, zu zeigen warum Krimiserien rezipiert werden, was den Reiz und vor allem die Faszination dieser Serien ausmacht und ob die vermehrte Rezeption Auswirkungen auf die SeherInnen haben kann.
Als theoretische Basis dienen der Uses-and-Gratifications-Ansatz, die Kultivierungsthese von George Gerbner, sowie das Vielsehersyndrom.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Die Krimiserie aus der Sicht der Fernsehmacher
- 1.2 Die Krimiserie aus der Sicht der RezipientInnen
- 2. Theoretische Basis
- 2.1 Die Krimiserie und ihre Faszination
- 2.2 Die Nutzung von Krimiserien
- 2.2.1 Der Uses-and-Gratifications-Ansatz im Bezug auf Krimiserien
- 2.2.2 Die Krimiserie - Erregung und Entspannung zugleich
- 2.3 Die Wirkung von Krimiserien
- 2.3.1 Das Fernsehen als Sündenbock
- 2.3.2 Die Kultivierungsthese im Kontext der Krimiserie
- 2.3.3 Vielseher und ihre Welt
- 3. Empirischer Teil
- 3.1 Vorstellen der Forschungsfrage zur Krimi-Rezeption
- 3.2 Erhebungsinstrument
- 3.3 Forschungsergebnisse
- 4. Resümee
- 5. Quellenverzeichnis
- 5.1 Literaturverzeichnis
- 5.2 Internetquellen
- 6. Anhang
- 6.1 Fragebogen
- 6.2 Kreuztabellen Einstellungsfragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rezeption von Krimiserien im Fernsehen. Ziel ist es, die Faszination dieses Genres zu erklären und mögliche Auswirkungen auf die Zuschauer zu beleuchten. Die theoretische Basis bilden der Uses-and-Gratifications-Ansatz, die Kultivierungsthese und das Vielsehersyndrom.
- Rezeptionsmotive für Krimiserien
- Faszination und Reiz von Krimiserien
- Mögliche Auswirkungen der Krimi-Rezeption auf die Zuschauer
- Der Uses-and-Gratifications-Ansatz im Kontext von Krimiserien
- Die Kultivierungsthese und das Vielsehersyndrom im Bezug auf Krimiserien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die hohe Popularität von Krimiserien im deutschen Fernsehen fest und thematisiert die Perspektiven der Fernsehmacher und des Publikums. Sie fokussiert auf die Rezeption der Serien und deren Auswirkungen auf die Zuschauer, wobei der Fokus im Hauptteil auf der Perspektive des Publikums liegt. Die Einleitung legt den Grundstein für die Forschungsfrage, die im empirischen Teil behandelt wird. Der hohe Anteil von Krimiserien im Fernsehprogramm wird durch Zahlen belegt und die Notwendigkeit ihrer wissenschaftlichen Untersuchung unterstrichen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Rezeption von Krimiserien im Fernsehen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeption von Krimiserien im deutschen Fernsehen. Sie beleuchtet die Faszination dieses Genres und mögliche Auswirkungen auf die Zuschauer.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den Uses-and-Gratifications-Ansatz, die Kultivierungsthese und das Vielsehersyndrom, um die Rezeption und Wirkung von Krimiserien zu analysieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Rezeptionsmotive, die Faszination von Krimiserien, mögliche Auswirkungen auf Zuschauer, den Uses-and-Gratifications-Ansatz im Kontext von Krimiserien, sowie die Kultivierungsthese und das Vielsehersyndrom in Bezug auf Krimiserien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretische Basis, Empirischer Teil, Resümee, Quellenverzeichnis und Anhang. Die Einleitung stellt die hohe Popularität von Krimiserien fest und führt in die Forschungsfrage ein. Der theoretische Teil behandelt die genannten Ansätze. Der empirische Teil präsentiert die Forschungsfrage, das Erhebungsinstrument und die Ergebnisse. Das Resümee fasst die Ergebnisse zusammen. Das Quellenverzeichnis und der Anhang beinhalten Literatur, Internetquellen, Fragebogen und Kreuztabellen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beschreibt die Popularität von Krimiserien im deutschen Fernsehen aus der Sicht der Fernsehmacher und des Publikums. Sie fokussiert auf die Rezeption und deren Auswirkungen auf die Zuschauer und legt den Grundstein für die Forschungsfrage, die im empirischen Teil beantwortet wird.
Was beinhaltet der empirische Teil?
Der empirische Teil umfasst die Vorstellung der Forschungsfrage zur Krimi-Rezeption, die Beschreibung des Erhebungsinstruments (vermutlich ein Fragebogen, siehe Anhang) und die Präsentation der Forschungsergebnisse.
Was ist im Anhang enthalten?
Der Anhang enthält den verwendeten Fragebogen und Kreuztabellen zu den Einstellungsfragen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit enthält ein Literaturverzeichnis und eine Auflistung der genutzten Internetquellen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Faszination des Genres Krimiserie zu erklären und mögliche Auswirkungen auf die Zuschauer zu beleuchten.
- Citation du texte
- Danielle Sprengnagel (Auteur), 2012, Die Krimiserie – Spannung und Entspannung zugleich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265063