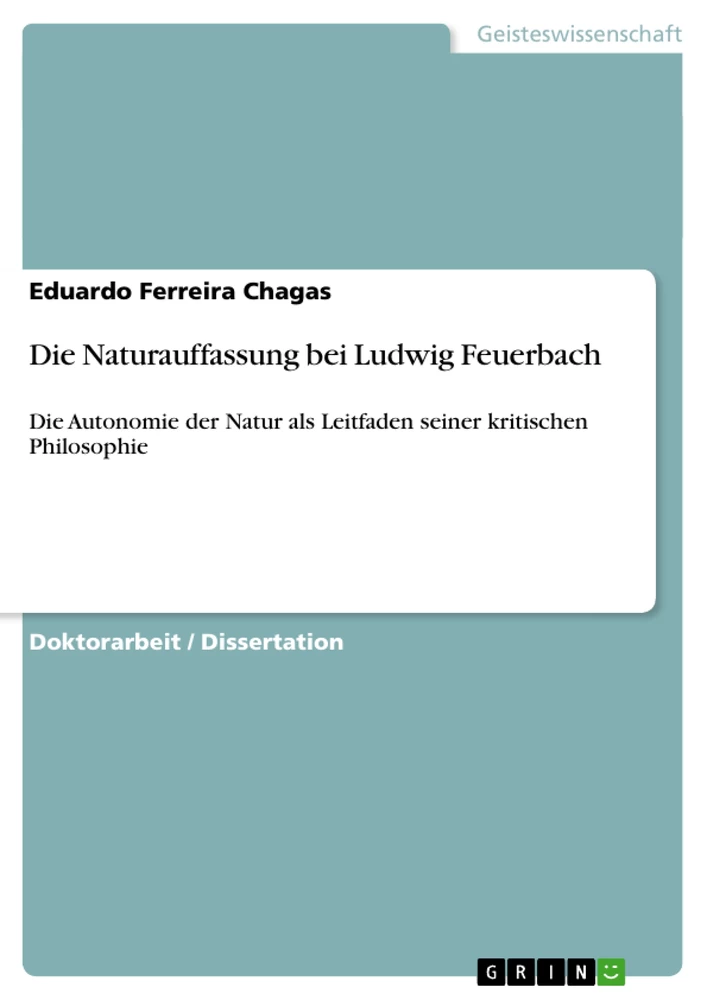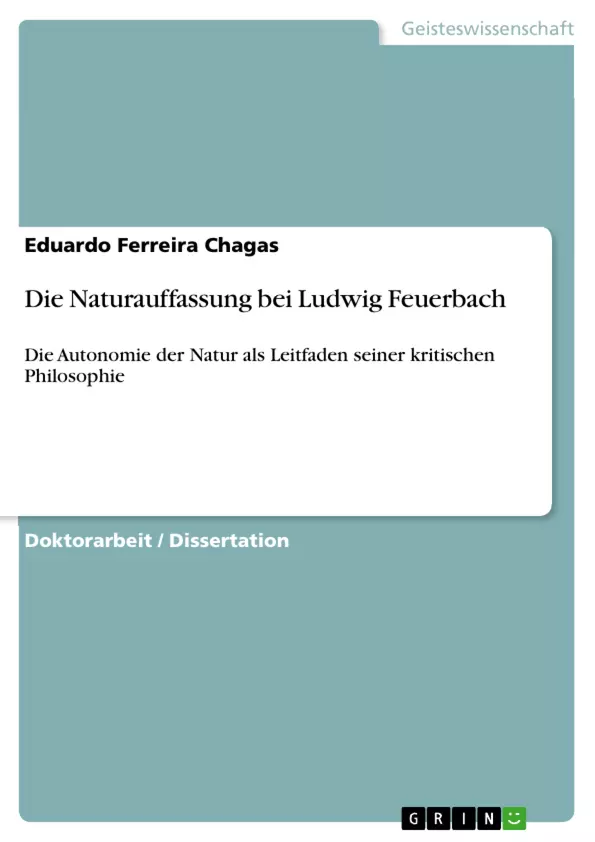Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, das Denken Feuerbachs mittels des Postulats der Naturautonomie zu rekonstruieren. Eben deswegen hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung, den Wandel und die Relevanz dieses Postulats innerhalb seiner Philosophie aufzuzeigen. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass Feuerbachs Reflexion auf die selbständige, unabhängig vom menschlichen Bewusstsein existierende Natur als Korrektiv der Religion und der spekulativen Philosophie gelten kann, denn beide sind in Bezug auf die Natur defizitär. Theismus und Idealismus verkennen vollständig die Unabhängigkeit der Natur, weil sie sich die Natur entweder lediglich als Werk eines Schöpfers oder als bloße Entfaltung der Tätigkeit des Geistes vorstellen. Feuerbach lehnt sowohl den Theismus als auch den Idealismus ab, und macht gegenüber beiden Positionen geltend, dass die Natur das Original, das Unabgeleitete, das Objektive, das Notwendige bzw. das aus sich alles Hervorbringende ist, und darum kann sie weder als göttlich, noch als menschlich verstanden werden; sie existiert vielmehr aus sich heraus und hat ihren Sinn nur in sich selbst, d.h. sie ist sie selbst, hinter ihr verbirgt sich kein mystisches Wesen. Diese Naturauffassung Feuerbachs zieht sich gewissermaßen als „roter Faden“ durch seine ganze Philosophie und liefert nicht nur den Grund seiner Kritik am Theismus und Idealismus, sondern später auch die materielle Basis seiner Ethik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel I: Die Naturproblematik beim jungen Feuerbach
- 1.1 Feuerbachs Naturkonzeption im Rahmen des Pantheismus
- 1.2 Der panlogistische Idealismus Feuerbachs - Die allgemeine Vernunft als Basis der Einheit von Mensch und Natur
- 1.3 Die Wende zur Natur - Die Natur als Ausdruck des Lebens und des Todes
- 1.4 Der Weg von der Natur zum Geist als Idealisierung derselben
- 1.5 Die Zurücknahme des Dualismus von Geist und Natur
- 1.5.1 Der Blick Feuerbachs auf die neuzeitliche Naturphilosophie in der Schrift „Geschichte der neuern Philosophie von Bacon von Verulam bis Benedikt Spinoza“
- 1.5.2 Spinoza: Gott und Natur - Dualismus oder Einheit?
- 1.5.3 Feuerbachs Interpretation des Leibnizschen Prinzips der Selbsttätigkeit der Monade als Vorstellung der Einheit von Geist und Materie
- Kapitel II: Feuerbachs Sicht der Natur in Auseinandersetzung mit der spekulativen Philosophie und der christlichen Theologie
- 2.1 Die Reaktion auf Hegel - Die Kritik des dialektischen Weges des Denkens
- 2.2 Feuerbachs Beitrag zu einer Reform und Erneuerung der Philosophie
- 2.3 Die Umkehrung des abstrakten Denkens auf die Natur und die menschliche Wirklichkeit
- 2.4 Die Rehabilitation der Sinnlichkeit als Brücke zwischen Mensch und Natur
- 2.5 Die Naturfeindlichkeit des Christentums
- Kapitel III: Die Natur als materielle Basis der Ethik - Zum Zusammenhang zwischen Notwendigkeit und Freiheit in den Spätwerken Feuerbachs
- 3.1 Der Werdegang des Denkens Feuerbachs - Seine Zuflucht zur Natur
- 3.2 Die Priorität, Unabhängigkeit und Selbständigkeit der Natur
- 3.3 Das Abhängigkeitsgefühl des Menschen gegenüber der Natur
- 3.3.1 Der Egoismus als positive Bejahung des Menschen
- 3.3.2 Die Natur als ein sichtbares, sinnliches Seiendes
- 3.3.3 Feuerbachs Kritik an der teleologischen Naturauffassung
- 3.3.4 Die Humanisierung der Natur
- 3.4 Der Wille innerhalb der Grenzen der Natur
- 3.5 Der Glückseligkeitstrieb als Gegenstand des Willens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ludwig Feuerbachs Naturauffassung, einen bis heute wenig erforschten Aspekt seiner Philosophie. Die zentrale These ist, dass Feuerbachs Betonung der Autonomie der Natur als Korrektiv zu Religion und Spekulation dient. Die Arbeit analysiert die Entwicklung von Feuerbachs Naturverständnis, indem sie verschiedene Phasen seines Werkes betrachtet und die Zusammenhänge zwischen seinen naturphilosophischen Ansätzen und seiner Kritik an Hegel und dem Christentum aufzeigt.
- Entwicklung von Feuerbachs Naturverständnis über die Zeit
- Feuerbachs Kritik an Hegels dialektischem Denken und dessen Auswirkungen auf seine Naturauffassung
- Der Zusammenhang zwischen Feuerbachs Naturphilosophie und seiner Ethik
- Die Rolle der Sinnlichkeit in Feuerbachs Verständnis der Beziehung zwischen Mensch und Natur
- Feuerbachs Auseinandersetzung mit dem Pantheismus und seine Kritik am Christentum im Kontext seiner Naturphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I: Die Naturproblematik beim jungen Feuerbach: Dieses Kapitel beleuchtet Feuerbachs frühe Auseinandersetzung mit dem Naturbegriff, insbesondere im Kontext des Pantheismus und des panlogistischen Idealismus. Es analysiert seinen Versuch, den Dualismus von Geist und Natur zu überwinden, und seine Interpretation von Denkern wie Spinoza und Leibniz. Die Entwicklung seiner Denkweise, beginnend mit pantheistischen Ansätzen und endend mit einer stärkeren Betonung der Naturselbstständigkeit wird detailliert nachgezeichnet. Feuerbachs Auseinandersetzung mit der neuzeitlichen Naturphilosophie wird anhand konkreter Beispiele aus seinen Schriften beleuchtet, um den Wandel in seinem Denken zu veranschaulichen.
Kapitel II: Feuerbachs Sicht der Natur in Auseinandersetzung mit der spekulativen Philosophie und der christlichen Theologie: Hier wird Feuerbachs Kritik an Hegel und der spekulativen Philosophie im Hinblick auf seine Naturphilosophie untersucht. Das Kapitel zeigt auf, wie Feuerbach eine „Umkehrung des abstrakten Denkens“ fordert, um die Natur und die menschliche Wirklichkeit angemessen zu erfassen. Seine Rehabilitation der Sinnlichkeit als Brücke zwischen Mensch und Natur wird eingehend diskutiert, ebenso wie seine scharfe Kritik an der vermeintlichen Naturfeindlichkeit des Christentums. Die Analyse verdeutlicht, wie Feuerbach seine Philosophie als Reform und Erneuerung des philosophischen Denkens versteht, das auf eine authentische Beziehung zwischen Mensch und Natur abzielt.
Kapitel III: Die Natur als materielle Basis der Ethik - Zum Zusammenhang zwischen Notwendigkeit und Freiheit in den Spätwerken Feuerbachs: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Feuerbachs Spätwerk und untersucht, wie er die Natur als materielle Grundlage der Ethik begreift. Es analysiert den Zusammenhang zwischen Notwendigkeit und Freiheit im Verhältnis des Menschen zur Natur. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Aspekten wie dem menschlichen Abhängigkeitsgefühl von der Natur, dem Egoismus als positive Kraft und Feuerbachs Kritik an einer teleologischen Naturauffassung. Die "Humanisierung der Natur" wird als zentrales Element seiner Ethik interpretiert. Die Kapitel analysiert die Entwicklung Feuerbachs Denkens und seine letztendliche Hinwendung zur Natur als essentiellen Aspekt seiner Philosophie.
Schlüsselwörter
Ludwig Feuerbach, Naturphilosophie, Pantheismus, Hegelkritik, Christentumskritik, Sinnlichkeit, Autonomie der Natur, Ethik, Materialismus, Dialektik, Selbständigkeit der Natur, Humanisierung der Natur.
Häufig gestellte Fragen zu: Ludwig Feuerbachs Naturauffassung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Ludwig Feuerbachs Naturauffassung, einen bis heute wenig erforschten Aspekt seiner Philosophie. Die zentrale These ist, dass Feuerbachs Betonung der Autonomie der Natur als Korrektiv zu Religion und Spekulation dient. Die Arbeit analysiert die Entwicklung seines Naturverständnisses über verschiedene Phasen seines Werkes und die Zusammenhänge zwischen seinen naturphilosophischen Ansätzen und seiner Kritik an Hegel und dem Christentum.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln:
Kapitel I: Die Naturproblematik beim jungen Feuerbach: Dieses Kapitel beleuchtet Feuerbachs frühe Auseinandersetzung mit dem Naturbegriff im Kontext des Pantheismus und des panlogistischen Idealismus. Es analysiert seinen Versuch, den Dualismus von Geist und Natur zu überwinden, und seine Interpretation von Denkern wie Spinoza und Leibniz. Der Wandel in seinem Denken von pantheistischen Ansätzen hin zu einer stärkeren Betonung der Naturselbstständigkeit wird detailliert nachgezeichnet.
Kapitel II: Feuerbachs Sicht der Natur in Auseinandersetzung mit der spekulativen Philosophie und der christlichen Theologie: Hier wird Feuerbachs Kritik an Hegel und der spekulativen Philosophie im Hinblick auf seine Naturphilosophie untersucht. Es wird gezeigt, wie Feuerbach eine „Umkehrung des abstrakten Denkens“ fordert, um Natur und menschliche Wirklichkeit angemessen zu erfassen. Seine Rehabilitation der Sinnlichkeit als Brücke zwischen Mensch und Natur und seine Kritik an der Naturfeindlichkeit des Christentums werden diskutiert.
Kapitel III: Die Natur als materielle Basis der Ethik - Zum Zusammenhang zwischen Notwendigkeit und Freiheit in den Spätwerken Feuerbachs: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Feuerbachs Spätwerk und untersucht die Natur als materielle Grundlage der Ethik. Es analysiert den Zusammenhang zwischen Notwendigkeit und Freiheit im Verhältnis des Menschen zur Natur. Die Bedeutung des menschlichen Abhängigkeitsgefühls von der Natur, des Egoismus als positive Kraft und Feuerbachs Kritik an einer teleologischen Naturauffassung werden behandelt. Die "Humanisierung der Natur" wird als zentrales Element seiner Ethik interpretiert.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: die Entwicklung von Feuerbachs Naturverständnis über die Zeit, seine Kritik an Hegels dialektischem Denken und dessen Auswirkungen auf seine Naturauffassung, den Zusammenhang zwischen Feuerbachs Naturphilosophie und seiner Ethik, die Rolle der Sinnlichkeit in Feuerbachs Verständnis der Beziehung zwischen Mensch und Natur und Feuerbachs Auseinandersetzung mit dem Pantheismus und seine Kritik am Christentum im Kontext seiner Naturphilosophie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ludwig Feuerbach, Naturphilosophie, Pantheismus, Hegelkritik, Christentumskritik, Sinnlichkeit, Autonomie der Natur, Ethik, Materialismus, Dialektik, Selbständigkeit der Natur, Humanisierung der Natur.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass Feuerbachs Betonung der Autonomie der Natur als Korrektiv zu Religion und Spekulation dient.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für die Philosophie Ludwig Feuerbachs, insbesondere für seinen Naturbegriff, interessieren. Sie richtet sich an Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich mit den philosophischen Fragen der Beziehung zwischen Mensch und Natur auseinandersetzen.
- Quote paper
- Doutor em Filosofia Eduardo Ferreira Chagas (Author), 2013, Die Naturauffassung bei Ludwig Feuerbach, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265068