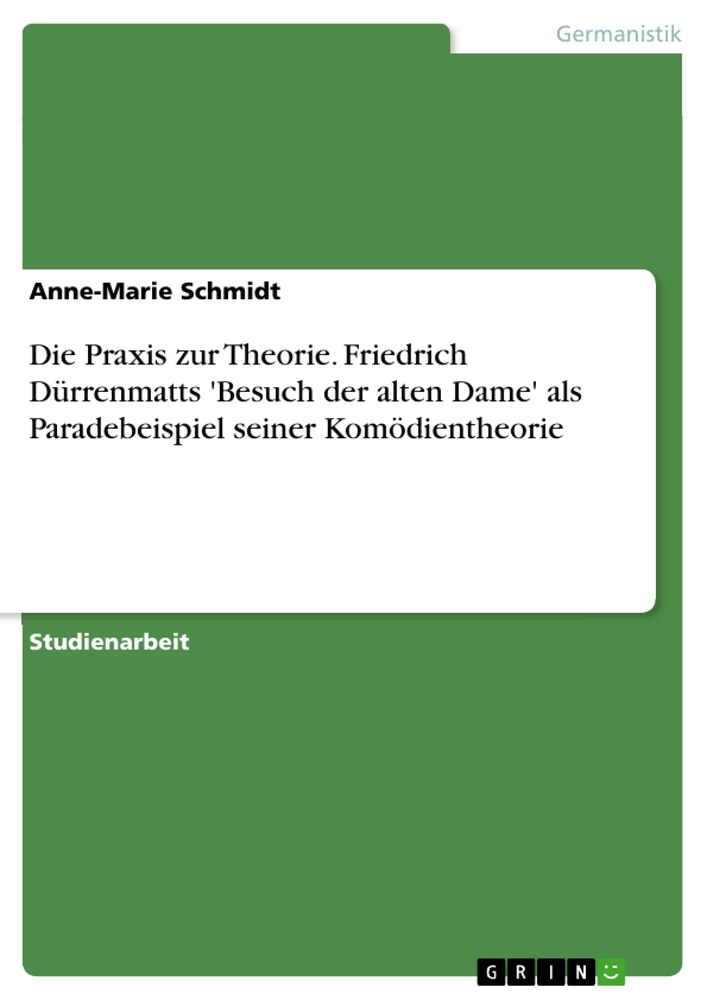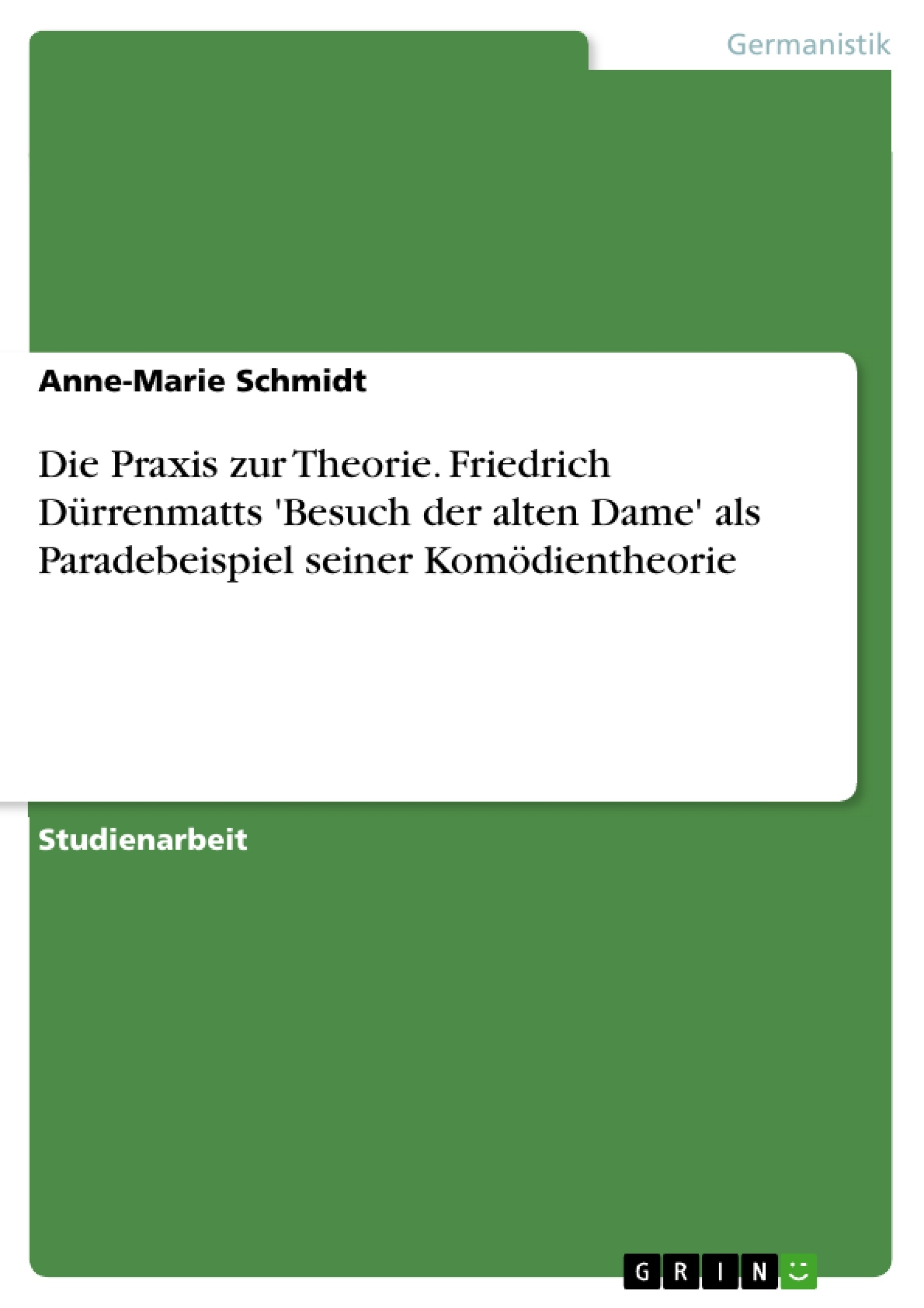Diese Arbeit möchte die von Friedrich Dürrenmatt aufgestellten Thesen seiner Komödientheorie am Beispiel seines Werkes Der Besuch der alten Dame untersuchen. In der 1955 im Schauspielhaus Zürich uraufgeführten Komödie kommen seine in den beiden Aufsätzen Theaterprobleme und Anmerkung zur Komödie aufgestellten Thesen meisterhaft zur Anwendung. Dabei soll auch auf die Behauptung von der Unmöglichkeit der Tragödie und die Abgrenzung seiner Theatertheorie von Bertolt Brechts epischen Theaters eingegangen werden. In einer anschließenden Interpretation des Stücks werden die Theorien dann auf die unterschiedlichen Situationen und Gegebenheiten der Komödie, die im zerfallenen Güllen spielt, angewendet. Das letzte Kapitel wird eine Analyse der potentiellen Wirkung auf das Publikum, die das Stück birgt, enthalten.
Die perfekt inszenierte Illusion einer heilen und realen Welt wird einschlägig mit Claires grotesker Erscheinung und absurden Angebot gestört. Die Zuschauer beobachten nun aus der Distanz heraus Ills schweren Weg zur Erkenntnis seiner Schuld und seinen tragischen Tod. „Das Subjekt hat […] Gerechtigkeit zu seiner eigenen Sache zu machen“, denn die bestehenden Institutionen (Bürgermeister, Polizist, Lehrer, Arzt und Pfarrer) können keine Gerechtigkeit mehr schaffen, da sie sich anpassen, um im Strom der Zeit mitzuschwimmen. Dürrenmatt lässt am Ende offen, wie es mit den Güllenern weitergeht und genauso steht am Ende die offene Frage, ob der Zuschauer die durchaus versteckte Lehre in der Komödie erkennt und sie in dieser chaotischen und ungeordneten Welt für sich nutzen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung — Problemstellung und Zielsetzung
- Dürrenmatts Theatertheorie
- Die Unmöglichkeit der Tragödie
- Dürrenmatts Komödie
- Die Abgrenzung von Brechts Theorie des epischen Theaters
- Das Paradebeispiel „Der Besuch der alten Dame"
- Die Experimentieranordnung
- Die Entscheidung
- Der Kollektivmord
- Die Rechtfertigung der Gerechtigkeit
- Die Zukunft Güllens
- Wirkungsabsicht
- Zusammenfassung
- Kommentierte Bibliografie
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit von Anne-Marie Schmidt analysiert Friedrich Dürrenmatts Komödientheorie anhand seines Werkes „Der Besuch der alten Dame". Die Arbeit untersucht, wie Dürrenmatts Thesen in der Komödie zur Anwendung kommen und wie sie sich von Bertolt Brechts epischem Theater abgrenzen. Die Arbeit interpretiert das Stück und analysiert die potentielle Wirkung auf das Publikum.
- Die Unmöglichkeit der Tragödie in der heutigen Zeit
- Die Rolle der Komödie als Theaterform, die Distanz schafft und die chaotische Welt reflektiert
- Die Bedeutung des Einfalls und der Groteske in Dürrenmatts Komödie
- Der moralische Zerfall der Stadt Güllen und die Kapitulation der Bürger gegenüber der Verlockung des Geldes
- Die Folgen des Kollektivmords für die Zukunft Güllens und die junge Generation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit vor. Die Arbeit möchte Dürrenmatts Komödientheorie am Beispiel seines Werkes „Der Besuch der alten Dame" untersuchen.
Das Kapitel „Dürrenmatts Theatertheorie" erläutert Dürrenmatts Ansicht, dass die Tragödie in der heutigen Zeit unmöglich ist, da die Welt zu chaotisch und die Gesellschaft zu anonym geworden ist. Die Komödie hingegen kann Distanz schaffen und die Welt reflektieren, indem sie eine scheinbar normale Wirklichkeit darstellt und diese dann mit grotesken Elementen zerstört. Dürrenmatt grenzt seine Theorie deutlich von Brechts epischem Theater ab, das die Wirklichkeit entfremden und nachbilden möchte. Dürrenmatt hingegen zeigt Alternativen zur Realität auf und will dem Zuschauer die Welt darstellen, nicht erklären.
Das Kapitel „Das Paradebeispiel „Der Besuch der alten Dame"“ analysiert das Stück anhand von Dürrenmatts Komödientheorie. Die Experimentieranordnung des Stücks zeigt, wie Claire Zachanassian, die ehemalige Bürgerin Güllens, die Stadt mit einem grotesken Angebot konfrontiert: Sie bietet den Güllenern eine Milliarde, wenn sie ihren Jugendliebe Alfred Ill ermorden. Die Stadtbewohner müssen sich entscheiden, ob ihnen christliche Werte und Moralvorstellungen wichtiger sind als materieller Wohlstand. Die Entscheidung des Bürgermeisters und der anderen Vertreter der Gemeindebehörden für das Geld zeigt den moralischen Zerfall der Stadt. Die Güllener entwickeln sich von einem Stadtvolk mit humanistischen Überzeugungen zu einer käuflichen Kollektivmasse, die dem Ruf des Geldes folgt.
Im Kapitel „Der Kollektivmord" wird Dürrenmatts These von den fehlenden Schuldigen und Verantwortlichen in der heutigen Zeit untersucht. Die Güllener werden von Claire geeint, da sie ihnen ein gemeinsames Interesse aufzeigen: das Geld. Der kollektiv begangene Mord an Ill zeigt die archaische Gewalt, die im modernen Kapitalismus verborgen liegt. Ills Tod ist sinnvoll, da er seine Schuld anerkennt, aber sinnlos, da er die gestörte Ordnung nicht wieder herstellen kann und die Gesellschaft keine Veränderung erfährt.
Das Kapitel „Die Rechtfertigung der Gerechtigkeit" analysiert die abstrusen Erklärungen der Güllener, mit denen sie Ills Ermordung als gerecht rechtfertigen. Die Stadtbewohner stemmen sich vehement dagegen, die Wahrheit zu erkennen. Sie sehen Claire nicht als Rachegöttin, sondern als Wohltäterin, die ihnen Wohlstand bringt. Die Güllener haben ihre eigenen moralischen Werte zugunsten des Geldes aufgegeben und sind blind für die wahren Hintergründe der Ereignisse.
Das Kapitel „Die Zukunft Güllens" untersucht die fatalen Folgen des moralischen Zerfalls für die junge Generation. Der Lehrer, der die Ideale der Güllener vertritt, hat sich der Verführung des Geldes hingegeben und die kommende Generation wird mit falschen Wertvorstellungen aufwachsen. Ills Kinder, die bereits von Claire gelernt haben, sind von der Konsumkultur geblendet und kennen keine Zugehörigkeit mehr zur Familie. Sie haben ihre Ideale zugunsten des materiellen Wohlstands aufgegeben.
Das Kapitel „Wirkungsabsicht" analysiert die potentielle Wirkung des Stücks auf das Publikum. Dürrenmatt möchte mit Hilfe der Komödie und deren „Mausefalle" das Publikum überführen. Der Zuschauer soll die Scheinheiligkeit der Güllener erkennen und sich mit der Wahrheit auseinandersetzen. Die Frage ist, ob der Zuschauer die ethische Größe Ills erkennt oder ob für ihn der Mord Mittel zum Zweck bleibt. Dürrenmatt möchte den Zuschauer nicht zum Handeln zwingen, sondern ihn vor das Geschehen stellen und ihn zum Nachdenken anregen.
Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Punkte der Arbeit zusammen und bekräftigt die These, dass Dürrenmatts Komödie „Der Besuch der alten Dame" ein Paradebeispiel für die Anwendung seiner Komödientheorie ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Komödientheorie Friedrich Dürrenmatts, das Werk „Der Besuch der alten Dame“, die Unmöglichkeit der Tragödie, die Rolle der Komödie als Distanz schaffende Theaterform, der moralische Zerfall der Stadt Güllen, die Verlockung des Geldes, der Kollektivmord, die Rechtfertigung der Gerechtigkeit, die Folgen für die junge Generation und die potentielle Wirkung des Stücks auf das Publikum. Die Arbeit beleuchtet die Kritik Dürrenmatts an der modernen Gesellschaft und ihren Werten, die durch den Aufstieg des Kapitalismus und die Verführung des Geldes gefährdet sind.
- Citar trabajo
- Anne-Marie Schmidt (Autor), 2013, Die Praxis zur Theorie. Friedrich Dürrenmatts 'Besuch der alten Dame' als Paradebeispiel seiner Komödientheorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265084