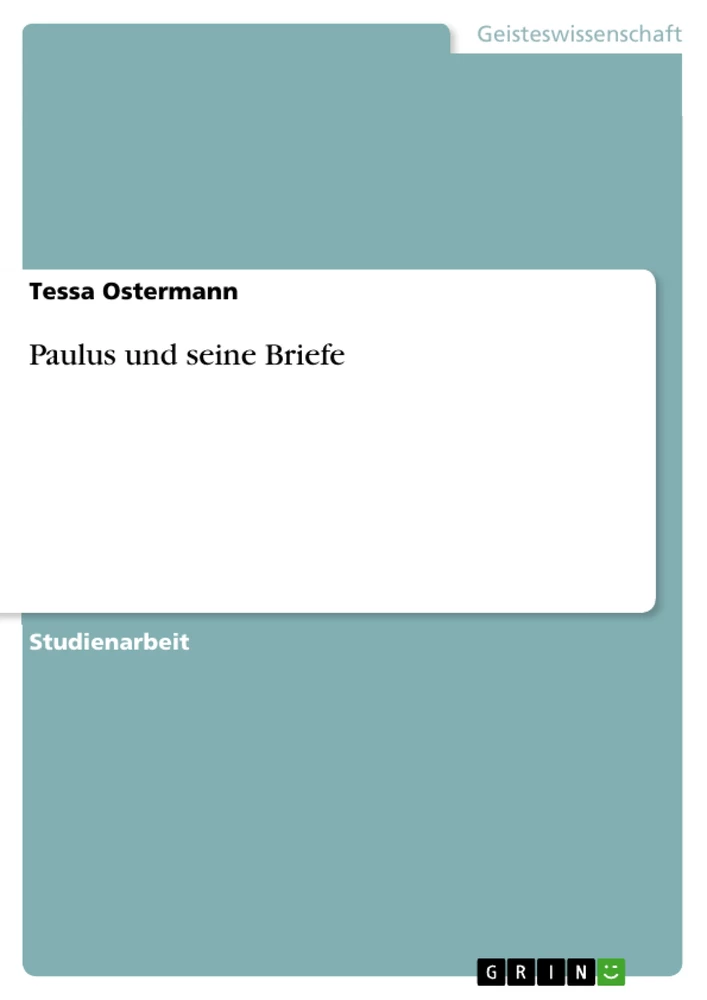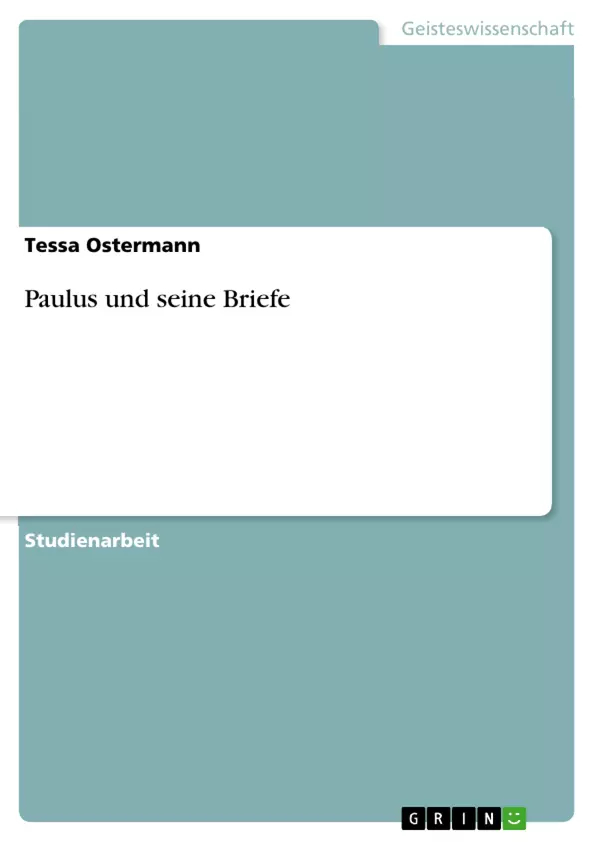"Da sind weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid eins in Chistus Jesus.“(Gal 3,28)
In der folgenden Ausarbeitung stelle ich „Paulus und seine Briefe“ vor. Grundlegend beziehe ich mich in meiner Arbeit auf die Mitschriften der Vorlesung aus dem WS 2011/12 von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Weiß: „Paulus und seine Briefe“, die Mitschriften aus dem Seminar „Paulus - Leben und Werk“ von Frau Silke Polewka, die Mitschriften aus dem Tutorium zu „Paulus und seine Briefe“ von Frau Sabine Bosse sowie auf die Zürcher Bibel von 2007.
Der Schwerpunkt meiner Ausarbeitung liegt vor allem auf den Briefen des Paulus. Diese werde ich im weiteren Verlauf meiner Arbeit zuerst unter dem Aspekt des Briefaufbaus untersuchen, vorab in der allgemeinen Form und später in Bezug auf jeden der authentischen Briefe des Paulus. Des Weiteren werde ich den Briefaufbau spezifisch mit dessen Inhalten untermauern, um letztendlich Schlüsse auf die theologischen Ausführungen nehmen zu können. Außerdem werden die echten von den unechten Briefen des Paulus abgegrenzt. Der Vollständigkeit des Schwerpunktes halber, habe ich den Philemon (Phlm) mit den Mitschriften des Seminars bearbeitet, da dieser nicht in der Vorlesung behandelt wurde. Ebenfalls habe ich den Röm komplett nach meiner Aufteilung - Inhalt, Briefaufbau, Theologie - bearbeitet, trotz der unvollständigen Bearbeitung in der Vorlesung.
Ein weiterer Berarbeitungspunkt ist die Person des Paulus. Hierbei finden seine Funktion und seine Chronologie besondere Beachtung. Außerdem werde ich das Werk des Paulus kurz zusammenfassen. Um berufsfeldbezogen zu argumentieren, werde ich unter Zuhilfenahme des Niedersächsischen Kercurriculums für Evangelische Theologie zuerst die Einbettung des Paulus im Lehrplan und danach die Umsetzung im Unterricht beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Person Paulus
- Die Briefe des Paulus
- Briefaufbau
- Die authentischen Briefe
- Der erste Brief an die Thessalonicher
- Briefaufbau
- Theologie
- Der Brief an die Galater
- Briefaufbau
- Theologie
- Der Brief an die Philipper
- Briefaufbau
- Theologie
- Der Brief an Philemon
- Briefaufbau
- Theologie
- Der erste Brief an die Korinther
- Briefaufbau
- Theologie
- Der zweite Brief an die Korinther
- Briefaufbau
- Theologie
- Der Brief an die Römer
- Briefaufbau
- Theologie
- Der erste Brief an die Thessalonicher
- Die deuteropaulinen und die Pastoralbriefe
- Paulus in der Schule
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung präsentiert eine Analyse von Paulus und seinen Briefen, mit dem Fokus auf den Aufbau und die Theologie der authentischen Briefe. Die Arbeit untersucht die Person Paulus, seine Chronologie und sein Werk. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einbettung des Paulus im evangelisch-theologischen Lehrplan und dessen Umsetzung im Unterricht.
- Der Aufbau der paulinischen Briefe
- Die theologischen Aussagen in den Briefen des Paulus
- Die Person und Chronologie des Paulus
- Das Gesamtwerk des Paulus
- Die didaktische Relevanz des Paulus im Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Umfang und die Methodik der Arbeit, die sich auf Vorlesungs- und Seminarmitschriften sowie die Zürcher Bibel stützt. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Aufbaus und der Theologie der Briefe des Paulus, mit besonderer Berücksichtigung der authentischen Briefe und der Abgrenzung zu den unechten. Der Brief an Philemon und der Römerbrief werden trotz unvollständiger Behandlung in der Vorlesung eingehender behandelt, um die Vollständigkeit zu gewährleisten. Die Arbeit betrachtet zusätzlich die Person des Paulus, seine Chronologie und sein Werk, sowie dessen didaktische Relevanz im Religionsunterricht.
Die Person Paulus: Dieses Kapitel befasst sich mit der Person des Paulus, seinem Ursprung in einer gläubigen Familie, seinem Namen (Saulus/Paulus) und dessen Bedeutung im Kontext des Stammes Benjamin. Es beschreibt seinen Beruf als Zeltmacher, seinen Bildungsstand und seine Identität als Pharisäer und Jude, untermauert durch Textbelege aus der Apostelgeschichte und den Paulusbriefen. Die Bedeutung seiner jüdischen Identität und seines römischen Namens wird im Kontext seiner vielfältigen Wirkungsweise hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Paulus, Briefe, Briefaufbau, Theologie, Chronologie, Authentizität, Jüdische Identität, Römische Kultur, Didaktik, Religionsunterricht, Evangelische Theologie, Neutestamentliche Forschung.
FAQ: Analyse der Briefe des Paulus
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Analyse des Apostels Paulus und seiner Briefe. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Aufbau und der Theologie der authentischen Briefe des Paulus, seiner Person, Chronologie und seinem Gesamtwerk sowie dessen didaktischer Relevanz im evangelisch-theologischen Unterricht.
Welche Briefe des Paulus werden behandelt?
Die Arbeit behandelt ausführlich die als authentisch geltenden Briefe des Paulus. Dies beinhaltet unter anderem den ersten Thessalonicherbrief, den Galaterbrief, den Philipperbrief, den Brief an Philemon, den ersten und zweiten Korintherbrief und den Römerbrief. Zusätzlich werden die deuteropaulinen und Pastoralbriefe erwähnt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung, Die Person Paulus, Die Briefe des Paulus (inkl. detaillierter Betrachtung einzelner Briefe und deren Aufbau und Theologie), Paulus in der Schule und Schlussbemerkung. Jedes Kapitel behandelt relevante Aspekte wie Briefaufbau, Theologie, Chronologie und didaktische Implikationen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Aufbau und die Theologie der paulinischen Briefe, insbesondere der authentischen. Weitere Schwerpunkte sind die Person und Chronologie des Paulus, sein Gesamtwerk und die didaktische Relevanz seiner Schriften für den Religionsunterricht. Die jüdische und römische Identität des Paulus und deren Einfluss auf sein Wirken werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Einleitung erwähnt die Verwendung von Vorlesungs- und Seminarmitschriften sowie die Zürcher Bibel als Grundlage für die Analyse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Paulus, Briefe, Briefaufbau, Theologie, Chronologie, Authentizität, Jüdische Identität, Römische Kultur, Didaktik, Religionsunterricht, Evangelische Theologie, Neutestamentliche Forschung.
Wie werden die einzelnen Briefe analysiert?
Für jeden der behandelten Briefe wird der Aufbau und die Theologie detailliert untersucht. Die Analyse berücksichtigt die spezifischen Inhalte und theologischen Aussagen jedes einzelnen Briefes.
Welche Rolle spielt die Didaktik im Kontext dieser Arbeit?
Ein wesentlicher Aspekt der Arbeit ist die didaktische Relevanz des Paulus und seiner Briefe für den evangelisch-theologischen Unterricht. Die Arbeit untersucht, wie die Schriften des Paulus im Religionsunterricht sinnvoll eingesetzt und vermittelt werden können.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Personen, die sich mit dem Werk des Apostels Paulus und der neutestamentlichen Theologie auseinandersetzen möchten, insbesondere Studenten der Theologie oder interessierte Laien.
- Quote paper
- Tessa Ostermann (Author), 2012, Paulus und seine Briefe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265124