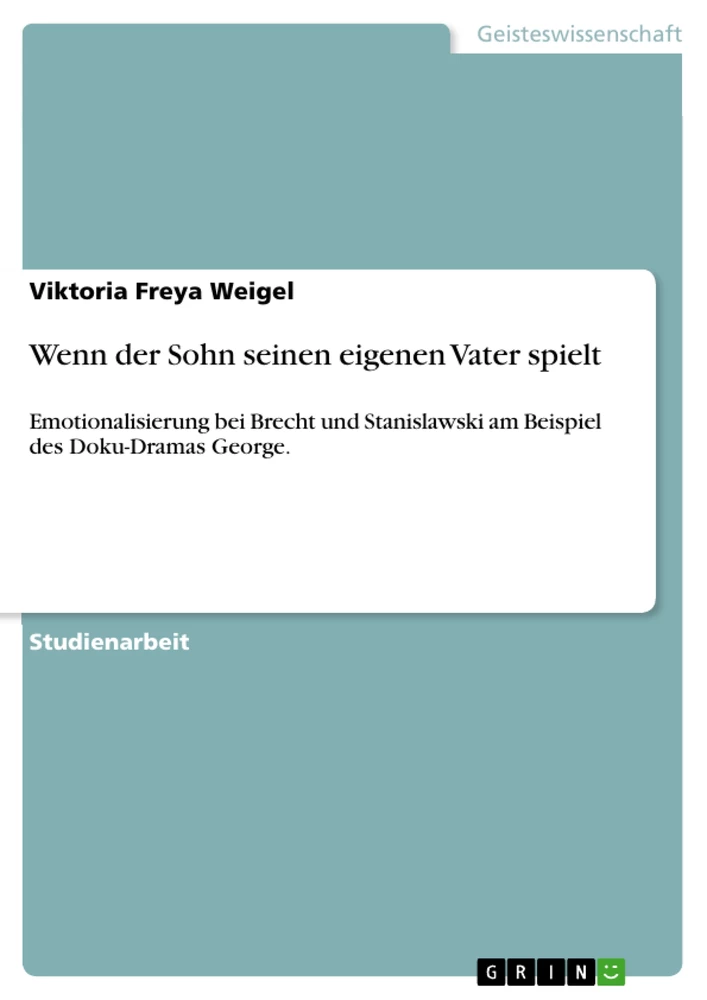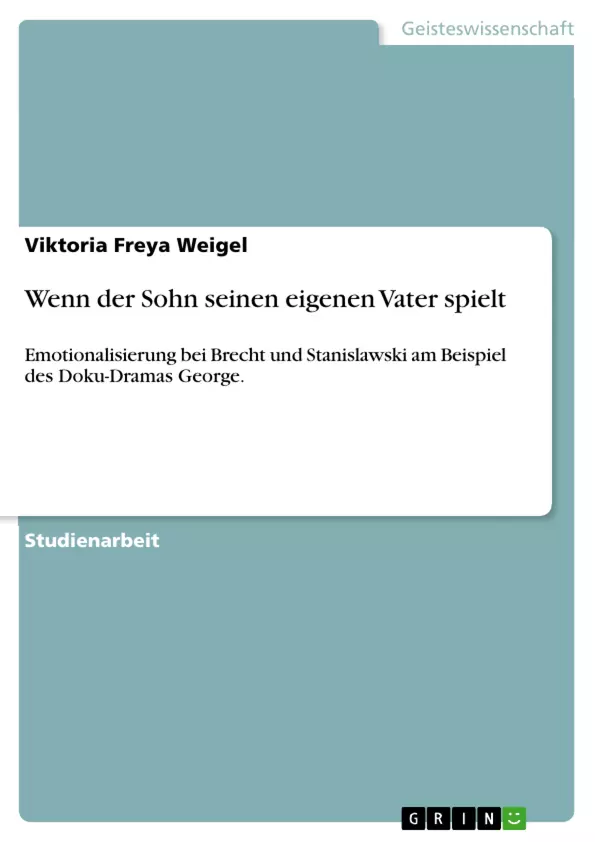In der vorliegenden Arbeit werden die Schauspieltheorien Bertolt Brechts und Konstantin S. Stanislawskis praxisnah auf ihre Bezüge zur Emotionalisierung untersucht. Das beinhaltet die jeweilige Einstellung der Theoretiker zur Rolle der Emotionalisierung im Theater sowie gegebenenfalls die vorgeschlagene Technik, mit der ebendiese Emotionalisierung erreicht oder
eben vermieden werden soll – andere schauspieltheoretische Ansätze hingegen werden für diese Untersuchung nicht zurate gezogen. Zudem wird nicht nur die emotionale Wirkung auf den Zuschauer untersucht, sondern diese Herangehensweise wird mit der emotionalen Beteiligung des Schauspielers verwoben.
Das Beispiel, an dem die Emotionalisierung bei Brecht und Stanislawski untersucht werden soll, ist das Doku-Drama George, das am 22.7.2013 erstausgestrahlt wurde. In Joachim A. Langs Film geht es um das Leben und Wirken des Schauspielers Heinrich George, wobei insbesondere zu beachten ist, dass die Hauptrolle von Georges Sohn Götz George gespielt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Emotionalisierung bei Bertolt Brecht
- Emotionalisierung bei Konstantin S. Stanislawski
- Fazit
- Videoverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Schauspieltheorien von Bertolt Brecht und Konstantin S. Stanislawski im Kontext des Doku-Dramas „George". Die Arbeit untersucht, wie die beiden Theoretiker Emotionalisierung im Theater verstehen und welche Techniken sie zur Erzeugung oder Vermeidung von Emotionen vorschlagen. Der Fokus liegt dabei auf der emotionalen Wirkung auf den Zuschauer sowie der emotionalen Beteiligung des Schauspielers.
- Die Rolle der Emotionalisierung im Theater bei Brecht und Stanislawski
- Die Untersuchung der Emotionalisierung im Doku-Drama „George", insbesondere im Kontext der Vater-Sohn-Beziehung zwischen Götz George und seinem Vater Heinrich George
- Die Analyse von ausgewählten Filmszenen in Bezug auf Brechts V-Effekte und Stanislawskis Konzept des emotionalen Gedächtnisses
- Die Frage, inwieweit die besondere Besetzung des Films, in der Götz George seinen eigenen Vater spielt, die Emotionalisierung beeinflusst
- Die Untersuchung der emotionalen Reaktionen der Zuschauer und der Schauspieler, insbesondere der Söhne Heinrich Georges, Götz und Jan George
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt das Doku-Drama „George" als Beispiel für die Untersuchung der Emotionalisierung bei Brecht und Stanislawski vor. Der Film handelt vom Leben und Wirken des Schauspielers Heinrich George, wobei sein Sohn Götz George die Hauptrolle spielt. Die Besonderheit der Vater-Sohn-Konstellation im Zentrum des Films wird hervorgehoben, da sie eine einzigartige Verbindung von Emotionen und Schauspielkunst darstellt.
- Emotionalisierung bei Bertolt Brecht: Dieses Kapitel analysiert Brechts Schauspieltheorien im Kontext des Doku-Dramas „George". Der V-Effekt, der darauf abzielt, den Zuschauer zu distanzieren und eine kritische Haltung gegenüber dem Geschehen zu fördern, wird in Bezug auf die ausgewählten Szenen des Films untersucht. Die Frage, inwieweit Götz George in seiner Rolle als HEINRICH GEORGE eine Distanz zu seiner Rolle einnimmt und ob der Film eine kritische Haltung des Zuschauers erzeugt, wird diskutiert. Das Kapitel analysiert auch die Verhörszene, in der Götz George in der Rolle seines Vaters mit den Vorwürfen des NKWD konfrontiert wird, und beleuchtet, inwieweit Brechts Forderungen nach Distanz und kritischem Standpunkt in dieser Szene umgesetzt werden.
- Emotionalisierung bei Konstantin S. Stanislawski: Dieses Kapitel untersucht Stanislawskis Schauspieltheorien im Kontext des Doku-Dramas „George". Stanislawskis Konzept des emotionalen Gedächtnisses und die „Echtheit der Leidenschaften", die auf eine vollständige Verschmelzung von Akteur und Rolle abzielen, werden in Bezug auf die ausgewählten Szenen des Films analysiert. Die Wiedersehensszene zwischen HEINRICH GEORGE und GÖTZ GEORGE wird als Beispiel für die Anwendung des emotionalen Gedächtnisses untersucht. Das Kapitel beleuchtet auch die Verhörszene und die Sterbeszene, um zu untersuchen, inwieweit Götz George in seiner Rolle die Emotionen seines Vaters authentisch vermittelt oder ob er eher seine eigenen Emotionen in die Darstellung einfließen lässt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Emotionalisierung, Schauspieltheorie, Bertolt Brecht, Konstantin S. Stanislawski, Doku-Drama, „George", Vater-Sohn-Beziehung, Götz George, Heinrich George, V-Effekt, emotionales Gedächtnis, Echtheit der Leidenschaften, kritische Haltung, Einfiihlung, Distanz, Interview, Spielfilmszene, Archivszenen, historische Wahrheit, subjektive Wahrnehmung, Familientragödie, Verhörszene, Wiedersehensszene, Sterbeszene.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich Brecht und Stanislawski in Bezug auf Emotionen?
Brecht setzt auf Distanzierung (V-Effekt), um eine kritische Haltung zu fördern, während Stanislawski durch das „emotionale Gedächtnis“ eine vollständige Identifikation zwischen Schauspieler und Rolle anstrebt.
Was ist das Besondere am Doku-Drama „George“?
In diesem Film spielt Götz George seinen eigenen Vater, Heinrich George. Diese Konstellation bietet eine einzigartige Grundlage zur Untersuchung von Emotionalisierung und schauspielerischer Identifikation.
Was bewirkt der Verfremdungseffekt (V-Effekt) nach Brecht?
Der V-Effekt soll das Gezeigte auffällig machen, um den Zuschauer aus der passiven Einfühlung zu reißen und ihn zu einer kritischen, reflektierten Sichtweise zu bewegen.
Was versteht Stanislawski unter dem „emotionalen Gedächtnis“?
Es ist eine Technik, bei der Schauspieler eigene vergangene Emotionen abrufen, um die Gefühle ihrer Rolle authentisch und „echt“ auf der Bühne oder im Film darzustellen.
Wie beeinflusst die Vater-Sohn-Beziehung das Schauspiel in „George“?
Die Besetzung führt zu einer Vermischung von realer Biografie und fiktionaler Darstellung, was die Frage aufwirft, ob Götz George eher seinen Vater darstellt oder eigene Emotionen verarbeitet.
- Citation du texte
- Viktoria Freya Weigel (Auteur), 2013, Wenn der Sohn seinen eigenen Vater spielt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265174