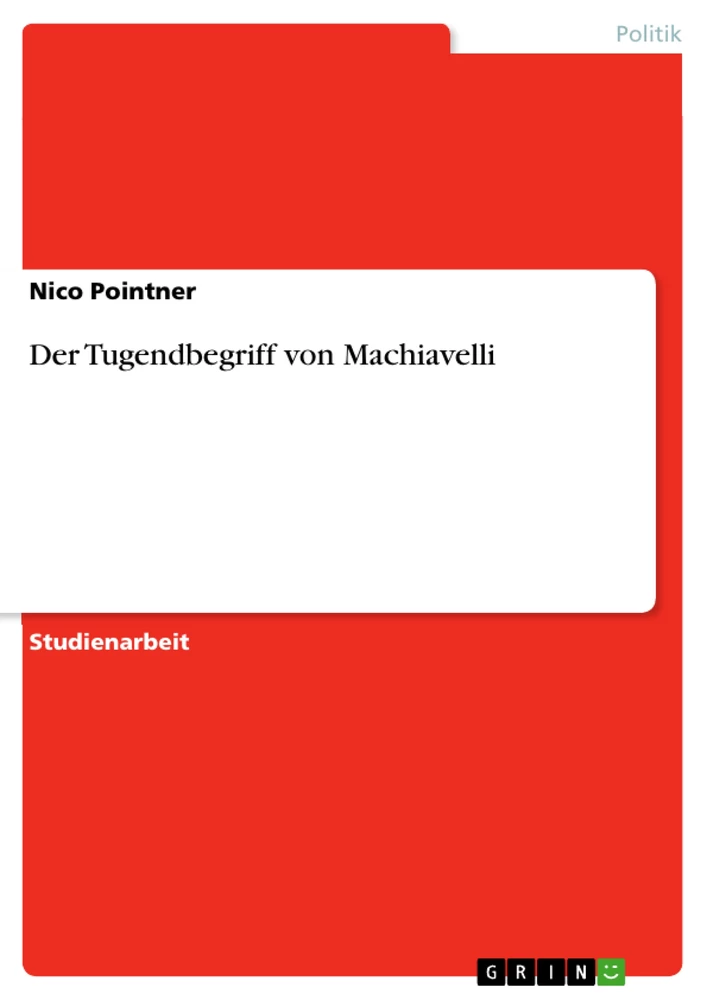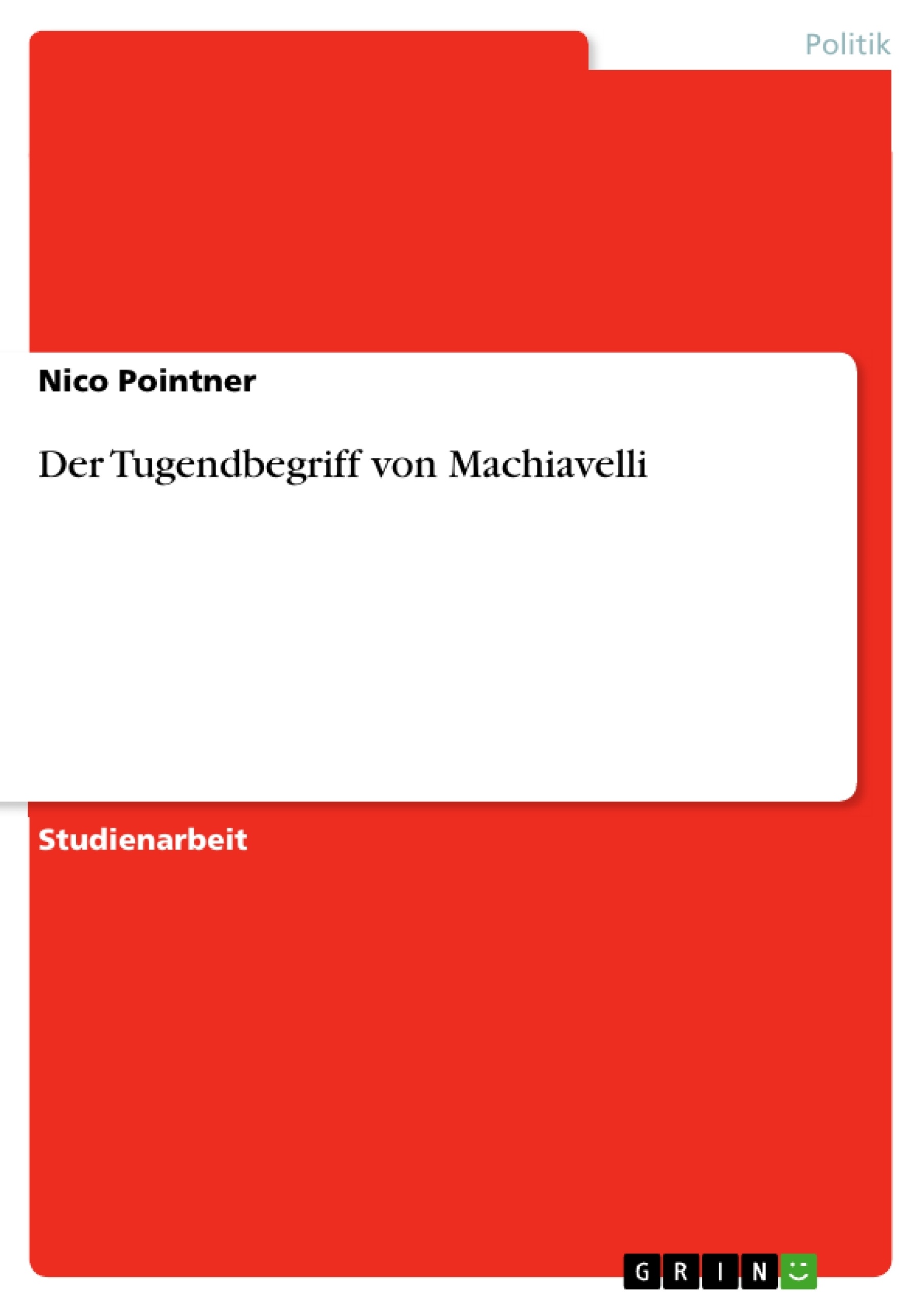Die Geschichte der politischen Philosophie wurde stets begleitet durch den Begriff der Tugend. Das Bestreben, sein eigenes Handeln auf das Sittlich-Gute auszurichten, ist bei großen Philosophen wie Aristoteles und Cicero unabdingbares Element der politischen Philosophie. Der Italienier Niccolò Machiavelli aber trennte die Politik von der Ethik. Das Hauptinteresse in seinem umstrittenen Werk „Il Principe“ gilt der Frage, wie ein Fürst Macht
erlangen, steigern und sichern kann. Dadurch bricht er mit der antiken und christlichen Tradition und dreht den politischen Tugendbegriff um. Tugend ist bei Machiavelli nicht länger Inbegriff des Guten, sondern wird an politischer Effektivität, Erfolg und Macht gemessen. Jedes noch so grausame Mittel erscheint rechtmäßig, wenn es seinen politischen Zweck erfüllt. Noch heute
haftet dem Philosophen der Vorwurf an, mit seinem „Principe“ eine gewissenlose Philosophie des Machterwerbs geschaffen zu haben. „Machiavellismus“ bezeichnet eine rücksichtlose, sich über alle Gesetze der Moral und der Religion hinwegsetzende Staatskunst. In dieser politischen „moralfreien“ Führungsdoktrin sind Politik und Ethik unvereinbar. Aber wie definiert Machiavelli dann politische Tugend? Und ist er auch bei näherer Betrachtung der
„Lehrmeister des Bösen“, wie ihn Leo Strauss einst bezeichnete? Diesen Fragen versucht sich die folgende Arbeit anzunähern.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Der Realismus und die pessimistische Anthropologie
- Die Umwertung des Tugendbegriffs — Die „Machiavellistische Revolution"
- Der „Tugendkatalog" Machiavellis
- „Virtü" — Die Tüchtigkeit als Schlüssel zur Macht
- Ist Machiavelli ein „Lehrmeister des Bösen"?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Tugendbegriff bei Niccolö Machiavelli, insbesondere im Kontext seines Werkes "Il Principe". Ziel ist es, Machiavellis politische Philosophie zu verstehen und zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf seine Umdeutung des traditionellen Tugendbegriffs und die daraus resultierende Entkopplung von Politik und Moral.
- Realismus und pessimistische Anthropologie
- Die Umwertung des Tugendbegriffs
- Der "Tugendkatalog" Machiavellis
- Die Bedeutung von "Virtü"
- Die Frage nach Machiavellis "Lehrmeistertum des Bösen"
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problemstellung, indem es den traditionellen Tugendbegriff in der politischen Philosophie und den Bruch Machiavellis mit dieser Tradition darstellt. Machiavelli fokussiert in "Il Principe" auf den Erwerb, die Steigerung und Sicherung von Macht, wobei die Frage nach der moralischen Rechtfertigung des Handelns in den Hintergrund tritt.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Grundprämissen von Machiavellis Philosophie, insbesondere mit seinem Realismus und seiner pessimistischen Anthropologie. Machiavelli betrachtet die Menschen als undankbar, wankelmütig und habgierig, was ihn zu der Schlussfolgerung führt, dass ein Herrscher sich von moralischen Bedenken lösen muss, um in einer schlechten Welt erfolgreich zu sein.
Das dritte Kapitel analysiert die "Machiavellistische Revolution" und die Umwertung des Tugendbegriffs. Machiavelli argumentiert, dass ein Fürst alle Mittel einsetzen darf, um Macht zu erlangen und zu sichern, selbst wenn diese moralisch verwerflich sind. Der Zweck heiligt die Mittel, und die traditionelle Ethik mit ihren Werten wie Barmherzigkeit und Nächstenliebe wird von Machiavelli als hinderlich für die Machtpolitik betrachtet.
Das vierte Kapitel erörtert den "Tugendkatalog" Machiavellis, der in "Il Principe" präsentiert wird. Machiavelli diskutiert antithetische Paare von Eigenschaften wie Freigebigkeit und Knausrigkeit, Milde und Grausamkeit, Treue und Untreue. Diese Eigenschaften verlieren ihre ethischen Implikationen und werden zu wertfreien Mitteln zur Herrschaftsausübung. Der Fürst muss die jeweiligen Tugenden üben oder wenigstens den Anschein erwecken, darf aber vor den Lastern nicht zurückschrecken, wenn es die politische Notwendigkeit erfordert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Begriff der "Virtü", der für Machiavelli den Schlüssel zur Macht darstellt. "Virtü" ist die Fähigkeit, mit dem Schicksal zu koalieren und Ehre und Ruhm zu erlangen, wobei sie nicht unbedingt mit den traditionellen Tugenden verbunden ist. Ein Fürst muss mit allen Mitteln, egal ob tugendhaft oder niederträchtig, seine Ziele erreichen.
Das sechste Kapitel widmet sich der Frage, ob Machiavelli ein "Lehrmeister des Bösen" ist. Die Arbeit argumentiert, dass Machiavelli ein Verantwortungsethiker ist, der die Folgen seines Handelns bewusst in Kauf nimmt. Er plädiert für den Vorrang des "utile" (Nutzens) gegenüber dem "honestum" (Moralischen), wobei er jedoch eine moralische Politik als Idealfall betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Tugendbegriff, den Realismus, die pessimistische Anthropologie, die "Machiavellistische Revolution", den "Tugendkatalog", "Virtü", Machtpolitik, Moral, Ethik, Staatskunst, "Il Principe", und die Frage nach Machiavellis "Lehrmeistertum des Bösen".
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Machiavelli den Begriff der Tugend (Virtü)?
Für Machiavelli ist „Virtü“ nicht die moralische Güte, sondern die politische Tüchtigkeit, Tatkraft und Entschlossenheit eines Herrschers, Macht zu erlangen, zu sichern und zum Wohle des Staates einzusetzen.
Warum trennte Machiavelli Politik von der Ethik?
Machiavelli war Realist. Er war der Überzeugung, dass ein Herrscher, der in einer Welt voller schlechter Menschen nur moralisch handelt, zwangsläufig untergehen muss. Erfolg wird bei ihm an politischer Effektivität gemessen.
Ist Machiavelli wirklich ein „Lehrmeister des Bösen“?
Diese Bezeichnung stammt von Leo Strauss. Die Forschung diskutiert jedoch, ob Machiavelli eher ein Verantwortungsethiker war, der erkannte, dass für den Erhalt des Staates manchmal auch moralisch fragwürdige Mittel notwendig sind.
Was bedeutet „der Zweck heiligt die Mittel“ im Machiavellismus?
Es bedeutet, dass ein Herrscher auch vor Grausamkeit oder Untreue nicht zurückschrecken darf, wenn dies der einzige Weg ist, um die Stabilität des Staates und die eigene Macht zu gewährleisten.
Was ist Machiavellis Menschenbild?
Machiavelli vertritt eine pessimistische Anthropologie. Er sieht den Menschen als von Natur aus undankbar, wankelmütig, heuchlerisch und habgierig an, was eine starke Hand des Fürsten erforderlich macht.
- Quote paper
- Magister Artium Nico Pointner (Author), 2005, Der Tugendbegriff von Machiavelli, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265196