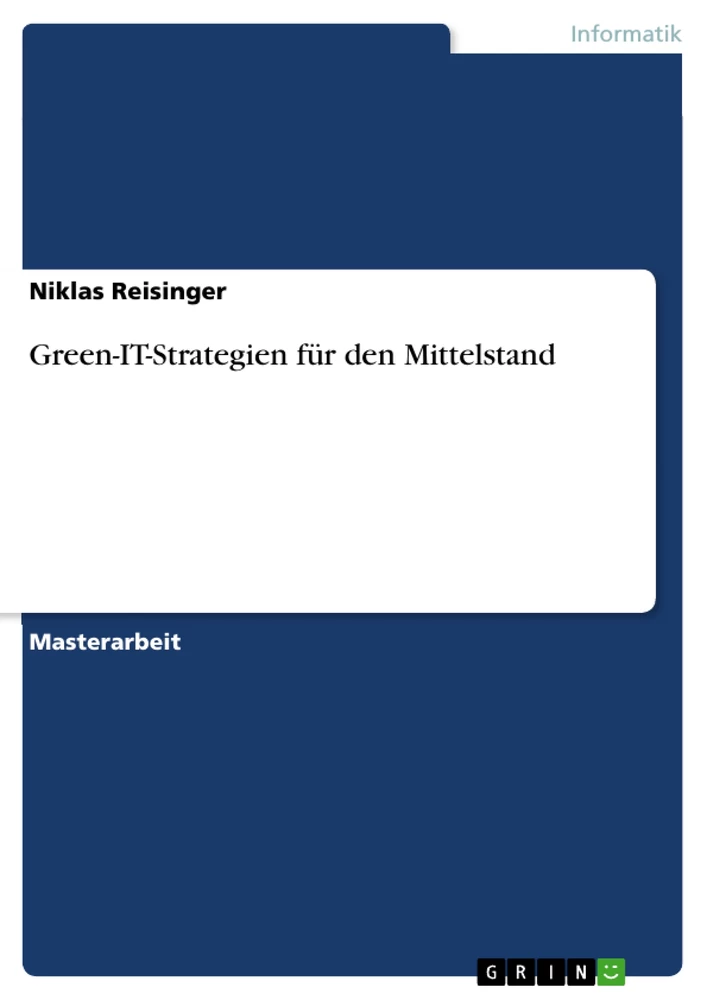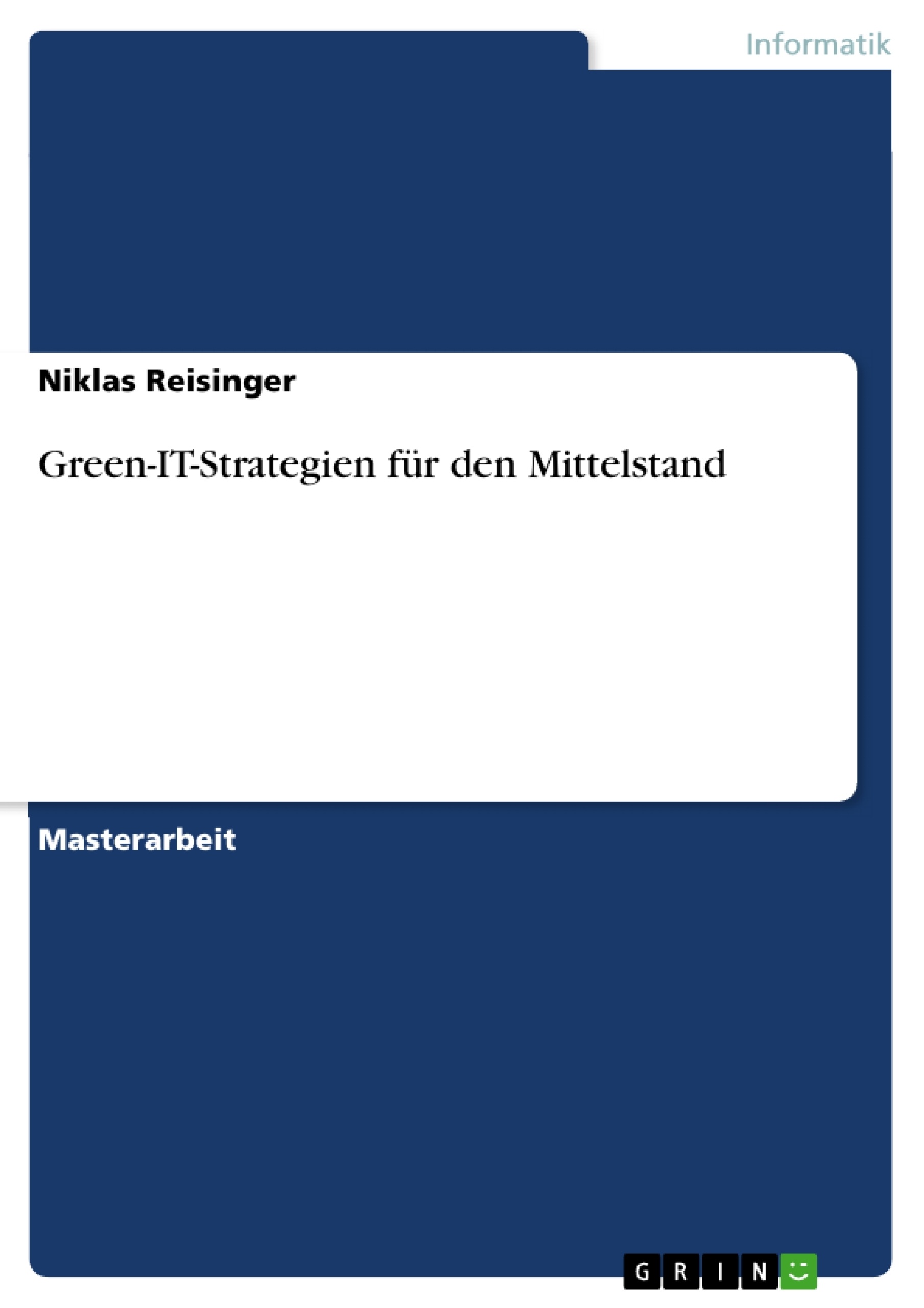Lange Zeit galt Ökologie als limitierender Faktor für die Wirtschaft. Durch nachhaltige IT-Lösungen – unter dem in den letzten Jahren aufgekommenen Begriff Green IT zusammengefasst – wird Ökologie zunehmend ökonomisch. Green IT bezeichnet sowohl energieeffiziente IT-Hardware und -Infrastruktur als auch nachhaltige Lösungen, die mit IT-Unterstützung in Bereichen außerhalb der IT realisiert werden. Immer mehr Unternehmen entwickeln Strategien, um Green IT im eigenen Unternehmen zu etablieren.
Das Potenzial „grüner“ Informationstechnologie haben bisher überwiegend große Unternehmen erkannt. Green IT funktioniert jedoch nahezu unabhängig von der Unternehmensgröße, sodass eine Übertragung auf den in Deutschland traditionell starken Mittelstand naheliegend ist.
Inhaltsverzeichnis
1 Ökonomie und Ökologie als unversöhnliche Ansätze?
2 Green IT
2.1 Definition
2.2 Historische Entwicklung
3 Strategiekreislauf der Green IT
3.1 Ziele
3.1.1 Nachhaltigkeit in der IT
3.1.2 Nachhaltigkeit durch IT
3.2 Maßnahmen
3.2.1 Green Information
3.2.2 Green Components
3.2.3 Green Networks
3.2.4 Green Computing
3.3 Kennzahlen
3.4 Kommunikation
4 Übertragbarkeit des Strategiekreislaufs auf den Mittelstand
4.1 Ziele
4.1.1 Erschließung neuer Märkte
4.1.2 Kostensenkung
4.2 Maßnahmen
4.2.1 Green Information
4.2.2 Green Components
4.2.3 Green Networks
4.2.4 Green Computing
4.3 Kennzahlen
4.4 Kommunikation
5 „Green Best Practices“ für den Mittelstand
6 Praxisbeispiel „flinc“ – Green durch IT
7 Management Summary
Quellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Ökonomie und Ökologie als unversöhnliche Ansätze?
"Es gibt kein konfliktfreies Verhältnis von Ökonomie und Ökologie."
Angela Merkel, 1997 [LAMB97]
Diese Aussage der damaligen Bundesumweltministerin und heutigen Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt, dass Ökonomie und Ökologie lange Zeit als unversöhnliche Ansätze galten. Während die Ökonomie sich mit der planvollen Befriedigung des menschlichen Bedarfs beschäftigt [GABL13a], untersucht die Ökologie die Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen und Umwelt [GABL13b]. Die Befriedigung des menschlichen Bedarfs stand bisher in engem Zusammenhang mit einem konstanten Wirtschaftswachstum, um bei steigender Bevölkerungszahl den Wohlstand zumindest stabil zu halten, was wiederum direkt mit erhöhtem Ressourceneinsatz und zunehmenden Abfallprodukten assoziiert wurde. Dies wiederum belastet die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Umwelt, wodurch deutlich wird, warum sich Ökonomie und Ökologie bisher weitestgehend antagonistisch gegenüberstanden, zielt die Ökologie doch auf eine Reduktion der Ressourcenströme [BLMI01, S. 9].
Auch die Bevölkerung zeigt sich zwiegespalten, was Umweltschutz betrifft. Einerseits sehen die Deutschen laut einer repräsentativen Umfrage des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit aus dem Jahr 2012 „Umweltschutz“ hinter „Wirtschafts- und Finanzpolitik“ als zweitwichtigstes politisches Thema an [BMUW13, S. 18], andererseits legen beispielsweise beim Autokauf nur 15 % der Befragten Wert auf umweltfreundliche Technik [BMUW13, S. 48]. Hier zeigt sich, dass ein Umweltbewusstsein durchaus vorhanden ist, Einsparungen an der Lebensqualität aber schwer zu vermitteln sind. Um dahingehende Bemühungen zu intensivieren, wurde Umweltschutz 1994 als Staatsziel im Grundgesetz verankert. In Artikel 20a heißt es: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“ [DEBU10, S. 28]. Heute basiert die staatliche Umweltpolitik in Deutschland auf vier Prinzipien, wie Abbildung 1 zeigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Prinzipien der staatlichen Umweltpolitik in Deutschland (in Anlehnung an [KOHO09])
Über das Verursacherprinzip sollen externe Effekte internalisiert werden, während das Vorsorge- sowie das Kooperationsprinzip darauf angelegt sind, Umweltschäden frühzeitig und gemeinsam zu verhindern. Zusammen mit dem Integrationsprinzip, das Umweltschutz in allen Politikbereichen verankern soll, lassen sich diese Prinzipien im Prinzip der Nachhaltigkeit bündeln, wodurch ein Gleichgewicht im Ökosystem geschaffen werden soll [KOHO09].
Einen ähnlichen Weg zur Harmonisierung dieser scheinbar unvereinbaren Ansätze – konstantes Wachstum bei nachhaltigem Umgang mit Ressourcen – verfolgt der Ansatz der ökologischen Ökonomie. Demzufolge ist eine Wirtschaft nur dann ökologisch, wenn deren Durchsatz, also die Ressourcen, die genutzt werden, sowie die Emissionen, die ausgestoßen werden, die Regenerations- beziehungsweise Absorptionsfähigkeiten der Umwelt nicht übersteigt [DALY02, S. 4]. Ein Lösungsansatz der ökologischen Ökonomie hierfür ist eine Steigerung der Ressourceneffizienz bei gleichbleibendem oder sinkendem Ressourcendurchsatz. [DALY02, S. 6]. Dies soll durch ökologische Innovationen, also neuartige umweltfreundliche und ressourcenschonende Produkte oder Prozesse [GABL13c] ermöglicht werden.
Initiierung für die Entwicklung ökologischer Innovationen kann sowohl staatliche Regulierung (regulatory-push) als auch ein hohes Interesse an „grünen“ Produkten aufseiten der Konsumenten (ecology-pull) sein [BLMI01, S. 133]. Aber auch die Industrie hat – nicht zuletzt aufgrund stetig steigender Energiekosten – das Potenzial umweltschonender Technologien im Rahmen einer kosteneffizienten Produktion erkannt und inzwischen ein hohes intrinsisches Interesse an derartigen Entwicklungen (ecology-push) [BLMI01, S. 133].
2 Green IT
Eine große Rolle bei ökologischen Innovationen mit effizienten und umweltschonenden Produkten und Prozessen spielt die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). Die Bedeutung dieser Techniken hat durch die globale Vernetzung und die zunehmende Unterstützung der Geschäftsprozesse durch die IT immer mehr zugenommen und birgt viel Potenzial, sowohl Ökonomie als auch Ökologie nachhaltig zu beeinflussen.
Zum einen ist die IKT durch ihren hohen Energiebedarf selbst zu einem ökonomischen Kostenfaktor geworden und aus ökologischer Sicht alles andere als ressourcenschonend. Bereits bei der letzten Erhebung im Jahr 2007 betrug der Stromverbrauch der IKT in Deutschland 55 Terawattstunden (TWh), was einem Anteil von 10,5 % am gesamten jährlichen Stromverbrauch entspricht [FRAU09, S. 11]. Bis zum Jahr 2020 wird sogar mit einem Anstieg um circa 20 % auf dann 66,7 TWh gerechnet [FRAU09, S. 66]. Bereits im Jahr 2012 verbrauchten in Deutschland allein die Rechenzentren 1,8 % des Gesamtstroms – eine Strommenge, für die beinahe vier mittelgroße Kohlekraftwerke betrieben werden müssen [HINT13, S. 1]. Auch der Anteil der ITK am weltweiten CO2-Ausstoß wird bis zum Jahr 2020 weiter steigen, von derzeit knapp zwei auf dann drei Prozent [BUHL08, S.1]. Was zunächst wenig erscheint, relativiert sich, wenn man bedenkt, dass diese Emission äquivalent zum Ausstoß des weltweiten Flugverkehrs ist und mehr als 60 Milliarden Bäume zur Umsetzung dieser Menge CO2nötig wären [BUHL08, S. 2].
Zum anderen hat gerade die IKT durch die eingangs erwähnte zunehmende Verflechtung und IT-Durchdringung der Unternehmen die Möglichkeit, Einfluss auf die Energieeffizienz und damit die ökologische Bilanz des gesamten Unternehmens zu nehmen. Durch intelligente Steuerung, Überwachung und Koordination der Geschäftsprozesse sind hohe Einsparungen, beispielsweise beim Gebäudemanagement oder der Logistik, möglich [BUHL08, S. 4]. Dies gilt nicht nur für die IT-Branche, sondern für jede Branche, die IT-Systeme einsetzt.
Alle umweltschonenden Bemühungen der ITK, die überwiegend mit der Senkung des Energieverbrauchs einhergehen, werden unter dem Schlagwort Green IT zusammengefasst.
2.1 Definition
Ursprünglich definiert wurde Green IT als „die ressourcenschonende Verwendung von Energie und Einsatzmaterialen in der Informations- und Kommunikationstechnologie über den gesamten Lebenszyklus hinweg“ [GABL13d]. Diese Definition beleuchtet aber nur einen Teil von Green IT. Die heutige Verwendung des Begriffs Green IT geht weit über diese Definition hinaus und wird durch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) treffend beschrieben. Abbildung 2 zeigt die verschiedenen Ebenen von Green IT in Anlehnung an die Definition der OECD.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Verschiedene Ebenen von Green IT (in Anlehnung an [OECD10, S. 8])
Der innere Kreis, die direkten Auswirkungen beinhaltend, entspricht dabei der klassischen Definition von Green IT und umfasst alle umweltschonenden Anstrengungen in der IT, wie beispielsweise energieeffiziente Komponenten oder effektive Kühlung. In der Literatur wird diese Ebene der Green IT oft als „Green in der IT“ bezeichnet [OECD10, S. 9]. Der mittlere der konzentrischen Kreise beinhaltet alle ressourcenschonenden Auswirkungen im ökonomischen wie sozialen Umfeld, die durch IT-Unterstützung ermöglicht werden, und wird deshalb auch „Green durch die IT“ genannt. Dazu zählt unter anderem IT-gestützte Routenplanung in der Logistik, die Substitution ehemals physischer Güter durch digitale wie etwa in der Musik- oder Buchbranche oder gar obsolet werdende Dienstreisen durch Videokonferenzen [OECD10, S. 9].
Diese zwei inneren Ebenen tauchen in der Literatur immer wieder auf. Eine weitere Ebene und damit eine weiter gefasste Sicht auf Green IT wird nun durch die OECD mit der dritten Ebene, den Systemauswirkungen, eingeführt. Damit sind Verhaltensänderungen und andere nicht-technische Faktoren gemeint, die durch die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik ausgelöst werden. Ein Beispiel hierfür wären Entscheidungen, die auf Grundlage von IT-gestützten Analysen von Umweltdaten getroffen werden [OECD10, S.10]. Auch die Preistransparenz auf dem Strommarkt und die dadurch ermöglichte gezielte Nutzung billigen Stroms ist der Ebene der Systemauswirkungen zuzurechnen [OECD10, S. 10], wobei zu hinterfragen bleibt, inwieweit Konsumenten bereit sind, ihr Verhalten dahingehend anzupassen. Eine technologisch gestützte Nutzung günstiger Strompreise, beispielsweise das Anschalten der Waschmaschine bei Unterschreiten eines bestimmten Preises, wäre dann eher der Ebene „Green durch die IT“ zuzuordnen. Ähnlich unscharf ist der Übergang zwischen zweiter und dritter Ebene am Beispiel digitaler Musik, da die Substitution physischer Datenträger einerseits eine durch die IT ermöglichte Auswirkung ist, andererseits aber auch Einfluss auf das Verhalten der Konsumenten hat.
Dadurch wird deutlich, dass Green IT deutlich mehr ist als stromsparende Hardware und die eingangs zitierte Definition überholt ist, es aber auch nicht die eine allgemein anerkannte Definition von Green IT gibt. Eine aktuelle verbale Definition stammt vom Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit, im Auftrag der Enquete‐Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ des Deutschen Bundestages, die allerdings auch die Ebene der Systemauswirkungen außen vor lässt. Dort wird Green IT als der „Einsatz von Informations‐ und Kommunikationstechnologien und deren Anwendung, die unter Berücksichtigung des gesamten Produktlebenszyklus im Vergleich zu bisherigen Lösungen zu einer deutlichen Entlastung der Umwelt führt“ definiert [BORD12, S. 10].
2.2 Historische Entwicklung
Erstmals überhaupt relevant wurde Green IT, wenn auch noch nicht unter diesem Namen, zu Beginn der 1990er Jahre, als die Verbreitung des Personal Computers soweit fortgeschritten war, dass die IT durch die schiere Masse der Geräte einen messbaren Einfluss auf die Ökologie hatte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Logo des Energy-Star-Programms [EUEN13]
Als Reaktion auf den steigenden Stromverbrauch der IT startete die US-amerikanische Umweltschutzbehörde 1992 das Programm „Energy Star“, das es Herstellern erlaubt, energiesparende Hardware mit dem Energy-Star-Logo (Abbildung 3) zu versehen [ENST13]. Durch eine EU-Verordnung wurde der Energy Star 2003 auch offiziell auf Europa ausgeweitet [OJEU03]. Obwohl durch den Energy Star nach eigenen Angaben allein 2012 1,8 Milliarden Tonnen CO2eingespart wurden [ENST13a, S. 1], stand die Zertifizierung immer wieder in der Kritik. Der Vorwurf zu schwacher Spezifikationen, die von nahezu allen Geräten erfüllt werden, konnte durch eine stetige Weiterentwicklung der Kriterien zur aktuell fünften Version [ENST08] zwar weitestgehend entkräftet werden, jedoch findet weiterhin keine Prüfung der Deklaration der Hersteller statt.
Einen großen Beitrag zur Forcierung „grüner“ IT-Lösungen leistete, wenn auch nur indirekt, das Kyoto-Protokoll aus dem Jahr 1997. In diesem Zusatzprotokoll zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen verpflichten sich insgesamt 193 Staaten – allerdings nicht die USA – erstmals verbindlich, die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren [VENA99]. Bei aller Kritik an der Wirksamkeit der Vorgaben erfüllte das Kyoto-Protokoll für die Green IT aufgrund der großen öffentlichen Aufmerksamkeit zumindest den Zweck, die Nachfrage nach emissionsarmen IT-Lösungen durch Industrie, Konsumenten und im öffentlichen Bereich zu steigern und damit auch die Entwicklung solcher Lösungen durch die Hersteller voranzutreiben.
Über die Stromeffizienz, den Hauptaspekt emissionsarmer IT, hinaus gehen die EU-Richtlinien zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Restriction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS)) [EUPA11] und über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)) [EUPA03], die in Deutschland mit dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) [BMDJ05] umgesetzt werden. Entsprechend der Definition von Green IT wird hierdurch erstmals der Gedanke der Umweltverträglichkeit nicht nur auf den Betrieb der Geräte reduziert, sondern auf deren gesamten Lebenszyklus von der Produktion bis zur Entsorgung erweitert. Die RoHS-Richtlinie wurde 2003 veröffentlich und 2011 überarbeitet und reguliert die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten wie Blei und Quecksilber [EUPA11, S. 13], die bis dahin stark verarbeitet wurden. Analog zur nationalen Umweltpolitik in Deutschland beruft sich die EU-Richtlinie dabei auf das Vorsorgeprinzip [EUPA11, S.1]. Ebenfalls 2003 wurde als Reaktion auf die zunehmende Zahl von Elektronik-Altgeräten [EUPA03, S. 1] die WEEE-Richtlinie verabschiedet. Gemäß des Vorsorge- sowie Verursacherprinzips [EUPA03, S. 1] werden die Hersteller elektronischer Geräte zum einen verpflichtet, bereits beim Herstellungsprozess Vorkehrungen zur späteren Wiederverwendung der Geräte zu treffen [EUPA03, S. 2], zum anderen wird das Konzept der Herstellerverantwortung eingeführt, das jeden Hersteller „für die Finanzierung der Entsorgung des durch seine eigenen Produkte anfallenden Abfalls verantwortlich“ [EUPA03, S. 2] macht. In Deutschland regelt das ElektroG das Konzept der Herstellerverantwortung dahingehend, dass die Bürger ihre Altgeräte kostenlos an kommunalen Sammelstellen abgeben können [BMDJ05, S. 5], die Abholung und Entsorgung allerdings durch eine von den Herstellern eingerichtete „Gemeinsame Stelle“ [BMDJ05, S. 4] finanziert wird. Diese „Gemeinsame Stelle der Hersteller“ ist in Deutschland die „Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR)“ [SEAR13].
Aufgrund dieser gesetzlichen Grundlage und des steigenden Umweltbewusstseins der Verbraucher entstand in den Folgejahren ein regelrechter Hype um das Thema Green IT. Der Begriff „Green IT“ wurde inflationär benutzt und auch oftmals für Marketingzwecke missbraucht, während die Umsetzung meist nur oberflächlich stattfand. So sagte beispielsweise die Experton Group 2007 in einer Studie über Green IT in Deutschland voraus, dass der Markt für „grüne“ Informationstechnologie in den nächsten Jahren um durchschnittlich 66,2 % pro Jahr [EXGR08, S. 8] wachsen würde, stellte aber gleichzeitig fest, dass in 79 % der befragten Unternehmen überhaupt keine Richtlinien zur Nutzung energieeffizienter Hardware vorhanden sind [EXGR08, S. 6]. Auch bei den stromintensiven Rechenzentren spielte die Klimatisierung oder Stromversorgung, verglichen mit der Verfügbarkeit oder der Verbesserung interner Prozesse, nur eine untergeordnete Rolle [EXGR08, S. 5].
Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise 2007 stand zu befürchten, dass das Interesse an ökologischen Projekten zurückgehen werde, da diese meist erst auf lange Sicht ökonomisch sind. Es trat aber das Gegenteil ein, da Investitionen in ökologische Technologien ein wichtiger Bestandteil vieler nationaler Konjunkturpakete war [OECD09, S. 13]. Allein in Deutschland waren 5,7 Milliarden Euro für „grüne“ Technologien bestimmt [OECD09, S. 13]. Teil dieser Investitionen war der Aktionsplan „Green-IT-Pionier Deutschland“, der in Form einer Allianz aus Vertretern der Bundesregierung, Wirtschaft und Forschung dafür sorgen soll, dass Deutschland zum Pionier in Sachen Green IT wird [BMWT08, S. 1]. Dieser sieht unter anderem eine Reduzierung, des durch den IT-Betrieb des Bundes verursachten Stromverbrauchs bis zum Jahr 2013, bezogen auf den Leistungsumfang, um 40 % vor sowie eine Aufnahme des Energieverbrauchs in die Beschaffungskriterien bei Neuinvestitionen von IT-Lösungen [BMWT08, S. 2]
Aktuell dominieren andere IT-Themen wie Cloud Computing die Medien, die aber durchaus eine gewisse Verwandtschaft zu Green IT aufweisen. Durch das Ende des großen Hypes entstand für die Informations- und Kommunikationsbranche die Chance, echte Green IT abseits missbräuchlicher Marketingstrategien zu entwickeln. Unterstützt werden diese Bemühungen durch gesetzliche Vorgaben, wie etwa die Energieeffizienzrichtlinie der EU aus dem Jahr 2012, die bis zum Jahr 2020 ein Energieeinsparziel von 20 % sowie eine jährliche Einsparung von mindestens 1,5 % vorgibt [FRAU13, S. 15]. Des Weiteren regelt die Ökodesign-Richtlinie der EU „Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte“ [FRAU13, S. 15], beispielsweise den Wirkungsgrad von Netzteilen oder die Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb [FRAU13, S. 16]. Aktuell betreiben europaweit durchschnittlich 63 % der Unternehmen ein Green-IT-Programm [DEVO12, S. 7], wobei unklar bleibt, ob es sich hierbei um Einzelmaßnahmen oder eine Integration in die Unternehmens- und IT-Strategie handelt. Deutschland liegt hier weitestgehend deutlich über dem Durchschnitt; so kennen beispielsweise 83 % der deutschen Unternehmen den Stromverbrauch ihrer Rechenzentren, während es in Belgien nur 37 % und im Durchschnitt 63 % sind [DEVO12, S. 8].
3 Strategiekreislauf der Green IT
Bei den aktuell eingesetzten Green-IT-Strategien gibt es noch wenige Best Practices und es herrscht eine große Heterogenität, beispielsweise bei der Tiefe der Integration in die Unternehmensphilosophie. Einige Überlegungen und Vorgänge tauchen jedoch immer wieder auf und lassen sich in einem Kreislauf darstellen, wie Abbildung 4 zeigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Strategiekreislauf der Green IT
Ausschlaggebend für die Umsetzung einer Green-IT-Strategie sind immer die Ziele, die ein Unternehmen oder eine Behörde damit verfolgt. Diese können ökologischer Art sein, meist jedoch stecken ökonomische Überlegungen oder eine Marketingstrategie dahinter. Auf Grundlage dieser Vorgaben werden Maßnahmen ergriffen, um die Ziele zu erreichen. Hier besteht der größte Handlungsspielraum für die Akteure, jedoch lassen sich die meisten Maßnahmen den zwei inneren Ebenen der Green IT zuordnen. Zur Messung der Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen dienen Kennzahlen, wobei hierbei aus Gründen der Vergleichbarkeit auf internationale Standards zurückgegriffen werden sollte. Die gewonnenen Kennzahlen dienen als Basis für die Kommunikation nach außen, zum Beispiel in Form einer Werbekampagne, oder nach innen, um Korrekturen vorzunehmen. Die Kommunikation und die darauf erhaltene Resonanz nimmt wiederum Einfluss auf die Ziele der Green IT der Unternehmung, wodurch sich der Kreislauf schließt.
3.1 Ziele
In den seltensten Fällen erfolgt der Einsatz von Green IT intrinsisch zum Schutz der Umwelt. Durch den globalen Wettbewerbsdruck werden Entscheidungen hin zu nachhaltigen IT-Lösungen aus ökonomischen Überlegungen oder für eine positive Außendarstellung getroffen. Laut einer Studie von 2010 sind für Unternehmen Kosteneinsparungen (57 %) und der positive Einfluss auf das Unternehmensimage (43 %) die zwei interessantesten Aspekte von Green IT [LIFE10, S. 48]. Dabei spielt die Energieeffizienz eine entscheidende Rolle, da durch stetig steigende Energiepreise Energieeinsparungen in oder durch die IT zu einem Wettbewerbsvorteil geworden sind und diese auch gut mess- und damit kommunizierbar sind. Abbildung 5 zeigt die Energiepreisentwicklung seit Anfang 2007.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Energiepreisentwicklung (in Anlehnung an [STAT13, S. 25; S. 49])
Die Angabe des Strompreises erfolgt hier ohne Mehrwertsteuer, aber mit Verbrauchssteuer und beziffert die Preise, die die Industrie mit einem Jahresverbrauch von 2.000 - 20.000 MWh zahlen muss. Zwar liegen diese Preise deutlich unter denen privater Haushalte – diese mussten 2012 mehr als das Doppelte zahlen [STAT13, S. 48] – verteuerten sich aber dennoch um nahezu 40 % seit 2007. Auch der Benzinpreis spielt bei Green-IT-Kalkulationen eine Rolle, lassen sich doch auch hier, beispielsweise durch IT-gestützte Logistik, Kosten sparen. Obwohl die Kurve der Benzinpreisentwicklung verglichen mit der des Strompreises weniger konstant verläuft, ist auch hier ein Anstieg von circa 35 % für denselben Zeitraum zu beobachten. Ebenso wie beim Strompreis erfolgt auch hier die Angabe der Preise ohne Mehrwertsteuer, jedoch einschließlich Mineralölsteuer und Erdölbevorratungsbeitrag und bezieht sich auf den Preis für Superbenzin, wobei auch Preisentwicklungen bei vergleichbaren Kraftstoffen wie Diesel ähnliche Verlaufskurven aufzeigen. Obwohl die Kraftstoffpreise, nach der Weltwirtschaftskrise, ab dem 2. Halbjahr 2008 stark einbrachen, befinden sie sich heute auf einem Niveau, das Wegeminimierung durch IT-Unterstützung interessant macht.
Auf Grundlage dieser Überlegungen, wenn Green IT vor allem aus Kostengründen und zur Imagepflege betrieben wird, wird deutlich, dass viele Unternehmen hohe Startinvestitionen in ökologische Innovationen scheuen und diese eher umsetzen, wenn sie sich schnell amortisieren [DBRS10, S. 1]. Hier gilt es, langfristige und ganzheitliche Konzepte zu entwickeln. Untergliedern lassen sich solche Konzepte durch Ziele, die direkt in der IT für Nachhaltigkeit sorgen und solchen, die mit IT-Unterstützung nachhaltig sind, analog zu den zwei inneren Ebenen der Green-IT-Definition. Auf die dritte Ebene, die hervorgerufenen Verhaltensveränderungen, wird bewusst verzichtet, da diese nicht nur schwer mess- und zuordenbar, sondern aufgrund vieler externer und nicht-beeinflussbarer Faktoren kaum planbar ist. Den Unterschied zwischen „Green in IT“ und „Green durch IT“ kannten 2010 immerhin 54 % der Unternehmen und zwei Drittel der Unternehmen, die bereits Green-IT-Projekte umgesetzt haben [DBRS10, S. 6]. Die Verteilung zwischen direkter und indirekter Green IT zeigt eine Untersuchung von 50 staatlichen Förderprogrammen durch die OECD. 26 dieser Programme zielten auf „Green in der IT“, nur acht auf die indirekten Effekte durch „Green durch IT“ [OECD09, S.19f.]. Durch die enge Verzahnung staatlicher Förderung mit betrieblicher Umsetzung von Green IT lässt sich eine ähnliche Verteilung im Unternehmensumfeld folgern. Dass dadurch viel Potenzial ungenutzt bleibt, lassen einzelne Studien vermuten, die davon ausgehen, dass die möglichen Ressourceneinsparungen durch „Green durch IT“-Maßnahmen achtmal höher liegen als der Verbrauch der Informations- und Kommunikationstechnik [BORD12, S. 7f.]. Dies wird auch für das Erreichen umweltpolitischer Ziele eine wichtige Rolle spielen, wird doch mit einem Reduktionspotenzial von knapp 200 Millionen Tonnen CO2im Jahr 2020 durch direkte und besonders indirekte IT-Lösungen gerechnet [BOCG10, S. 7].
3.1.1 Nachhaltigkeit in der IT
Nachhaltigkeit in der IT, also „Green in der IT“, wird überwiegend mit dem Ziel der Energieeffizienz während der Nutzung assoziiert. Bei einem geschätzten Anteil der IKT von 11 % am Gesamtstromverbrauch [BORD12, S. 42] und einem geschätzten Einsparpotenzial von 75 % durch energieeffiziente Technik [BORD12a, S. 2] ist dies auch nachvollziehbar. Energieeffiziente Komponenten sind für Green IT notwendig, aber nicht hinreichend [FICH09, S. 5]. Eine alleinige Fokussierung auf die Energieeffizienz der Komponenten kann zum Rebound-Effekt führen. Dabei würde, auch bei energieeffizienterer Hardware, durch die Zunahme der Daten und Geräte im Endeffekt mehr Strom verbraucht als im jetzigen Status quo [BORD12a, S. 2]. Wichtig ist daher, durch Betrachtung des gesamten Nutzungssystems eine systemische Ressourceneffizienz anzustreben [FICH09, S. 5], wozu zum Beispiel eine intelligente Steuerung und Nutzung vorhandener Ressourcen ebenso gehört wie eine Materialeffizienz in der Produktion und Entsorgung von IT-Gütern.
Die heutige Priorisierung auf die Stromreduktion während der Nutzungsphase kommt auch daher, dass aus Kostenüberlegungen seitens der Industrie innerhalb weniger Jahre die Produktionsverfahren für IT-Güter deutlich effizienter wurden. Bei einem durchschnittlichen Lebenszyklus eines PCs fallen heutzutage 70 % des Energieverbrauchs auf die Phase der Nutzung, während vor wenigen Jahren noch der Großteil der Energie während der Produktion verbraucht wurde [OECD10, S. 19].
Weiterhin kritisch bleibt der Materialeinsatz in der Produktion. Für die ITK-Branche werden viele seltene Metalle verwendet, deren Gewinnung schwierig und umweltschädlich ist. Bei weiterhin steigender Rohstoffnachfrage der ITK-Branche wird damit gerechnet, dass bei bestimmten Metallen wie Gallium und Germanium 2030 allein der Bedarf für IT-Komponenten die heutige weltweite Fördermenge übersteigt [BORD12, S. 70]. Darüber hinaus werden für Metalle wie Silber und Platin hohe Umweltverschmutzungen in Kauf genommen. Das Versauerungspotenzial, das durch die Jahresproduktion von Platin hervorgerufen wird, also die Summe aller Gase aus dem Gewinnungsprozess, die zur Versauerung der Umwelt beitragen können, entspricht dem der Roheisenproduktion – obwohl die Fördermenge von Roheisen 1,88 Millionen mal höher liegt als die von Platin [BORD12, S. 73].
3.1.2 Nachhaltigkeit durch IT
Das Ziel von Green durch IT besteht darin, Nachhaltigkeit in Bereichen außerhalb der IT, aber mit Unterstützung der IT zu schaffen. Das bereits angesprochene große Potenzial dieses Ansatzes [BORD12, S. 7f.] liegt auch in den mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten begründet, die sich über die verschiedensten Unternehmensbereiche und Branchen erstrecken. Eine Auswahl der durch IT-Unterstützung ermöglichten Nachhaltigkeit zeigt Abbildung 6, ohne bereits auf konkrete Maßnahmen einzugehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Ziele von Green durch IT
Eines der Ziele ist die Dematerialisierung physischer Güter, die bereits seit Mitte der 1990er Jahre mit der Forderung „bits instead of atoms“ [BOCG10, S. 57] kursiert. Diese bezieht sich zum einen auf die Entwicklung elektronischer Substitute für Medien wie Zeitungen, Bücher und Musik [BORD12, S. 65], wird im Geschäftsumfeld jedoch zumeist mit Virtual Conferencing und Telearbeit assoziert [BOCG10, S. 58]. Der Wegfall von Pendlerverkehr oder Dienstreisen findet sich auch in Smart Mobility & Logistics, wobei hier ebenfalls eine intelligente Verkehrsführung [BORD12, S. 62] und die Verbesserung von Lieferketten und Transportrouten in der Logistik [BOCG10, S. 42] berücksichtigt wird.
Unter Smart Buildings versteht man ein intelligentes Gebäudemanagement mit dem Ziel, „eine energetische Effizienzsteigerung in allen Stufen des Lebenszyklus von Gebäuden“ [BOCG10, S. 33] zu erreichen, unabhängig davon, ob es sich dabei um private, öffentliche oder gewerbliche Gebäude handelt. Die IT-gestützte Verbesserung der Abläufe in Industrieanlagen, die 28 % des Gesamtstroms in Deutschland verbrauchen [BORD12, S. 66], hin zu höherer Effizienz fällt unter den Begriff Smart Motors & Industry. Der Eingriff der Informationstechnik in die Steuerungsprozesse der Industrie führt hierbei nicht nur zu einem niedrigeren Energieverbrauch, meist lässt sich auch noch der Einsatz wertvoller Rohstoffe senken [BOCG10, S. 53].
Durch die Energiewende besonders ins Blickfeld gerückt ist das Konzept des Smart Grids, eines mit Informations- und Kommunikationstechnik ausgerüsteten Stromnetzes [BORD12, S. 58f.]. Da erneuerbare Energie bisher nicht speicherbar ist und großen Schwankungen unterliegt [BOCG10, S. 47], wird das Last- und Kapazitätsmanagement der Stromanbieter weiter an Bedeutung gewinnen. Die erhöhte Komplexität wird nur durch die Integration von Informationstechnologie zu bewältigen sein, die zukünftig auch die dezentrale Einspeisung von Strom seitens vieler Kleinstanbieter ermöglichen wird [BOCG10, S. 47].
3.2 Maßnahmen
Um diese Ziele durchzusetzen, ist es notwendig, weitreichende Maßnahmen zu ergreifen, die ganzheitlich und nicht nur auf einen Aspekt beschränkt sind. Das Fraunhofer-Institut untergliedert Green IT und die zu ergreifenden Maßnahmen in vier Themenkomplexe [FRAU09, S. 96], die Abbildung 7 zeigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Green-IT-Maßnahmen (in Anlehnung an [FRAU09, S. 95-104])
Während das Fraunhofer-Institut den vier Themenkomplexen nur Maßnahmen zuordnet, die dem Bereich „Green in der IT“ entstammen, erfolgt im Rahmen dieser Arbeit eine Erweiterung um die Maßnahmen, die unter „Green durch IT“ zu führen sind, jedoch unter Beibehaltung der verwendeten Begrifflichkeiten.
Unter den Aspekt Green Information fallen alle Maßnahmen, die Informationen mit Bezug auf Nachhaltigkeit bereitstellen, wie beispielsweise Energieeffizienzmessungen, und anhand derer Verbesserungen vorgenommen werden können [FRAU09, S. 96]. Green Information kann dadurch auch Einfluss auf das Nutzungsverhalten nehmen und erreicht somit auch die dritte Ebene der Green-IT-Definition [FRAU09, S. 102]. Green Components betrifft die Verwendung der, in Hinblick auf die Energieeffizienz, besten Hard- und Software [FRAU09, S. 96], was überwiegend den Bereich „Green in der IT“ betrifft. Wichtig ist hierbei nicht nur der Blick auf die individuelle Energiebilanz der einzelnen Komponenten, sondern der des gesamten Systems [FRAU09, S. 100]. Der Themenkomplex Green Networks, der vom Fraunhofer-Institut auf „leistungsfähige und ökoeffiziente Breitbandanschlüsse und Netzinfrastrukturen“ [FRAU09, S. 96] beschränkt wird, wird im weiteren Verlauf um die Aspekte Smart Mobility & Logistics sowie Smart Grid erweitert.
Der umfangreichste Themenkomplex Green Computing vereint alle ökonomischen Maßnahmen, die Server oder Rechenzentren betreffen [FRAU09, S. 96], aber auch ganz allgemein den Einsatz und die Verwendung von IKT unter ökologischen Aspekten.
3.2.1 Green Information
Durch sich verschärfende Wettbewerbsbedingungen gilt Information heute als ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, der, vor allem durch gezielte Ausnutzung von Informationsasymmetrien, zu Wettbewerbsvorteilen führen kann [PICO92, S. 32-40]. Auch in der Green IT spielen Informationen eine wichtige Rolle, weshalb sich die Bezeichnung Green Information etabliert hat. Während Privatpersonen sich durch Gütesiegel wie den Energy Star über die Energieeffizienz von Komponenten informieren können und auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes [BMDJ04] Zugriff auf die öffentlichen Umweltdaten haben, werden umweltrelevante Daten in einem Betrieb durch ein Betriebliches Umweltinformationssystem (BUIS) verwaltet.
Betriebliche Umweltinformationssysteme (BUIS)
Für eine ganzheitlich umgesetzte Green-IT-Strategie in einem Unternehmen sind umweltrelevante Informationen unerlässlich. Zur Erfassung der betrieblichen Umweltauswirkungen sowie zur Planung und Steuerung geeigneter Gegenmaßnahmen werden Betriebliche Umweltinformationssysteme (BUIS) eingesetzt [RAUT99, S. 11]. Die Anforderung, ökonomische und ökologische Aspekte zu harmonisieren, macht eine enge Verzahnung mit bereits vorhandenen ERP-Systemen notwendig, was darüber hinaus den Vorteil birgt, dass viele der benötigten Daten bereits im ERP-System vorhanden sind [RAUT99, S. 11]. Deshalb ist auch von einer isolierten Insellösung als BUIS abzuraten, sondern vielmehr auf Lösungen zurückzugreifen, die in das bestehende ERP-System integrierbar sind oder den Datenaustausch mit diesem über eine standardisierte Schnittstelle, wie etwa PAS 1025 [MEYE11, S. 278], abwickeln. SAP, der Marktführer in Deutschland für ERP-Software, bietet für seine Softwarelösungen sowohl eine dem PAS 1025-Standard entsprechende Schnittstelle als auch eine integrierte Lösung namens EHS-Management [SAPA13]. Neben ökologischen Verbesserungen können solche Systeme durch die von ihnen bereitgestellten Informationen zu Planungsinstrumenten ausgeweitet werden, die auch aus wirtschaftlicher Sicht hinsichtlich des Energie- und Materialverbrauchs lohnend sind [HAAS99, S. 1f.]. Darüber hinaus dienen sie der Kontrolle der Einhaltung von Umweltrichtlinien wie RoHS und WEEE [HAAS99, S. 4]. Trotz dieser Potenziale sind BUIS noch wenig verbreitet [PERL06, S. 3]. Gründe hierfür sind zum einen die fehlende Unterstützung durch die Geschäftsleitung [ARND99, S. 7] und fehlendes Querschnittswissen [ARND99, S. 7] als auch eine Kostenrechnung, die nicht in der Lage ist, die monetären Vorteile eines BUIS offenzulegen [ARND99, S. 8]. Weiterhin gibt es Probleme mit der Datenqualität, da unterschiedlichste Daten wie Verbrauchskoeffizienten, Emissionsobergrenzen und Materialstammdaten [HAAS99, S. 4] extrahiert, aktualisiert, harmonisiert und verarbeitet werden müssen.
Dass Green Information nicht nur für Unternehmen interessant ist, sondern auch in Privathaushalten großes Potenzial liegt, lässt allein die hohe Zahl von 41,3 Millionen Haushalten in Deutschland [STAT13a] vermuten. Durch die große Anzahl würden bereits kleine Einsparungen pro Haushalt große gesamtökologische Folgen haben. Eine Möglichkeit, durch Green Information in Privathaushalten, aber natürlich auch in Unternehmen, für Einsparungen zu sorgen, sind intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter.
Smart Meter
Ein Smart Meter ist laut dem Energiewirtschaftsgesetz ein Messsystem, das in ein Kommunikationsnetz eingebunden ist und „den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegelt“ [BMDJ05a, S. 53]. Konzepte, die durch die dadurch erreichte Transparenz zu Einsparungen führen, bezeichnet man als Smart Metering [BORD12, S. 115]. Der Einbau solcher intelligenter Zähler ist in Deutschland für Neubauten, Vollsanierungen und Verbraucher mit einem Jahresverbrauch von mehr als 6000 Kilowattstunden mittlerweile verpflichtend [BMDJ05a, S. 52], eine flächendeckende Umstellung scheiterte bisher jedoch an zu hohen Kosten [BORD12, S. 61].
Dabei bietet die von Smart Metern bereitgestellte Green Information sowohl den Kunden als auch den Stromkonzernen Vorteile. Für den Kunden sind die Stromkosten besser kalkulierbar und der Verbrauch würde bewusster erfolgen [BMWT13]. Darüber hinaus führt Preistransparenz zu mehr Wettbewerb im Energiebereich [BMWT13]. Für die Stromkonzerne bietet sich durch flexible Preisgestaltung die Möglichkeit, Anreize zu schaffen, die Verbrauchspitzen verringern und so den Stromverbrauch und die Stromerzeugung harmonisieren [BMWT13].
In Testhaushalten ist der Stromverbrauch mithilfe digitaler Stromzähler um 5 – 40 % gesunken [BITK08, S. 1], wobei anzumerken ist, dass die hohen Einsparungen hier überwiegend durch Einzelmaßnahmen, wie den Austausch von Altgeräten mit hohem Stromverbrauch zustande kamen [BORD12, S. 61]. Zusätzlich ist ein Rebound-Effekt möglich, da Smart Meter im Gegensatz zu analogen Stromzählern einen Eigenverbrauch an Strom haben [BORD12, S. 59], was aber durch daraus folgende Einsparungen kompensiert werden sollte. So entfallen beispielsweise die CO2-Emissionen, die durch das Anfahren der Kunden zum Ablesen der Zähler entstanden, da Smart Meter durch ihre Anbindung an das Kommunikationsnetz eine automatische Zählerablesung ermöglichen. Das Thema Datenschutz, das in Deutschland immer eine große Rolle spielt und durch die große anfallende Datenmenge, die Einbindung in das Kommunikationsnetz sowie die Möglichkeit der Fernsteuerung auch bei Smart Metern relevant ist, wird durch das Energiewirtschaftsgesetz dahingehend geregelt, dass Smart Meter entsprechend einem Schutzprofil zertifiziert werden müssen [BMDJ05a, S. 53]. Die Masse der durch digitale Stromzähler anfallenden Daten stellt die Energieversorger dabei vor eine weitere Herausforderung. Wurden Verbrauchsdaten der Kunden bisher einmal jährlich erhoben, ergeben sich nun bei einem Abfrageintervall von 15 Minuten 35.000 Verbrauchsdaten pro Smart Meter und Jahr [HACK11]. Da zukünftig eher kürzere Intervalle zu erwarten sind – moderne Smart Meter liefern alle ein bis zwei Sekunden Werte [ZOER13, S. 3] – müssen die Energiedienstleister ihre IT-Systeme entsprechend anpassen, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Die generierten Daten bieten jedoch auch die Möglichkeit, die Energieverbrauchssteuerung durch eine Big-Data-Analyse intelligenter zu gestalten. Der Begriff Big Data tauchte in den letzten Jahren vermehrt auf und beschreibt große Datenmengen, die mit traditionellen Datenbank-Tools nicht mehr zu analysieren sind und für die neue Analysemethoden gefunden werden müssen [OHLH13, S. 1]. Zur Auswertung der Daten aus Stromzählern wird überwiegend der Algorithmus MapReduce genutzt, der auch bei Suchmaschinen Verwendung findet [ZOER13, S. 2]. Dadurch erhöht sich die Prognosequalität des Stromverbrauchs, was direkten Einfluss auf den Strompreis hat und kurzfristige Schwankungen kompensieren kann [ZOER13, S. 3]. Aber auch für Großkunden kann es interessant sein, die individuellen Lastprofile zu kennen und so eventuell Verbesserungspotenzial am eigenen Stromverbrauch zu finden.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "Green IT"?
Green IT umfasst energieeffiziente Hardware und Infrastruktur sowie IT-Lösungen, die zur Nachhaltigkeit in anderen Bereichen (z.B. Logistik) beitragen.
Was ist der Unterschied zwischen "Green in der IT" und "Green durch IT"?
"Green in der IT" fokussiert auf den Eigenverbrauch der IT (Kühlung, Komponenten), während "Green durch IT" die Einsparungen in anderen Sektoren durch IT-Steuerung meint.
Warum ist Green IT für den Mittelstand wichtig?
Es ermöglicht erhebliche Kostensenkungen durch geringeren Energieverbrauch und erschließt neue Märkte durch ein nachhaltiges Image.
Wie hoch ist der Stromverbrauch der IKT in Deutschland?
Laut Daten von 2007 betrug er ca. 55 Terawattstunden (TWh), was etwa 10,5 % des gesamten jährlichen Stromverbrauchs entsprach.
Was ist das Verursacherprinzip in der Umweltpolitik?
Es besagt, dass derjenige, der Umweltschäden verursacht, auch für deren Beseitigung oder die Kosten der Belastung aufkommen muss.
- Citation du texte
- Niklas Reisinger (Auteur), 2013, Green-IT-Strategien für den Mittelstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265227