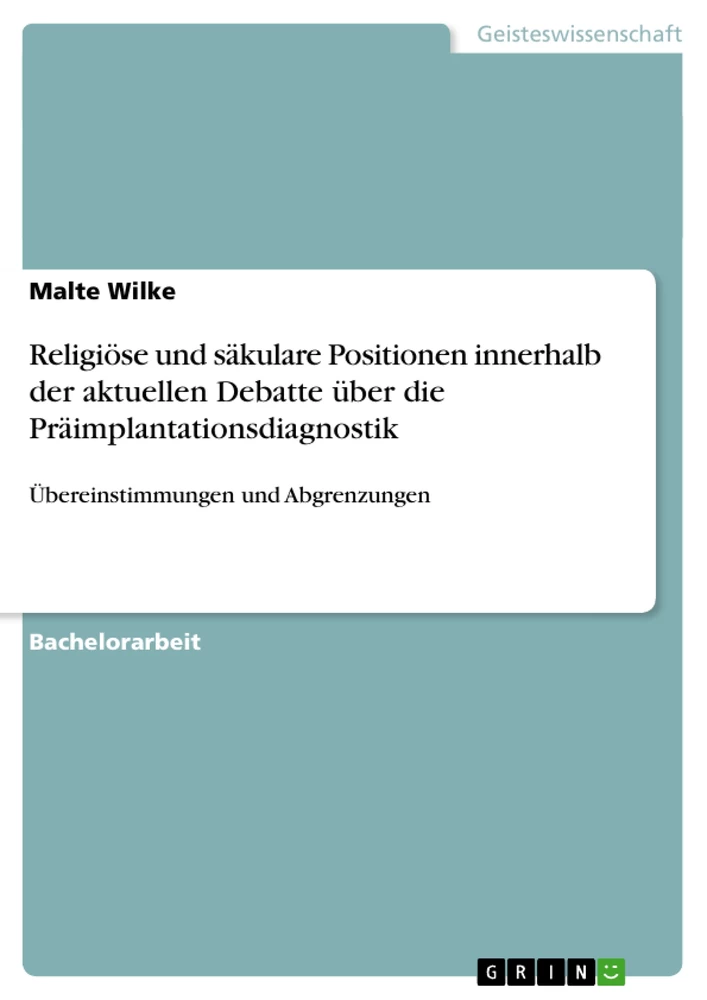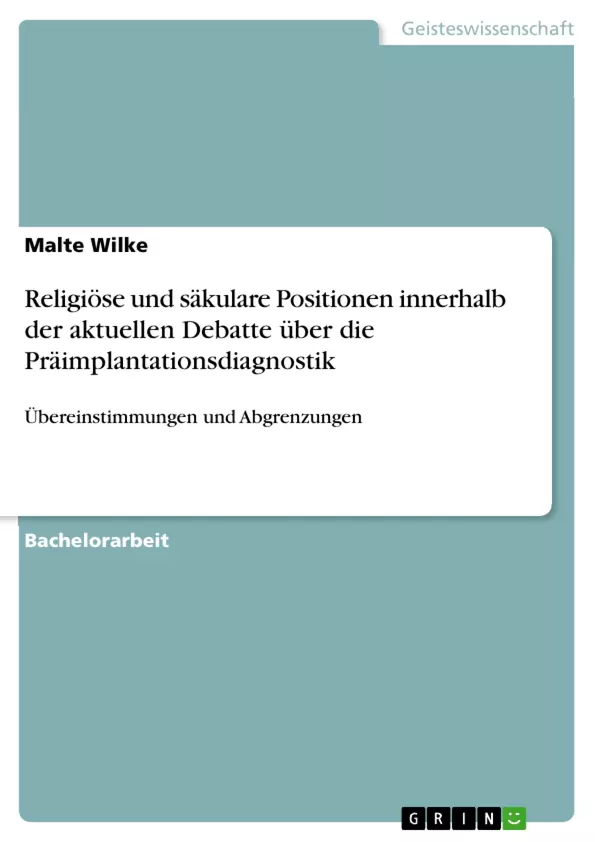„Tolle lege!“ – Diese Worte aus den Bekenntnissen des Kirchenlehrers, Bischofs und Philosophen Augustinus (354 – 430 n. Chr.) beschreiben eine zugespitzte biographische Umbruchsituation. Sein autobiographisches Werk „Confessiones“ schildert, sicherlich in manchen Teilen glättend, seine lebensgeschichtliche Entwicklung. Sie beginnt mit dem Aufwachsen in Nordafrika als ungetauftes Kind christlicher Eltern. Dann folgen Jahre jugendlicher Selbsterprobung und Ausschweifung, aber auch der ihn faszinierenden Beschäftigung mit dem römischen Philosophen Cicero. Als Rhetoriklehrer in Karthago, Rom und Mailand tätig, wiederentdeckt er in Form der platonisierenden Bibelauslegung das Alte und Neue Testament, insbesondere die paulinischen Briefe. Im Jahre 386 widerfährt ihm ein religiöses Bekehrungserlebnis. Er schildert es wie folgt: Seine Mutter erkennt seine existenzielle und religiöse Ungesichertheit („Was stehst du auf dich fußend, und stehst nicht fest? Wirf dich auf ihn, fürchte dich nicht, er wird dich nicht verlassen, so daß du fielest; wirf dich auf ihn ohne Sorgen, er wird dich aufnehmen und dich heilen.“) Augustinus, so seine Selbstbeschreibung, errötet daraufhin, zweifelt, und wird, von einem inneren „Gewittersturm“ getrieben, bis ein kindlicher Singsang ihm beruhigend einflüstert: „Nimm und lies! Nimm und lies!“ Er begreift diesen Appell in folgender Weise: Nämlich „daß ein göttlicher Befehl mir die heilige Schrift zu öffnen heiße und daß ich das erste Kapitel, auf welches mein Auge fallen würde, lesen sollte.“ So stieß er auf folgende biblische Textstelle: „Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern ziehet an den Herrn Jesum Christum und wartet des Leibes, doch also, daß er nicht geil werde. Ich las nicht weiter, es war wahrlich nicht nötig, denn alsbald am Ende dieser Worte kam das Licht des Friedens über mein Herz und die Nacht des Zweifels entfloh.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Bemerkungen
- Diagnostische Verfahren im Vorfeld und während einer Schwangerschaft
- Anmerkungen zur Pränataldiagnostik
- Anmerkungen zur Präimplantationsdiagnostik
- „In dubio pro embryone?“ – Zur Diskussion um die PID anhand der Frage nach der Wertigkeit der dabei anfallenden Embryonen
- Frühe Positionen innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschlands
- Robert Spaemann als Kantianer und Katholik
- Die Position der deutschen Bischofskonferenz: In dubio pro vita.
- „Und sie bewegt sich nicht“ – Das katholische Verständnis des Embryonenschutzes als monolithische Größe
- Naturwissenschaftliche Überlegungen gegen katholische Verlautbarungen (1. Säkulare Gegenposition)
- „Und sie bewegt sich doch“ – Meinungsvielfalt und Kurskorrekturen in der Evangelischen Kirche
- Säkulare Positionen innerhalb der Debatte um die rechtliche Zulassung der PID
- Zum Begriff der Säkularisierung
- Der Deutsche Ethikrat: Die reproduktive Selbstbestimmung als umstrittene Größe.
- Alice Schwarzer und Eva Menasse: Die reproduktive Selbstbestimmung als kategorische Größe
- Die Humanistische Union: Die Verteidigung der Mutter- und Elternrechte als Kernanliegen innerhalb der PID-Debatte
- Die Giordano Bruno Stiftung: Vom Schlagwort zur rationalen Argumentation im Rahmen der PID-Debatte
- Zum Selbstverständnis der Giordano Bruno Stiftung.
- Abgrenzung der Giordano Bruno Stiftung zu religiösen Positionen und zum Deutschen Ethikrat
- Schlussbetrachtungen oder „Der Mensch entdeckt sich, wenn er sich an Widerständen misst.“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die religiösen und säkularen Positionen in der Debatte um die Präimplantationsdiagnostik (PID) in Deutschland. Sie analysiert Übereinstimmungen und Differenzen zwischen diesen Positionen im Kontext der europäischen Säkularisierung. Der Fokus liegt auf der ethischen Bewertung der PID und der damit verbundenen Fragen nach der Wertigkeit von Embryonen und der reproduktiven Selbstbestimmung.
- Die ethische Bewertung der Präimplantationsdiagnostik (PID).
- Der Einfluss religiöser und säkularer Weltanschauungen auf die PID-Debatte.
- Die Rolle der reproduktiven Selbstbestimmung in der Diskussion.
- Die Auseinandersetzung verschiedener Interessengruppen (Kirche, Ethikrat, etc.).
- Der Vergleich von religiösen und säkularen Argumentationen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Bemerkungen: Die Einleitung verwendet Augustinus' Bekehrungserlebnis als Metapher für den Prozess des „Lesens“ – vom Verständnis des genetischen Codes bis zur religiösen Interpretation. Sie stellt den Gegensatz zwischen religiöser und wissenschaftlicher Perspektive dar und kündigt den Fokus der Arbeit auf die Auseinandersetzung religiöser und säkularer Positionen in der PID-Debatte an, wobei der historische Kontext der Säkularisierung berücksichtigt wird.
Diagnostische Verfahren im Vorfeld und während einer Schwangerschaft: Dieses Kapitel beschreibt die Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik (PID). Es beleuchtet die neuen Möglichkeiten der Familienplanung, die die PID bietet, und gleichzeitig die damit verbundenen ethischen Fragen und den internationalen Vergleich der rechtlichen Regulierung, besonders im Bezug auf den „PID-Tourismus“ in Deutschland.
„In dubio pro embryone?“ – Zur Diskussion um die PID anhand der Frage nach der Wertigkeit der dabei anfallenden Embryonen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Positionen innerhalb der Debatte um die PID. Es beleuchtet die Entwicklung der Positionen der evangelischen Kirche, die Haltung von Robert Spaemann sowie die der deutschen Bischofskonferenz. Es zeigt die Vielfalt der katholischen Ansichten zum Embryonenschutz und stellt diese den naturwissenschaftlichen Argumenten gegenüber. Schließlich betrachtet es die Entwicklung und die Meinungsvielfalt innerhalb der evangelischen Kirche zum Thema PID.
Säkulare Positionen innerhalb der Debatte um die rechtliche Zulassung der PID: Dieses Kapitel konzentriert sich auf säkulare Positionen in der PID-Debatte. Es beleuchtet den Begriff der Säkularisierung selbst und analysiert die Ansichten des Deutschen Ethikrates zur reproduktiven Selbstbestimmung. Weiterhin werden die Positionen von Alice Schwarzer und Eva Menasse, der Humanistischen Union und der Giordano Bruno Stiftung untersucht, inklusive deren Selbstverständnis und Abgrenzung zu religiösen Positionen und dem Deutschen Ethikrat.
Schlüsselwörter
Präimplantationsdiagnostik (PID), Embryonenschutz, Reproduktive Selbstbestimmung, Säkularisierung, Religiöse Ethik, Säkulare Ethik, Deutscher Ethikrat, Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Bioethik, Menschenwürde, Genetische Diagnostik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Religiöse und Säkulare Positionen in der Debatte um die Präimplantationsdiagnostik (PID) in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die religiösen und säkularen Positionen in der Debatte um die Präimplantationsdiagnostik (PID) in Deutschland. Sie analysiert Übereinstimmungen und Differenzen zwischen diesen Positionen im Kontext der europäischen Säkularisierung und konzentriert sich auf die ethische Bewertung der PID sowie die damit verbundenen Fragen nach der Wertigkeit von Embryonen und der reproduktiven Selbstbestimmung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die ethische Bewertung der PID, den Einfluss religiöser und säkularer Weltanschauungen auf die Debatte, die Rolle der reproduktiven Selbstbestimmung, die Auseinandersetzung verschiedener Interessengruppen (Kirche, Ethikrat etc.) und vergleicht religiöse und säkulare Argumentationen. Sie umfasst auch eine Beschreibung der Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik sowie die Analyse verschiedener Positionen innerhalb der Debatte (katholische Kirche, evangelische Kirche, Robert Spaemann, Deutscher Ethikrat, Alice Schwarzer, Eva Menasse, Humanistische Union, Giordano Bruno Stiftung).
Welche Positionen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht die Positionen der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland, insbesondere die Entwicklung der Positionen der evangelischen Kirche und die Haltung der deutschen Bischofskonferenz. Sie analysiert die Ansichten von Robert Spaemann, den Deutschen Ethikrat, Alice Schwarzer, Eva Menasse, die Humanistische Union und die Giordano Bruno Stiftung. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Vielfalt der katholischen Ansichten zum Embryonenschutz als auch die naturwissenschaftlichen Gegenargumente.
Wie wird die Säkularisierung in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet die PID-Debatte im Kontext der europäischen Säkularisierung. Sie analysiert, wie die Säkularisierung die Argumentationen und Positionen in der Debatte beeinflusst und welche Rolle der Begriff der Säkularisierung selbst in der Diskussion spielt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitende Bemerkungen, Diagnostische Verfahren im Vorfeld und während einer Schwangerschaft, „In dubio pro embryone?“ – Zur Diskussion um die PID anhand der Frage nach der Wertigkeit der dabei anfallenden Embryonen, Säkulare Positionen innerhalb der Debatte um die rechtliche Zulassung der PID und Schlussbetrachtungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Präimplantationsdiagnostik (PID), Embryonenschutz, Reproduktive Selbstbestimmung, Säkularisierung, Religiöse Ethik, Säkulare Ethik, Deutscher Ethikrat, Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Bioethik, Menschenwürde, Genetische Diagnostik.
Welche Methodik wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse der religiösen und säkularen Positionen in der PID-Debatte. Sie untersucht die Argumentationsstrukturen und die zugrundeliegenden Wertevorstellungen der verschiedenen Akteure und Akteurgruppen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im Kapitel "Schlussbetrachtungen" zusammengefasst und beziehen sich auf die Vielfalt der Positionen und die komplexen ethischen Herausforderungen, die mit der PID verbunden sind. Die Arbeit veranschaulicht die Auseinandersetzung zwischen religiösen und säkularen Argumenten im Kontext der Säkularisierung.
- Citar trabajo
- Malte Wilke (Autor), 2011, Religiöse und säkulare Positionen innerhalb der aktuellen Debatte über die Präimplantationsdiagnostik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265248