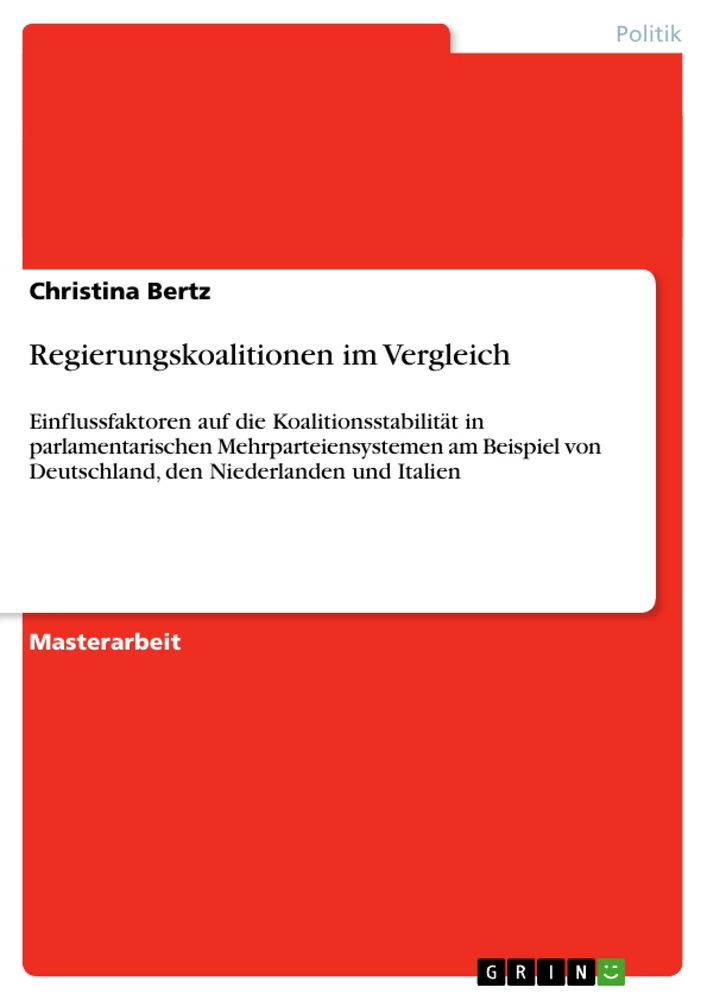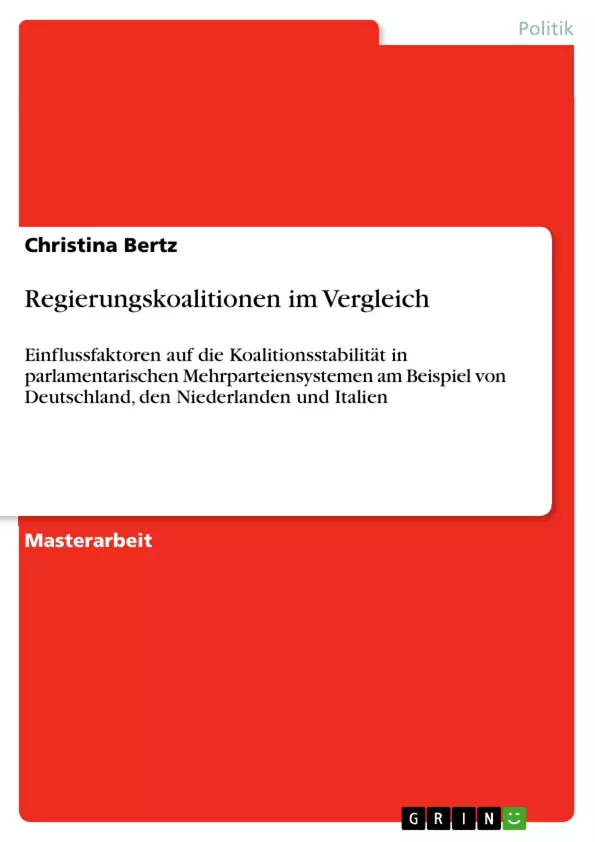1. Einleitung
Politische Systeme sind keine starren Gebilde, sondern ein Ort für zahlreiche Wandlungsprozesse. Ein Beispiel hierfür sind die Parteiensysteme der parlamentarischen Demokratien in Europa. So gibt es heute kaum noch Zwei-Parteiensysteme. Stattdessen haben sich aufgrund von zahlreichen Neugründungen und Abspaltungsprozessen in den meisten Ländern Mehrparteiensysteme entwickelt (vgl. Niedermayer 2008: 360f.).
Diese Tatsache hat zwei wesentliche Folgen. Zum einen geht von Mehrparteiensystemen ein spezieller Einfluss auf Wahlen beziehungsweise auf Wahlergebnisse aus. In Ländern mit einer hohen Parteienanzahl erreicht selten eine Partei die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament, sodass Koalitionsregierungen aus mindestens zwei Parteien gebildet werden müssen (vgl. Saalfeld 2007: 217). Zum anderen besitzt dieser Zwang zur Koalitionsbildung wiederum einen großen Einfluss auf die politischen Akteure, da eine größere Kompromiss- und Verhandlungsbereitschaft aufgebracht werden muss, als wenn lediglich eine Partei die Regierungsverantwortung trägt.
Die Dauer der Kooperation wird von den nationalen Verfassungen in Form von zeitlich begrenzten Legislaturperioden festgelegt. Zahlreiche Untersuchungen der europäischen Regierungskoalitionen zeigen jedoch, dass deutliche Unterschiede zwischen der durch die Legislaturperiode festgelegten und der tatsächlichen Lebenszeit von Koalitionsregierungen vorhanden sind (vgl. Saalfeld 2010: 499f.).
Diese Untersuchungsergebnisse lassen die Frage aufkommen, wie diese Unterschiede zustande gekommen sind, beziehungsweise welche Faktoren sich auf die unterschiedlichen Koalitionsstabilitäten auswirken.
1.1. Fragestellung
Aufgrund der bestehenden Unterschiede hinsichtlich der Koalitionsstabilitäten in parlamentarischen Mehrparteiensystemen werden im Rahmen dieser Masterarbeit die einzelnen Einflussfaktoren näher untersucht. Die Untersuchungsfrage lautet somit:
Welche Faktoren wirken sich auf die Stabilität von Koalitionsregierungen aus?
Für die Beantwortung dieser Frage wurden drei Hypothesen gebildet. Diese Hypothesen lassen sich aus den Forschungsergebnissen, der im zweiten Kapitel vorgestellten Theorien der Koalitionsforschung, ableiten. Da die Theorien der Koalitionsforschung häufig den Schwerpunkt auf die parteipolitischen Rahmenbedingungen und Akteure legen, haben zwei der drei Hypothesen einen Bezug zum Parteiensystem. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Fragestellung
- 1.2. Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretischer Rahmen zur Koalitionsstabilität in parlamentarischen Mehrparteiensystemen
- 2.1. Überblick über den Forschungsstand
- 2.1.1. Spieltheoretische Modelle
- 2.1.2. Strukturalistische Ansätze
- 2.1.3. Zufallsereignisse und kombinierte Ansätze
- 2.1.4. Die Rolle des Koalitionsformates
- 2.2. Analyserahmen: Einflussfaktoren auf die Koalitionsstabilität
- 2.2.1. Institutionelle Rahmenbedingungen
- 2.2.1.1. Einflüsse des Wahlsystems
- 2.2.1.2. Regelungen zur Regierungsbildung und Regierungsauflösung
- 2.2.2. Merkmale des Parteiensystems
- 2.2.2.1. Grad der Fragmentierung
- 2.2.2.2. Ideologische Distanzen und vorhandene Cleavagestrukturen
- 2.2.3. Historische Entwicklungen und politische Traditionen
- 2.2.3.1. Vorherrschende Koalitionsformate
- 2.2.3.2. Koalitionsabkommen
- 2.2.4. Zufallsereignisse
- 3. Regierungskoalitionen in Deutschland
- 3.1. Institutionelle Rahmenbedingungen
- 3.1.1. Einflüsse des Wahlsystems
- 3.1.2. Regelungen zur Regierungsbildung und Regierungsauflösung
- 3.2. Merkmale des Parteiensystems
- 3.2.1. Grad der Fragmentierung
- 3.2.2. Ideologische Distanzen und vorhandene Cleavagestrukturen
- 3.3. Historische Entwicklungen und Politische Traditionen
- 3.3.1. Vorherrschende Koalitionsformate
- 3.3.2. Koalitionsabkommen
- 3.4. Zufallsereignisse
- 4. Regierungskoalitionen in den Niederlanden
- 4.1. Institutionelle Rahmenbedingungen
- 4.1.1. Einflüsse des Wahlsystems
- 4.1.2. Regelungen zur Regierungsbildung und Regierungsauflösung
- 4.2. Merkmale des Parteiensystems
- 4.2.1. Grad der Fragmentierung
- 4.2.2. Ideologische Distanzen und vorhandene Cleavagestrukturen
- 4.3. Historische Entwicklungen und Politische Traditionen
- 4.3.1. Vorherrschende Koalitionsformate
- 4.3.2. Koalitionsabkommen
- 4.4. Zufallsereignisse
- 5. Regierungskoalitionen in Italien
- 5.1. Institutionelle Rahmenbedingungen
- 5.1.1. Einflüsse des Wahlsystems
- 5.1.2. Regelungen zur Regierungsbildung und Regierungsauflösung
- 5.2. Merkmale des Parteiensystems
- 5.2.1. Grad der Fragmentierung
- 5.2.2. Ideologische Distanzen und vorhandene Cleavagestrukturen
- 5.3. Historische Entwicklungen und Politische Traditionen
- 5.3.1. Vorherrschende Koalitionsformate
- 5.3.2. Koalitionsabkommen
- 5.4. Zufallsereignisse
- 6. Vergleich der Länderbeispiele
- 6.1. Länderübergreifende Einflussfaktoren
- 6.2. Unterschiede/ Länderspezifische Einflussfaktoren
- 6.3. Überprüfung der Hypothesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Einflussfaktoren auf die Stabilität von Regierungskoalitionen in parlamentarischen Mehrparteiensystemen. Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Faktoren zu identifizieren und ihre relative Bedeutung zu bewerten. Drei Länder – Deutschland, die Niederlande und Italien – werden vergleichend analysiert.
- Einfluss des Parteiensystems auf die Koalitionsstabilität
- Rolle institutioneller Rahmenbedingungen
- Bedeutung historischer Entwicklungen und politischer Traditionen
- Auswirkungen des Grades der Parteienfragmentierung
- Gewicht von Zufallsereignissen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Koalitionsstabilität in parlamentarischen Mehrparteiensystemen ein und beschreibt den Wandel von Zwei- zu Mehrparteiensystemen in Europa. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Einflussfaktoren auf die Koalitionsstabilität und formuliert drei Hypothesen: die Bedeutung der Merkmale des Parteiensystems, den Einfluss der Parteienfragmentierung und die Wirkung von institutionellen Rahmenbedingungen sowie politischen Traditionen im Vergleich zu Zufallsereignissen. Die methodische Vorgehensweise, basierend auf einem "most dissimilar case"-Design mit den Fallstudien Deutschland, Niederlande und Italien, wird erläutert.
Schlüsselwörter
Koalitionsstabilität, Mehrparteiensysteme, Parteiensystem, Institutionelle Rahmenbedingungen, Wahlsystem, Regierungsbildung, Koalitionsabkommen, Fragmentierung, Ideologische Distanzen, Historische Entwicklungen, Zufallsereignisse, Deutschland, Niederlande, Italien, Vergleichende Politikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Einflussfaktoren auf die Stabilität von Regierungskoalitionen in parlamentarischen Mehrparteiensystemen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Einflussfaktoren auf die Stabilität von Regierungskoalitionen in parlamentarischen Mehrparteiensystemen. Sie analysiert verschiedene Faktoren und bewertet deren relative Bedeutung im Vergleich.
Welche Länder werden in der Arbeit vergleichend analysiert?
Die Arbeit analysiert vergleichend drei Länder: Deutschland, die Niederlande und Italien.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des Parteiensystems, der Rolle institutioneller Rahmenbedingungen, der Bedeutung historischer Entwicklungen und politischer Traditionen, den Auswirkungen des Grades der Parteienfragmentierung und dem Gewicht von Zufallsereignissen auf die Koalitionsstabilität.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Faktoren beeinflussen die Stabilität von Regierungskoalitionen in parlamentarischen Mehrparteiensystemen?
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet ein "most dissimilar case"-Design, um die drei Länder Deutschland, Niederlande und Italien vergleichend zu analysieren.
Welche Hypothesen werden formuliert?
Die Arbeit formuliert Hypothesen zur Bedeutung der Merkmale des Parteiensystems, zum Einfluss der Parteienfragmentierung und zur Wirkung von institutionellen Rahmenbedingungen sowie politischen Traditionen im Vergleich zu Zufallsereignissen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Rahmen, Kapitel zu den Fallstudien Deutschland, Niederlande und Italien, ein Vergleichskapitel und ein Fazit. Das Inhaltsverzeichnis detailliert die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche institutionellen Rahmenbedingungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Wahlsystems und die Regelungen zur Regierungsbildung und -auflösung auf die Koalitionsstabilität.
Welche Merkmale des Parteiensystems werden berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet den Grad der Fragmentierung und die ideologischen Distanzen sowie vorhandene Cleavagestrukturen im Parteiensystem.
Wie werden historische Entwicklungen und politische Traditionen einbezogen?
Die Arbeit analysiert vorherrschende Koalitionsformate und Koalitionsabkommen in den jeweiligen Ländern.
Wie wird der Einfluss von Zufallsereignissen berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Zufallsereignisse die Koalitionsstabilität beeinflussen.
Wie werden die Länderbeispiele verglichen?
Das Vergleichskapitel identifiziert länderübergreifende und länderspezifische Einflussfaktoren und überprüft die formulierten Hypothesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Koalitionsstabilität, Mehrparteiensysteme, Parteiensystem, Institutionelle Rahmenbedingungen, Wahlsystem, Regierungsbildung, Koalitionsabkommen, Fragmentierung, Ideologische Distanzen, Historische Entwicklungen, Zufallsereignisse, Deutschland, Niederlande, Italien, Vergleichende Politikwissenschaft.
- Citar trabajo
- Christina Bertz (Autor), 2013, Regierungskoalitionen im Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265285