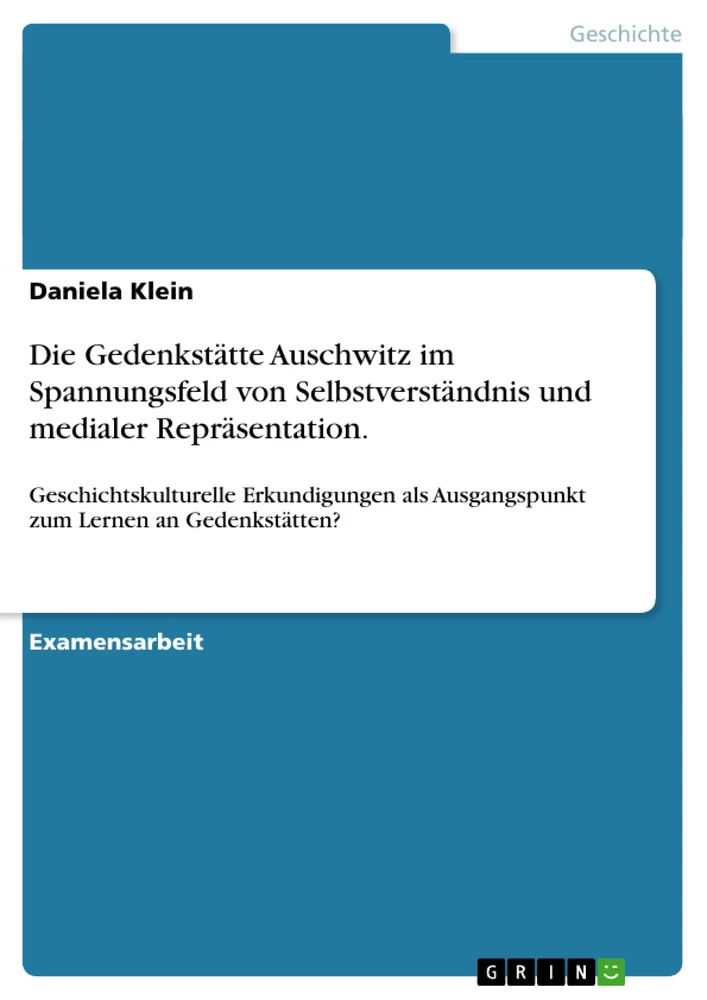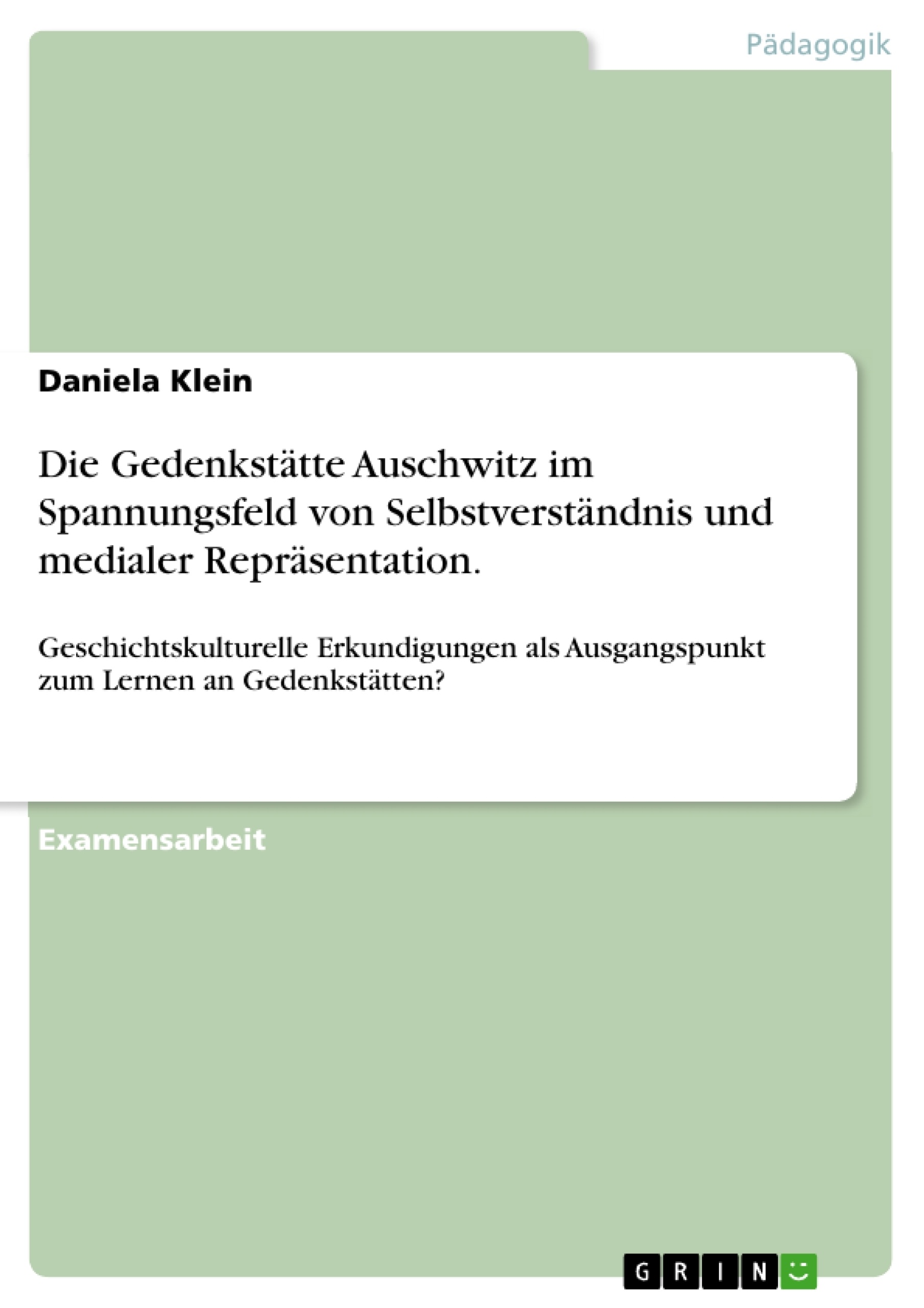Im Sommer 1986 verfasste Ernst Nolte einen Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ; dieser Text und die Antwort von Jürgen Habermas lösten in der Folge den sogenannten „Historikerstreit“ aus. Da dieser Konflikt bereits zur Genüge debattiert wurde, wird auf seinen Inhalt nicht weiter eingegangen. Die Aussage der Artikelüberschrift „Vergangenheit, die nicht vergehen will“ muss vom Kontext losgelöst jedoch als falsch deklariert werden. Vergangenheit, die nicht vergehen will, gibt es nicht – sie ist zwangsläufig vergangen. Vielmehr noch ist sie nicht nur unwiderruflich vergangen, sondern zudem statisch und unwandelbar geworden. Ganz und gar nicht statisch hingegen sind die gegenwärtigen Perspektiven von Historikern und generell allen Menschen, die auf vergangene Ereignisse und Zeitspannen zurückblicken. Die Geschichtswissenschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Quellenarbeit und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln, ein möglichst objektives Bild des Gewesenen zu rekonstruieren und zu interpretieren. Diesem Anspruch müssen Medien und Gesellschaft jedoch nicht entsprechen. Dadurch sind Konflikte aller Art, insbesondere solche, deren Wurzeln in der Vergangenheit liegen, von einem Spannungsfeld unterschiedlicher Ansichten und Absichten geprägt. Dieser Umstand lässt sich auch am Umgang mit dem Konzentrationslager Auschwitz bzw. der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau beobachten.
Der Titel dieser Arbeit verspricht die Darstellung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im Spannungsfeld von Selbstverständnis und medialer Repräsentation. Die umfassende Präsentation dieses einen Spannungsfeldes bleibt aber unmöglich, da sowohl das Selbstverständnis auf der einen, als auch die mediale Repräsentation auf der anderen Seite jeweils immense Spannungsfelder in sich bergen. Deshalb werden diese beiden spannungsreichen Thematiken getrennt voneinander vorgestellt. Doch selbst dann sind diese Themenfelder zu umfangreich, als dass eine Darstellung ebendieser jemals den Anspruch auf Vollständigkeit erheben dürfte. Für diese Arbeit bedeutet das eine Zweiteilung der Fragestellung. Auf der einen Seite steht die Frage nach dem Selbstverständnis der betroffenen Personengruppen: Wie verorten sich Anwohner und ehemalige Häftlinge im Spannungsfeld zwischen Gedenkstätte und Lebensraum?[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Stadt Oświęcim, das Konzentrationslager Auschwitz und die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
- Oświęcim bis 1939
- Das Konzentrationslager Auschwitz 1941 bis 1945
- Vom Konzentrationslager zur Gedenkstätte
- Oświęcim und die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im 21. Jahrhundert
- Die Konflikte zwischen Oświęcim und der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
- Das Spannungsfeld der Selbstverständnisse rund um die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
- Erinnerungstheorien
- Kollektives Gedächtnis und Erinnerungsorte
- Zusammenfassende Erkenntnisse der Erinnerungstheorien für die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
- Entwicklung eines Selbstverständnisses der dritten Generation gegenüber der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
- „Auschwitz“ im polnischen Gedächtnis bzw. das polnische Selbstverständnis
- „Auschwitz“ im deutschen Gedächtnis bzw. das deutsche Selbstverständnis
- „Auschwitz“ im jüdischen Gedächtnis bzw. das jüdische Selbstverständnis
- Universelles Selbstverständnis – eine aktuelle Entwicklung
- Die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im Spannungsfeld medialer Repräsentation und historischen Wissens
- Die öffentliche Wahrnehmung deutscher Gedenkstätten vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung
- Geschichtskulturelle Entwicklungen in Deutschland
- Tendenzen der Repräsentation der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, des Holocausts und der NS-Zeit in den deutschen Medien
- Mediale und erinnerungskulturelle Omnipräsenz von Auschwitz, Holocaust und NS-Zeit als Grundlage reichhaltigen historischen Wissens der dritten Generation?
- Geschichtskulturelle Erkundigungen als Ausgangspunkt zum Lernen an Gedenkstätten? - Wege aus der Unwissenheit
- Mediale Darstellungen ohne Substanz - Gedenken ohne Erinnerung?
- Die NS-Zeit im Geschichtsunterricht – Ein Erweiterungsvorschlag
- Der Gedenkstättenbesuch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im Spannungsfeld ihres Selbstverständnisses und ihrer medialen Repräsentation. Sie analysiert die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen der Geschichte von Auschwitz, insbesondere im Kontext der dritten Generation nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Arbeit fragt nach dem Einfluss medialer Darstellungen auf das Verständnis und die Erinnerung an den Holocaust.
- Das Selbstverständnis der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
- Die Rolle der Medien in der Erinnerung an den Holocaust
- Die Perspektiven verschiedener nationaler Gedächtnisse (polnisch, deutsch, jüdisch)
- Die Herausforderungen des Lernens an Gedenkstätten
- Die Bedeutung geschichtskultureller Erkundigungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den „Historikerstreit“ als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der Dynamik von Erinnerung und Geschichtswissenschaft. Sie betont die Diskrepanz zwischen der unveränderlichen Vergangenheit und den stets wandelnden Interpretationen derselben. Der Fokus liegt auf dem Umgang mit dem Konzentrationslager Auschwitz und der Gedenkstätte, die als Beispiel für dieses Spannungsfeld dienen.
Die Stadt Oświęcim, das Konzentrationslager Auschwitz und die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über Oświęcim, die Entwicklung des Konzentrationslagers Auschwitz und den Prozess seiner Transformation zur Gedenkstätte. Es beschreibt die geschichtliche Entwicklung von Oświęcim vor dem Zweiten Weltkrieg, die Errichtung und Funktionsweise des Lagers, sowie die Herausforderungen bei der Umwandlung in einen Ort der Erinnerung und des Gedenkens. Das Kapitel legt den Grundstein für die späteren Analysen der komplexen Identität dieses Ortes.
Oświęcim und die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im 21. Jahrhundert: Dieser Abschnitt befasst sich mit den aktuellen Konflikten und Herausforderungen, denen die Gedenkstätte gegenübersteht. Er analysiert die Spannungen zwischen der Stadt Oświęcim und der Gedenkstätte, sowie die unterschiedlichen Selbstverständnisse und Deutungen, die mit dem Ort verbunden sind. Die Kapitel untersucht die verschiedenen Interessen und Perspektiven, die zu Konflikten führen und wie diese das Gedenken beeinflussen.
Erinnerungstheorien: Das Kapitel beschäftigt sich mit relevanten Erinnerungstheorien, insbesondere mit dem Konzept des kollektiven Gedächtnisses und der Bedeutung von Erinnerungsorten. Es untersucht, wie diese Theorien zum Verständnis der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau beitragen und wie sie die verschiedenen Perspektiven und Interpretationen der Geschichte beleuchten. Die zentralen Erkenntnisse der Erinnerungstheorien werden im Hinblick auf die Gedenkstätte zusammenfassend dargelegt.
Entwicklung eines Selbstverständnisses der dritten Generation gegenüber der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau: Dieser Abschnitt untersucht die unterschiedlichen Perspektiven der dritten Generation auf Auschwitz, unterteilt nach polnischem, deutschem und jüdischem Selbstverständnis. Er analysiert die spezifischen Erinnerungen und Interpretationen innerhalb dieser Gruppen und wie diese das Verhältnis zur Gedenkstätte prägen. Der Abschnitt führt zu der Frage eines möglichen universellen Selbstverständnisses.
Die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im Spannungsfeld medialer Repräsentation und historischen Wissens: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Medien in der Repräsentation der Gedenkstätte und des Holocausts. Es untersucht die Entwicklung der öffentlichen Wahrnehmung deutscher Gedenkstätten, die geschichtskulturellen Entwicklungen in Deutschland und die Tendenzen der medialen Darstellung von Auschwitz, Holocaust und NS-Zeit. Der Fokus liegt auf dem Einfluss der Medien auf das historische Wissen der dritten Generation.
Geschichtskulturelle Erkundigungen als Ausgangspunkt zum Lernen an Gedenkstätten? - Wege aus der Unwissenheit: Das Kapitel diskutiert die Bedeutung geschichtskultureller Erkundigungen für das Lernen an Gedenkstätten. Es beleuchtet kritisch die problematischen Aspekte medialer Darstellungen ohne substantiellen Bezug zur Geschichte und entwickelt Vorschläge für einen verbesserten Geschichtsunterricht und die Gestaltung von Gedenkstättenbesuchen. Es präsentiert Wege zur Förderung eines fundierten und reflektierten Umgangs mit der Vergangenheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau: Selbstverständnis und mediale Repräsentation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im Spannungsfeld ihres Selbstverständnisses und ihrer medialen Repräsentation. Sie untersucht die verschiedenen Perspektiven und Interpretationen der Geschichte von Auschwitz, insbesondere im Kontext der dritten Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, und den Einfluss medialer Darstellungen auf das Verständnis und die Erinnerung an den Holocaust.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das Selbstverständnis der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau; die Rolle der Medien in der Erinnerung an den Holocaust; die Perspektiven verschiedener nationaler Gedächtnisse (polnisch, deutsch, jüdisch); die Herausforderungen des Lernens an Gedenkstätten; und die Bedeutung geschichtskultureller Erkundigungen. Sie umfasst einen historischen Überblick über Oświęcim und Auschwitz, die Entwicklung der Gedenkstätte, aktuelle Konflikte und die Relevanz von Erinnerungstheorien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung; Die Stadt Oświęcim, das Konzentrationslager Auschwitz und die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau; Oświęcim und die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im 21. Jahrhundert; Erinnerungstheorien; Entwicklung eines Selbstverständnisses der dritten Generation gegenüber der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau; Die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im Spannungsfeld medialer Repräsentation und historischen Wissens; und Geschichtskulturelle Erkundigungen als Ausgangspunkt zum Lernen an Gedenkstätten? - Wege aus der Unwissenheit.
Wie werden die verschiedenen Perspektiven auf Auschwitz dargestellt?
Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Perspektiven des polnischen, deutschen und jüdischen Gedächtnisses auf Auschwitz und die Herausforderungen eines universellen Selbstverständnisses. Sie analysiert, wie diese verschiedenen nationalen Gedächtnisse das Verhältnis zur Gedenkstätte prägen und wie sie sich in der medialen Repräsentation widerspiegeln.
Welche Rolle spielen die Medien in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Medien in der Repräsentation der Gedenkstätte und des Holocausts. Sie untersucht die Entwicklung der öffentlichen Wahrnehmung deutscher Gedenkstätten, die geschichtskulturellen Entwicklungen in Deutschland und die Tendenzen der medialen Darstellung von Auschwitz, Holocaust und NS-Zeit. Der Fokus liegt auf dem Einfluss der Medien auf das historische Wissen der dritten Generation und die kritische Auseinandersetzung mit oberflächlichen medialen Darstellungen.
Wie wird das Thema Lernen an Gedenkstätten behandelt?
Die Arbeit diskutiert die Bedeutung geschichtskultureller Erkundigungen für das Lernen an Gedenkstätten. Sie beleuchtet kritisch die problematischen Aspekte medialer Darstellungen ohne substantiellen Bezug zur Geschichte und entwickelt Vorschläge für einen verbesserten Geschichtsunterricht und die Gestaltung von Gedenkstättenbesuchen, um ein fundiertes und reflektiertes Verständnis der Vergangenheit zu fördern.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im Spannungsfeld ihres Selbstverständnisses und ihrer medialen Repräsentation. Sie analysiert die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen der Geschichte von Auschwitz, insbesondere im Kontext der dritten Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, und fragt nach dem Einfluss medialer Darstellungen auf das Verständnis und die Erinnerung an den Holocaust.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass ein umfassendes und reflektiertes Verständnis der Geschichte von Auschwitz eine kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Perspektiven und einer fundierten Auseinandersetzung mit medialen Darstellungen erfordert. Sie unterstreicht die Bedeutung von geschichtskulturellen Erkundigungen und einem verbesserten Geschichtsunterricht, um ein authentisches Gedenken an die Opfer des Holocaust zu gewährleisten und ein fundiertes Verständnis für zukünftige Generationen zu schaffen.
- Arbeit zitieren
- Daniela Klein (Autor:in), 2012, Die Gedenkstätte Auschwitz im Spannungsfeld von Selbstverständnis und medialer Repräsentation., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265313