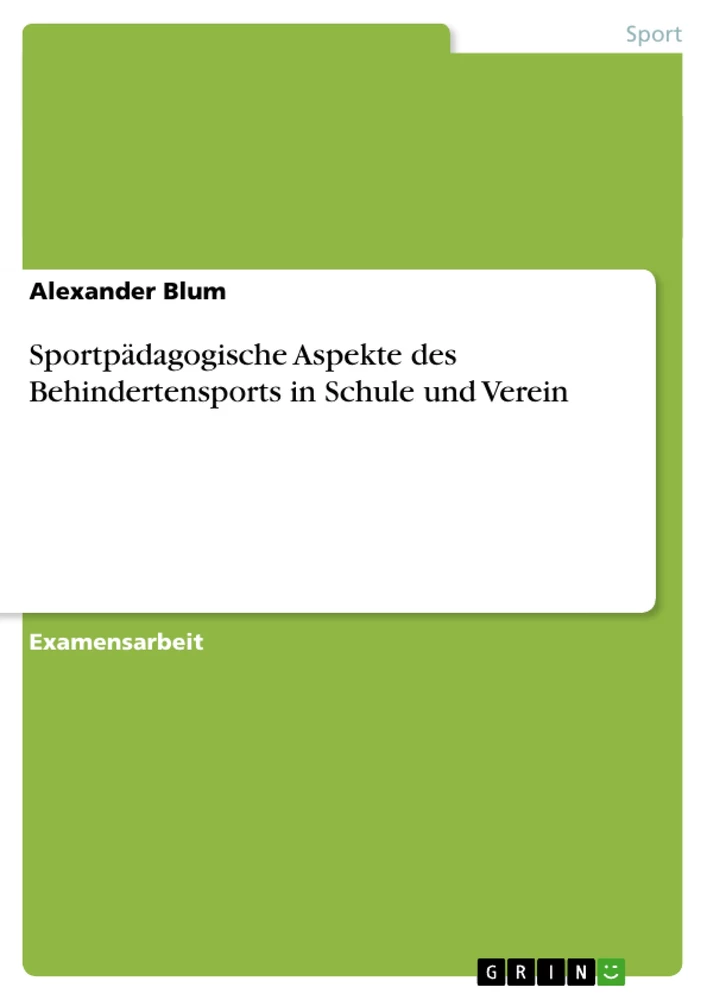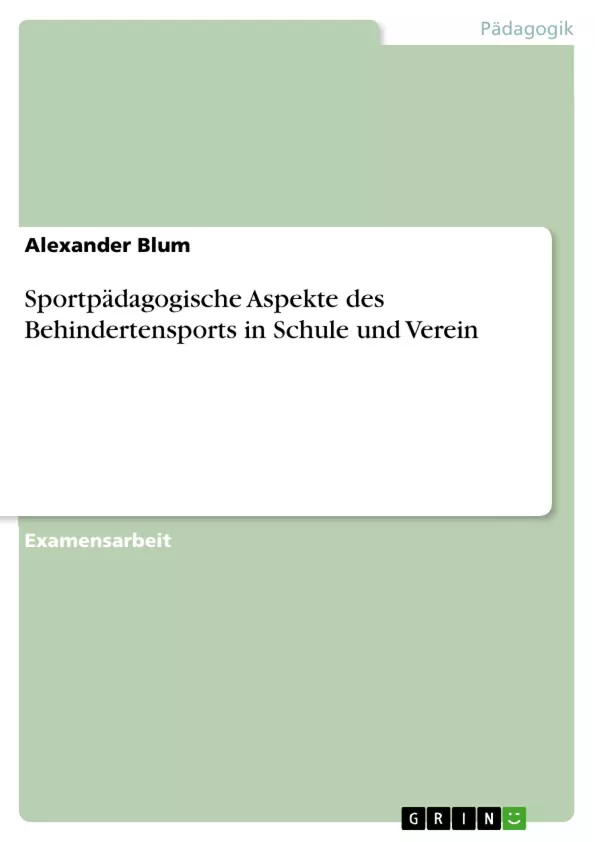Die Integration von Behinderten stellt in Deutschland ein kontroverses und oft diskutiertes Themenfeld dar. So findet bereits seit den 70’er Jahren in der Öffentlichkeit, sowie in wissenschaftlichen und bildungspolitischen Fachkreisen eine „kontroverse und emotional belastete Integrationsdiskussion statt“
(Scheid, 1995, S. 12).
Hauptgegenstand dieser Diskussion sind die „Möglichkeiten und Rahmenbedingungen sozialer Integration“ (ebd.). – Auf welche Art und Weise ist Integration realisierbar? Wird gesellschaftlich genug getan um Integrationsprozesse
anzuregen und voranzutreiben? – Auch das eigentliche Verständnis von Integration wird dabei immer wieder diskutiert und dem Prüfstand unterworfen.
Insbesondere der Zugang zu Bildung bietet Experten Raum für kontroverse Debatten und Diskussionen. Hier stellt vor allem der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung einen großen
Streitpunkt dar. Kritiker des bestehenden Systems fordern unlängst ein längeres gemeinsames Lernen und die Abschaffung der Sonderschulen. Aber auch der Zugang zu wirtschaftlichen Gütern und zur sozialen Umwelt sind Punkte, mit denen sich Gremien der Politik und Gesellschaft auseinandersetzen.
Schon seit langem fordern Experten eine andere Herangehensweise und Aufarbeitung der Integrationsdiskussion. Erst 2009 flammte die Debatte, ausgelöst durch die Beschlüsse der Vereinten Nationen (UN) über die Rechte von Behinderten, neu auf.
Demnach können sich Menschen mit Behinderung seither auf in 50 Artikeln zusammengefasste Rechte berufen. Die Konventionen stellen dabei keinesfalls eine Empfehlung dar, sondern sind ein völkerrechtlicher Vertrag, zu deren Umsetzung die Mitgliedsstaaten verpflichtet sind. Auch das Recht auf inklusive Beschulung ist darin verankert, muss jedoch erst noch in Schulgesetzen konkretisiert werden. Das Thema Bildung sowie die Teilhabe an kulturellem eben, Erholung, Freizeit und Sport spielt in den Beschlüssen eine tragende Rolle. Demnach ist Deutschland verpflichtet, sein Schulsystem, aber auch die
öffentliche Wahrnehmung und den Umgang mit Behinderten gewissen Änderungen zu unterziehen und die Ratifikationen voranzutreiben.
So wird in den Konventionen eindeutig festgelegt, dass „die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen“ einrichten und Menschen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen
werden dürfen (BMAS, 2011a).
[...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- AKTUELLE SACHLAGE UND DARSTELLUNG DES PROBLEMFELDES
- Die vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung
- Die wichtigsten Weisungen und Aussagen der UN-BRK als Wegweiser in eine inklusive Gesellschaft
- Aktueller Stand: Inklusion in der BRD
- Der gesellschaftliche Umgang mit Behinderung
- Zum Terminus Behinderung
- Der Behinderungsbegriff aus sonderpädagogischer Sicht
- Soziale Konstruktion von Behinderung
- Inklusion — Meilenstein oder Etikettenschwindel?
- Allgemeines zum Begriff Inklusion
- Inklusion als optimierte Integration
- Die vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung
- INKLUSION IN SCHULE UND VEREIN — ZWEI PRAXISBEISPIELE
- Inklusion im (Sport)unterricht am Beispiel einer saarländischen Grundschule
- Die Grundschule „im Vogelsang"
- Interview mit der Schulleitung
- Eine inklusive Sportstunde
- Inklusion im Vereinssport am Beispiel eines saarländischen Leichtathletikvereins
- Die LG Reimsbach-Oppen
- Inklusion in der LG Reimsbach-Oppen
- Interview mit den Verantwortlichen der LG
- Eine inklusive Trainingseinheit
- Inklusion im (Sport)unterricht am Beispiel einer saarländischen Grundschule
- SPORTPÄDAGOGISCHE ASPEKTE VON INKLUSION IM SCHUL- UND VEREINSSPORT
- Zur Sinnhaftigkeit inklusiven Sporttreibens und der Nutzen für Nicht-Behinderte
- Über die Vereinbarkeit von Lernzielen und Inklusion — Der Doppelauftrag des Sportunterrichts
- Anforderungsprofil der Lehrkraft
- Kriterien inklusiven Unterrichts
- Methoden inklusiver Unterrichtsgestaltung im Sport
- Differenzierung im inklusiven Sportunterricht
- Differenzierung unter dem Aspekt der logischen Entwicklung
- Das Spiel mit der Heterogenität
- Phasenhafte Unterrichtskonzeption nach Streicher & Leske
- Psychomotorik im inklusiven Sportunterricht
- Psychomotorik — Ursprung, Geschichte und Bedeutung
- Psychomotorik im inklusiven Sportunterricht
- Bewegungsangebote innerhalb der Psychomotorik
- Psychomotorik in der Diskussion
- Differenzierung im inklusiven Sportunterricht
- Inklusion in Sportvereinen
- Strukturelle Voraussetzungen
- Zur Sinnhaftigkeit inklusiven Sporttreibens und der Nutzen für Nicht-Behinderte
- ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
- LITERATURVERZEICHNIS
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention für die Sportpädagogik in Deutschland. Sie untersucht, wie Inklusion im Sportunterricht und in Sportvereinen umgesetzt werden kann und welche Herausforderungen dabei bestehen.
- Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Bedeutung für die Inklusion in der Gesellschaft
- Der Begriff der Behinderung und seine soziale Konstruktion
- Die Unterschiede zwischen Integration und Inklusion
- Sportpädagogische Ansätze zur Gestaltung von inklusivem Sportunterricht
- Die Rolle von Differenzierung und Psychomotorik im inklusiven Sport
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft, insbesondere im Bildungsbereich. Es werden die Begriffe Behinderung, Integration und Inklusion definiert und die gesellschaftliche Konstruktion von Behinderung diskutiert.
Kapitel 3 analysiert zwei Praxisbeispiele: eine inklusive Grundschule und einen inklusiven Leichtathletikverein. Anhand von Unterrichts- und Trainingsbeobachtungen sowie Interviews mit Lehrkräften und Trainern werden die Herausforderungen und Möglichkeiten der Inklusion in der Praxis dargestellt.
Kapitel 4 befasst sich mit den sportpädagogischen Aspekten von Inklusion. Es werden die Sinnhaftigkeit und der Nutzen inklusiven Sporttreibens für alle Beteiligten erläutert. Außerdem werden verschiedene Ansätze zur Gestaltung von inklusivem Sportunterricht vorgestellt, darunter Differenzierung, Psychomotorik und das Spiel mit der Heterogenität.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Behindertenrechtskonvention, Inklusion, Integration, Sportpädagogik, Sportunterricht, Vereinssport, Differenzierung, Psychomotorik, soziales Lernen und Heterogenität.
- Quote paper
- Alexander Blum (Author), 2013, Sportpädagogische Aspekte des Behindertensports in Schule und Verein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265317