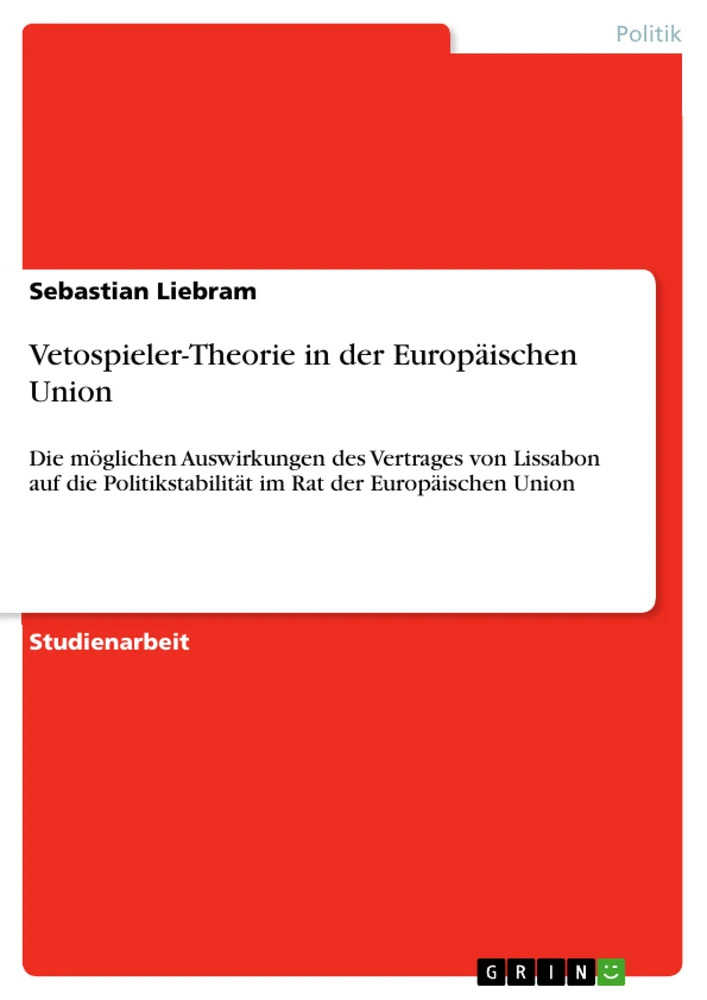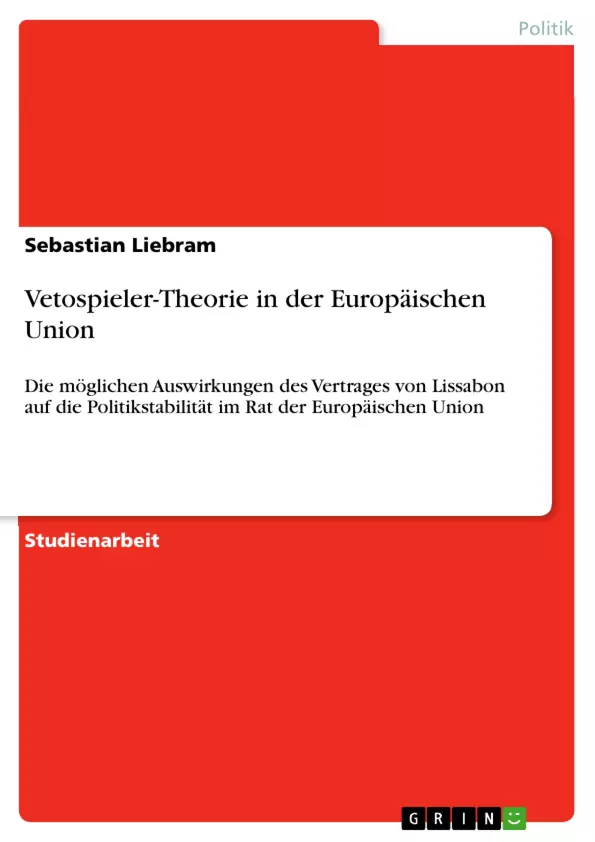Die Ratifikation des Reformvertrages von Lissabon durch die Mitglieder der Europäischen Union (EU) ergab zum 1. Dezember 2009 Veränderungen für das Primärrecht der EU, den Vertrag der Europäischen Union (EUV) beziehungsweise den gleichwertigen Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) (Vgl. Seeger, 2008, S. 66). Diese beiden Vertragswerke definieren die grundsätzlichen rechtlichen Rahmenbedingungen, durch die das Zusammenwirken der EU-Mitgliedsstaaten, die Arbeitsweise und Stellung der EU-Organe sowie die Abläufe der EU-Rechtssetzung bestimmt werden.
Als Zielsetzung soll der Vertrag von Lissabon die Arbeitsweise der EU „demokratischer und effizienter machen“ (AFP/Reuters, 2010). Darüber hinaus gilt er als Ersatz für die zuvor angestrebte, allerdings gescheiterte, EU-Verfassung (Vgl. ebd.).
Wichtige Neuerungen sind unter anderem die Verkleinerung der EU-Kommission, die Einführung einer EU-Bürgerinitiative, die Ausdehnung von Mehrheitsentscheidungen und die Einführung des Prinzips der doppelten Mehrheiten im Rat der Europäischen Union (Vgl. ebd.).
Diese Änderungen vollzogen sich jedoch nicht sofort, sondern wurden beziehungsweise werden erst schrittweise umgesetzt.
Das Prinzip der doppelten Mehrheiten im Rat der Europäischen Union wird demzufolge zum Beispiel erst ab dem 1. November 2014 realisiert. Bis dahin gelten Bestimmungen, die in dem „Protokoll über die Übergangsbestimmungen“ festgelegt und dem EUV und AEUV beigefügt wurden (Vgl. Schwartmann, 2013, S. 819).
Mit der konkreten Veränderung der notwendigen Mehrheiten, die ihm Rat der Europäischen Union für die Annahme einer Vorlage notwendig sind, setzt sich diese Arbeit auseinander.
Dabei steht die folgende Fragestellung im Mittelpunkt der Betrachtung: Welche Veränderungen können sich durch die Einführung des Prinzips der doppelten Mehrheiten für die Politikstabilität im Rat der Europäischen Union ergeben?
Als These lässt sich hierbei herausstellen, dass die Mehrheitsfindung im Rat der Europäischen Union nach der Implementierung der doppelten Mehrheiten einfacher und dadurch auch transparenter wird, da die bisher relevanten Stimmgewichte der einzelnen Akteure nicht mehr für ein Entscheidungsergebnis ausschlaggebend sind, sondern die gleichwertigen Stimmgewichte der Ratsmitglieder zählen und die Bevölkerungsgröße des Staates als objektiver Faktor hinzugezogen wird.
Die Beantwortung der Fragestellung soll theoriegeleitet anhand der Vetospielertheorie nach George Tsebelis hergeleitet werde
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundzüge der Vetospielertheorie
- Der Rat der Europäischen Union im Kontext des Lissabon-Vertrages
- Rechtliche Perspektive
- Politikwissenschaftliche Perspektive
- Modell zur Darstellung der Akteure im Rat der Europäischen Union
- Szenario der Akteurskonstellation im Rat der Europäischen Union
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die möglichen Auswirkungen der Einführung des Prinzips der doppelten Mehrheiten im Rat der Europäischen Union, die durch den Vertrag von Lissabon eingeführt wurden, auf die Politikstabilität des Rates. Im Fokus steht die Frage, welche Veränderungen sich durch diese Neuerung ergeben können und ob die Mehrheitsfindung im Rat dadurch einfacher und transparenter wird.
- Einführung der doppelten Mehrheiten im Rat der Europäischen Union
- Auswirkungen auf die Politikstabilität des Rates
- Veränderungen in der Mehrheitsfindung
- Anwendung der Vetospielertheorie auf die EU
- Analyse der Entscheidungsmodalitäten im Rat der Europäischen Union
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Hintergrund der Arbeit und stellt die Fragestellung sowie die These dar. Anschließend werden die wichtigsten Inhalte der Vetospielertheorie nach George Tsebelis vorgestellt. Kapitel 3 beleuchtet den Rat der Europäischen Union im Kontext des Lissabon-Vertrages aus rechtlicher und politikwissenschaftlicher Perspektive. In Kapitel 4 wird ein Modell zur Darstellung der Akteure im Rat der Europäischen Union entwickelt. Kapitel 5 analysiert ein denkbares Szenario der Akteurskonstellation im Rat nach der Implementierung der doppelten Mehrheiten.
Schlüsselwörter
Vetospielertheorie, Politikstabilität, Rat der Europäischen Union, Lissabon-Vertrag, doppelte Mehrheiten, Entscheidungsfindung, Mehrheitsfindung, EU-Organe, EU-Recht, Abstimmungsverfahren.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Prinzip der „doppelten Mehrheit“ in der EU?
Es bedeutet, dass für einen Beschluss im Rat zwei Bedingungen erfüllt sein müssen: Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten (55%) und eine Mehrheit der vertretenen Bevölkerung (65%).
Welches Ziel verfolgt der Vertrag von Lissabon hinsichtlich der Arbeitsweise der EU?
Der Vertrag soll die EU demokratischer und effizienter machen, indem er Entscheidungsprozesse modernisiert und die Rolle des Rates sowie der Bürgerinitiativen stärkt.
Wie wird die Vetospielertheorie auf die EU angewendet?
Die Theorie nach George Tsebelis analysiert, wie die Anzahl und Position der Akteure (Mitgliedstaaten), die einer Änderung zustimmen müssen, die Politikstabilität und die Wahrscheinlichkeit von Reformen beeinflussen.
Welche Auswirkungen haben die neuen Mehrheiten auf die Politikstabilität?
Die Arbeit untersucht die These, dass die Mehrheitsfindung durch objektive Faktoren wie die Bevölkerungsgröße transparenter und einfacher wird, was die Politikstabilität verändern kann.
Ab wann wurde das Prinzip der doppelten Mehrheit realisiert?
Obwohl der Lissabon-Vertrag 2009 in Kraft trat, wurde die Umsetzung der doppelten Mehrheiten schrittweise geplant und ab dem 1. November 2014 vollständig realisiert.
- Citation du texte
- Sebastian Liebram (Auteur), 2013, Vetospieler-Theorie in der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265389