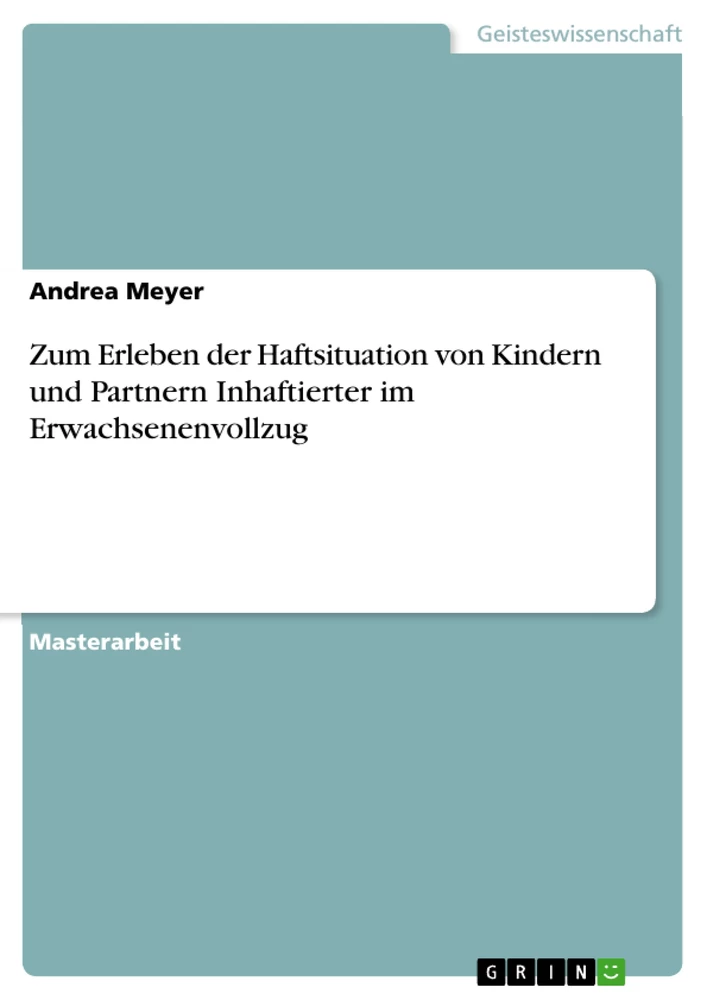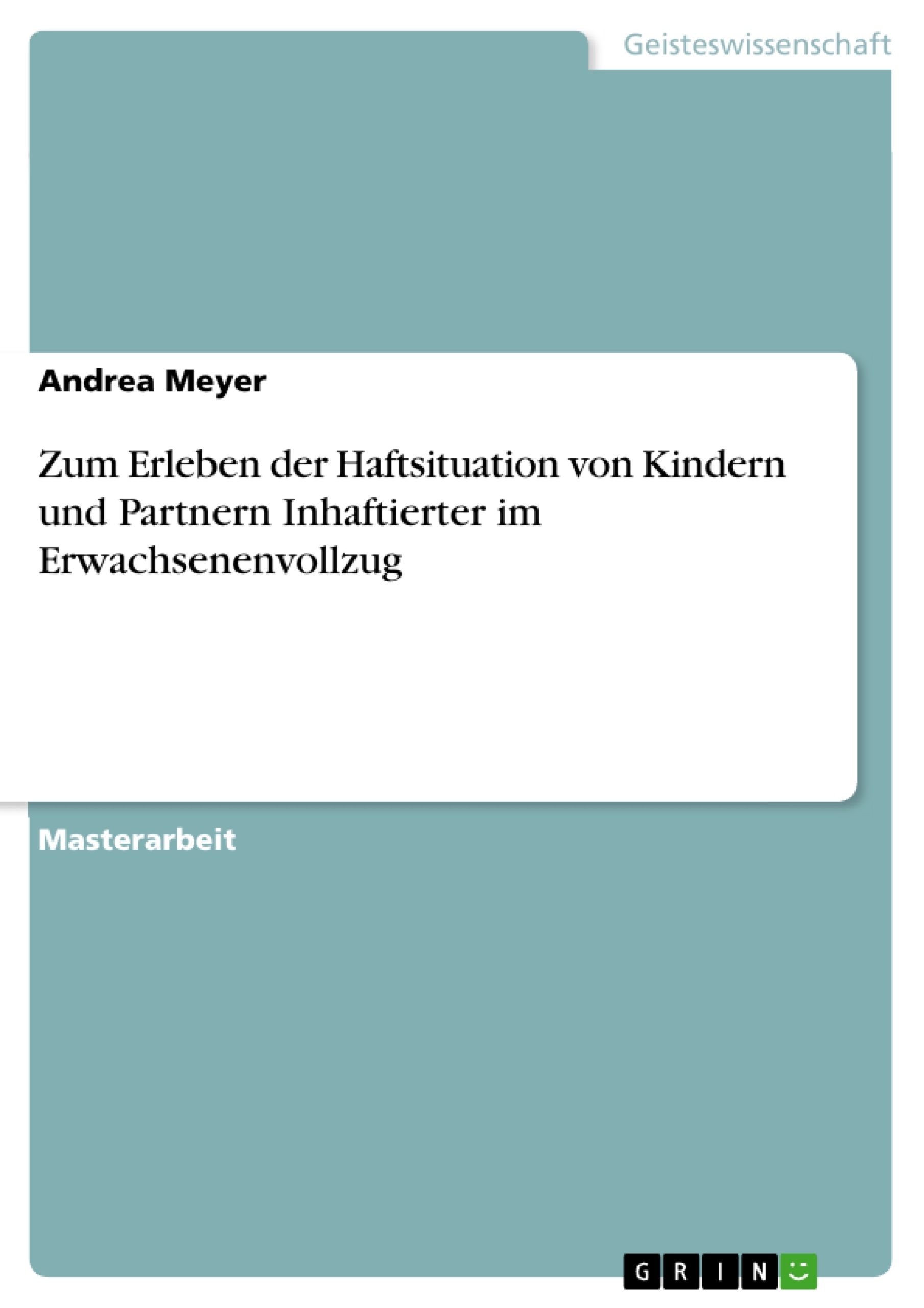Die Gruppe der Angehörigen und Kinder Inhaftierter wird, sowohl in der wissenschaftlichen Forschung, als auch im Strafvollzug als nicht ernst zu nehmende Zielgruppe, kaum zur Kenntnis genommen (Heberling, 2012, S.8).
Die Betroffenen haben jedoch mit weitreichenden Konsequenzen durch die Inhaftierung eines Familienmitglieds zu kämpfen.
Es sind etwa eine halbe Million Menschen in Deutschland, die als Angehörige Inhaftierter mit den familienfeindlichen Folgen einer Inhaftierung leben müssen, den höchsten Preis zahlen die Kinder (IfS, 1/2012, S.12).
In der vorliegenden Arbeit soll unter Darstellung einiger Ergebnisse aus der "Coping-Sudie" (Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health)die Zielgruppe der Angehörigen und Kinder Inhaftierter mehr in den Fokus von Wissenschaft, Gesellschaft und Politik gelenkt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract deutsch/englisch
- Einleitung
- Zum Strafvollzug
- Ziele und Aufgaben des Strafvollzuges
- Regelungen des StVollzG zum Empfang von Besuchern und der Kommunikation mit der Außenwelt
- Besonderheiten des Frauenvollzuges
- Zur Lebenssituation inhaftierter Frauen und Männer
- Inhaftierte Frauen
- Inhaftierte Männer
- Zum Erleben der Haftsituation von PartnerInnen Inhaftierter
- Partnerinnen inhaftierter Männer
- Forschungsstand im deutschen Sprachraum
- Forschungsstand im anglo-amerikanischen Sprachraum
- Auswirkungen durch Abwesenheit des Partners
- Psychische Belastungen
- Auswirkungen auf die Partnerschaft
- Partner inhaftierter Frauen
- Partnerinnen inhaftierter Männer
- Zum Erleben der Haftsituation von Kindern inhaftierter Eltern
- Zur Eltern-Kind-Beziehung
- Rechte der Kinder
- Zur „Coping Studie" (Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health)
- Ergebnisse aus der Studie anhand qualitativer Interviews mit Kindern Inhaftierter
- Resilienzfaktoren
- Bewältigungsstrategien
- Stigmatisierungsprozesse
- Psychische und physische Gesundheit
- Hilfsangebote der Justizvollzugsanstalten und Gemeinden
- Handlungsempfehlungen
- Ergebnisse aus der Studie anhand qualitativer Interviews mit Kindern Inhaftierter
- Zur Bedeutung der Auswirkungen durch Trennung vom inhaftierten Elternteil
- Mutter und Kind Einrichtungen im Strafvollzug
- Zur Lebenssituation von Müttern und Kindern im Mutter und Kind Strafvollzug
- Vollzugsgestaltung in Mutter und Kind Einrichtungen
- Entwicklung der Kinder im Strafvollzug
- Behandlungsbedürfnisse inhaftierter Mütter
- Zur Lebenssituation von Müttern und Kindern im Mutter und Kind Strafvollzug
- Aktuelle Hilfsangebote für Kinder und Angehörige Inhaftierter
- Ambulante Hilfen für Kinder und Angehörige Inhaftierter am Beispiel der Anlaufstelle „Freiräume" in Bielefeld und „Kid-Mobil" in Berlin
- Unterstützungsangebote für Kinder und Angehörige im Gefängnis am Beispiel der JVA Bützow
- Das Familienhaus „Engelsborg" in Dänemark
- Ableitungen für die Praxis
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen einer Inhaftierung auf Partner und Kinder des Inhaftierten. Ziel ist es, die Lebenssituation dieser oft vergessenen Gruppe zu beleuchten und auf die Notwendigkeit von Hilfsangeboten hinzuweisen. Die Arbeit analysiert den Forschungsstand und beleuchtet die psychischen Belastungen, die durch die Abwesenheit des Partners oder Elternteils entstehen. Ein besonderer Fokus liegt auf der „Coping Studie", die die Auswirkungen der Inhaftierung auf Kinder in Deutschland untersucht.
- Psychische Belastungen von Partnern und Kindern Inhaftierter
- Herausforderungen der Kommunikation zwischen Inhaftierten und ihren Familien
- Die Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung im Kontext der Inhaftierung
- Hilfsangebote für Kinder und Angehörige Inhaftierter
- Die Rolle von Mutter-Kind-Einrichtungen im Strafvollzug
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Problematik der mangelnden Aufmerksamkeit für die Angehörigen Inhaftierter. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen der Inhaftierung auf Partner und Kinder. Die Arbeit beleuchtet die Folgen der Inhaftierung, die sich auf die Familienmitglieder auswirken, wie z.B. psychische Belastungen, Stigmatisierung und finanzielle Einschränkungen.
Kapitel 2 bietet einen Überblick über den Strafvollzug in Deutschland. Es werden die Ziele und Aufgaben des Strafvollzuges, die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Besuch von Gefangenen und die Besonderheiten des Frauenvollzugs beleuchtet.
Kapitel 3 beschreibt das Hafterleben von inhaftierten Frauen und Männern und die damit verbundenen Herausforderungen. Die Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland" zeigt die hohe Prävalenz von Gewalt bei Frauen in Haft auf.
Kapitel 4 befasst sich mit den Auswirkungen der Inhaftierung auf die Partner von Gefangenen. Der Schwerpunkt liegt auf den Partnerinnen inhaftierter Männer. Es werden die Herausforderungen der Frauen, die mit der Inhaftierung konfrontiert sind, sowie die psychischen Belastungen und die Auswirkungen auf die Partnerschaft beleuchtet.
Kapitel 5 widmet sich dem Erleben der Haftsituation von Kindern inhaftierter Eltern. Die Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung, die Rechte der Kinder und die Ergebnisse der „Coping Studie" werden dargestellt. Die Studie zeigt die psychischen und physischen Belastungen der Kinder auf und beleuchtet die unzureichenden Hilfsangebote.
Kapitel 6 befasst sich mit der besonderen Situation von Mutter-Kind-Einrichtungen im Strafvollzug. Es werden die Lebenssituation der Mütter und Kinder in diesen Einrichtungen, die Vollzugsgestaltung und die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder beleuchtet.
Kapitel 7 stellt aktuelle Hilfsangebote für Kinder und Angehörige Inhaftierter vor. Es werden Beispiele aus Bielefeld, Berlin und Bützow sowie das Familienhaus „Engelsborg" in Dänemark vorgestellt.
Kapitel 8 leitet aus den Erkenntnissen der Arbeit Handlungsempfehlungen für die Praxis ab. Es werden die Notwendigkeit von Sensibilisierung, Schulung und Ausbau von Hilfsangeboten sowie die Bedeutung der Berücksichtigung des Kindeswohls betont.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Haftsituation, die Auswirkungen der Inhaftierung auf Partner und Kinder, die Eltern-Kind-Beziehung, die „Coping Studie", Mutter-Kind-Einrichtungen im Strafvollzug, Resilienzfaktoren, Bewältigungsstrategien, Stigmatisierungsprozesse, psychische und physische Gesundheit, Hilfsangebote für Kinder und Angehörige Inhaftierter und die Bedeutung des Kindeswohls. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Inhaftierung eines Elternteils für die Familie ergeben, und zeigt die Notwendigkeit von Unterstützung und Begleitung für die betroffenen Familien auf.
- Quote paper
- Andrea Meyer (Author), 2013, Zum Erleben der Haftsituation von Kindern und Partnern Inhaftierter im Erwachsenenvollzug, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265417