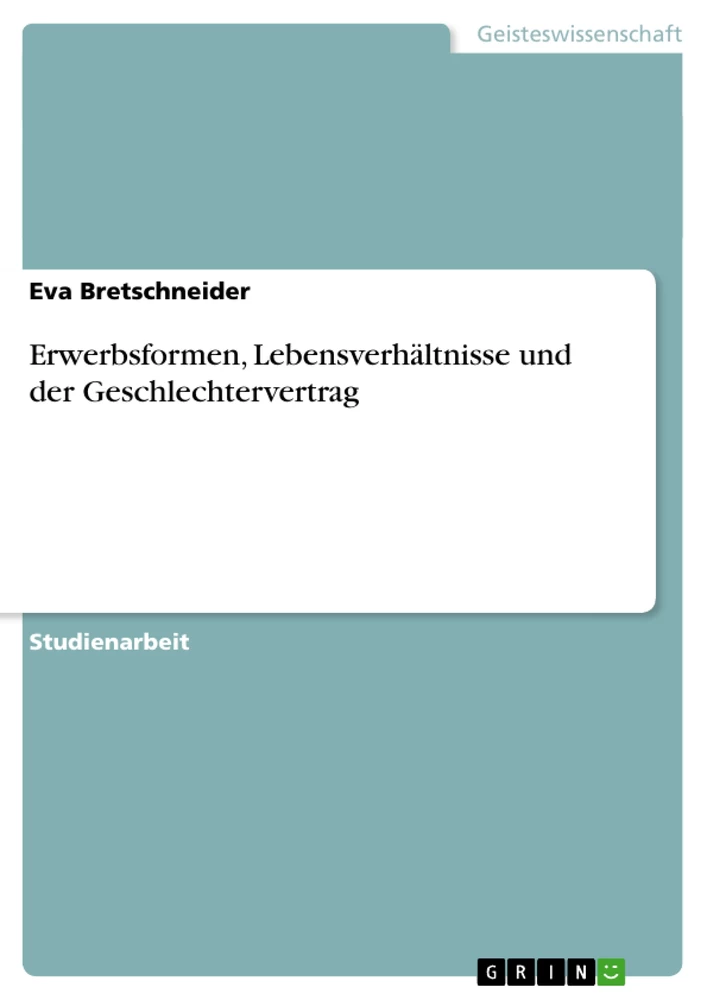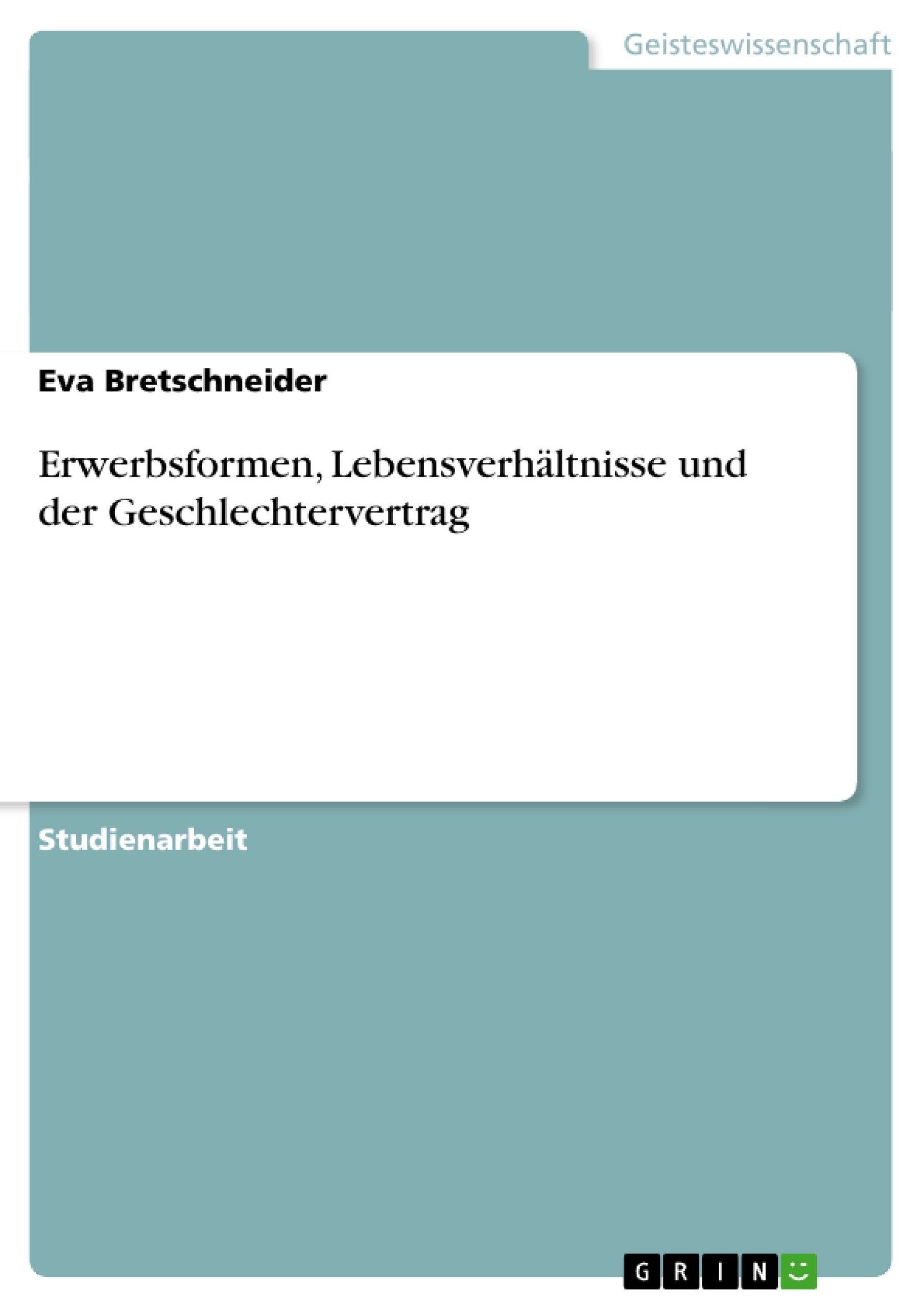Die Organisation von Arbeit in einer Gesellschaft ist keineswegs willkürlich, sondern entpuppt
sich alsbald bei genauerem Hinsehen als auf Regeln basierend und Politiken widerspiegelnd.
Zuständigkeiten, Pflichten und Rechte werden im Rahmen des Geschlechterverhältnisses zugewiesen:
durch den Geschlechtervertrag.
In welchem Zusammenhang stehen Erwerbsformen und Lebensverhältnisse mit dem Geschlechtervertrag
in Deutschland? Der folgende Text soll dazu beitragen, den Zusammenhang zwischen
der Arbeits- und Lebensorganisation und dem Geschlechtervertrag transparent zu machen und
die Mechanismen und die einhergehenden Implikationen verständlich aufzuzeigen. Die Zusammenhänge
sind keineswegs offensichtlich, handelt es sich bei dem Geschlechtervertrag doch um
ein unausgesprochenes, scheinbar unsichtbares und fast wie selbstverständlich hingenommenes
„Regelwerk, das Frauen und Männer unterschiedliche Arbeiten und Werte, unterschiedliche
Verantwortlichkeiten und Pflichten zuweist“1 und somit hohe Relevanz für alle gesellschaftlichen
Bereiche besitzt. Ich konzentriere mich auf die Entwicklung der Erwerbsformen und Lebensverhältnisse,
und beschränke mich bei meiner Analyse auf Deutschland, um die Möglic hkeit
zu haben im Rahmen dieses Textes in die Tiefe einzudringen.
Frauen und Männer werden zunehmend mit einem strukturellen Widerspruch konfrontiert: So
ändern sich die Lebensverhältnisse und Erwerbsformen, doch der ihnen zugrundeliegende Geschlechtervertrag
schreibt sich nur oberflächlich modifiziert fort. Zwei Thesen möchte ich anhand
der Ergebnisse meiner Analyse der Entwicklung der Erwerbsformen und Lebensverhältnisse
in Kapitel 2 überprüfen:
a) Der ernährerzentrierte Geschlechtervertrag in seiner stets nur oberflächlich modifizierten
Form wird den sich wandelnden Lebens- und Arbeitsverhältnissen nicht gerecht und erzeugt
Widersprüche.
b) Die Herausforderungen unserer Zeit bedingen eine Neuverhandlung des Geschlechtervertrags
zwischen den Geschlechtern. Damit verbunden ist eine Neubewertung der Arbeit.
1 Gender Glossar: http://www.wien.gv.at/ma57/gender_mainstreaming/glossar.htm#gvert (Letzter Zugriff: 24.10.03).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Problemstellung
- 1.1 Vorgehen und Methode
- 1.2 Begriffe, Definitionen und Operationalisierung
- 2. Erwerbsformen, Lebensverhältnisse und der Geschlechtervertrag
- 2.1 Wandel der Erwerbsformen
- 2.2 Wandel der Lebensverhältnisse und Einstellungen
- 2.2.2 Haushaltsstruktur
- 2.2.3 Lebensformen
- 2.3 Der Geschlechtervertrag
- 2.3.1 Geschlechtsspezifische Pflichten
- 2.3.2 Geschlechtsspezifische Rechte
- 3. Zusammenfassung
- 4. Schlussfolgerungen und Diskussion
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Erwerbsformen, Lebensverhältnissen und dem Geschlechtervertrag in Deutschland. Ziel ist es, die Wechselwirkungen zwischen der Organisation von Arbeit und Leben und den impliziten Regeln des Geschlechtervertrags transparent zu machen und die daraus resultierenden Implikationen aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Veränderungen und der Herausforderungen, die sich aus dem Wandel ergeben.
- Wandel der Erwerbsformen in Deutschland
- Veränderung der Lebensverhältnisse und Einstellungen
- Entwicklung und Ausgestaltung des Geschlechtervertrags
- Widersprüche zwischen dem traditionellen Geschlechtervertrag und den sich wandelnden Realitäten
- Notwendigkeit einer Neuverhandlung des Geschlechtervertrags
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen Erwerbsformen, Lebensverhältnissen und dem Geschlechtervertrag in Deutschland. Sie führt den Begriff des Geschlechtervertrags als ein unausgesprochenes Regelwerk ein, das die Zuweisung von Arbeiten, Werten, Verantwortlichkeiten und Pflichten zwischen den Geschlechtern regelt. Die Arbeit untersucht, wie sich der Wandel von Erwerbsformen und Lebensverhältnissen auf diesen Vertrag auswirkt und welche Widersprüche daraus entstehen. Zwei zentrale Thesen werden formuliert, die im weiteren Verlauf der Arbeit überprüft werden sollen: Die erste These besagt, dass der traditionelle, ernährerzentrierte Geschlechtervertrag den Veränderungen nicht gerecht wird und Widersprüche erzeugt. Die zweite These postuliert die Notwendigkeit einer Neuverhandlung dieses Vertrags aufgrund der aktuellen Herausforderungen.
2. Erwerbsformen, Lebensverhältnisse und der Geschlechtervertrag: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung von Erwerbsformen und Lebensverhältnissen in Deutschland und deren Beziehung zum Geschlechtervertrag. Es werden Wandelprozesse in Bezug auf Erwerbsarbeit (z.B. Zunahme von Teilzeitbeschäftigung, atypischen Arbeitsverhältnissen) und Lebensformen (z.B. steigende Zahl alleinerziehender Mütter, veränderte Haushaltsstrukturen) dargestellt. Die Analyse beleuchtet, wie diese Veränderungen die geschlechtsspezifischen Pflichten und Rechte im Rahmen des Geschlechtervertrags beeinflussen und welche Auswirkungen dies auf die gesellschaftliche Organisation von Produktion und Reproduktion hat. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Entwicklungen und der Herausforderungen, die sich für die Neuverhandlung des Geschlechtervertrags ergeben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Zusammenhangs zwischen Erwerbsformen, Lebensverhältnissen und dem Geschlechtervertrag in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Erwerbsformen, Lebensverhältnissen und dem Geschlechtervertrag in Deutschland. Sie analysiert die Wechselwirkungen zwischen der Organisation von Arbeit und Leben und den impliziten Regeln des Geschlechtervertrags und zeigt die daraus resultierenden Implikationen auf. Ein Schwerpunkt liegt auf den Veränderungen und Herausforderungen durch den gesellschaftlichen Wandel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel der Erwerbsformen in Deutschland, die Veränderung der Lebensverhältnisse und Einstellungen, die Entwicklung und Ausgestaltung des Geschlechtervertrags, Widersprüche zwischen traditionellem Geschlechtervertrag und sich wandelnden Realitäten sowie die Notwendigkeit einer Neuverhandlung des Geschlechtervertrags.
Welche Methodik wird verwendet?
Die genaue Methodik wird im ersten Kapitel (Einleitung und Problemstellung) detailliert beschrieben, inklusive Vorgehensweise und verwendeter Begriffe/Definitionen. Die Arbeit analysiert Entwicklungen von Erwerbsformen und Lebensverhältnissen und deren Beziehung zum Geschlechtervertrag.
Was ist der Geschlechtervertrag?
Der Geschlechtervertrag wird als ein unausgesprochenes Regelwerk definiert, das die Zuweisung von Arbeiten, Werten, Verantwortlichkeiten und Pflichten zwischen den Geschlechtern regelt. Die Arbeit untersucht, wie sich der Wandel von Erwerbsformen und Lebensverhältnissen auf diesen Vertrag auswirkt und welche Widersprüche daraus entstehen.
Welche zentralen Thesen werden aufgestellt?
Zwei zentrale Thesen werden formuliert: Erstens, dass der traditionelle, ernährerzentrierte Geschlechtervertrag den Veränderungen nicht gerecht wird und Widersprüche erzeugt. Zweitens, dass eine Neuverhandlung dieses Vertrags aufgrund der aktuellen Herausforderungen notwendig ist.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung und Problemstellung (mit Vorgehen und Definitionen), Erwerbsformen, Lebensverhältnisse und der Geschlechtervertrag (inkl. Wandel der Erwerbsformen, Wandel der Lebensverhältnisse und Einstellungen mit Unterkapiteln zu Haushaltsstruktur und Lebensformen, sowie dem Geschlechtervertrag mit geschlechtsspezifischen Pflichten und Rechten), Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Diskussion, und Ausblick.
Was wird im Kapitel "Erwerbsformen, Lebensverhältnisse und der Geschlechtervertrag" analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung von Erwerbsformen (z.B. Teilzeitbeschäftigung, atypische Arbeitsverhältnisse) und Lebensformen (z.B. alleinerziehende Mütter, veränderte Haushaltsstrukturen) in Deutschland und deren Einfluss auf den Geschlechtervertrag. Es beleuchtet, wie diese Veränderungen geschlechtsspezifische Pflichten und Rechte beeinflussen und die gesellschaftliche Organisation von Produktion und Reproduktion betreffen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen und eine detaillierte Diskussion der Ergebnisse werden im entsprechenden Kapitel zusammengefasst. Die genauen Schlussfolgerungen sind aus dem bereitgestellten Auszug nicht vollständig ersichtlich.
Wie ist der Ausblick gestaltet?
Der Ausblick gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und mögliche Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Geschlechtervertrag und dem Wandel von Erwerbsformen und Lebensverhältnissen.
- Citation du texte
- Eva Bretschneider (Auteur), 2003, Erwerbsformen, Lebensverhältnisse und der Geschlechtervertrag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26545