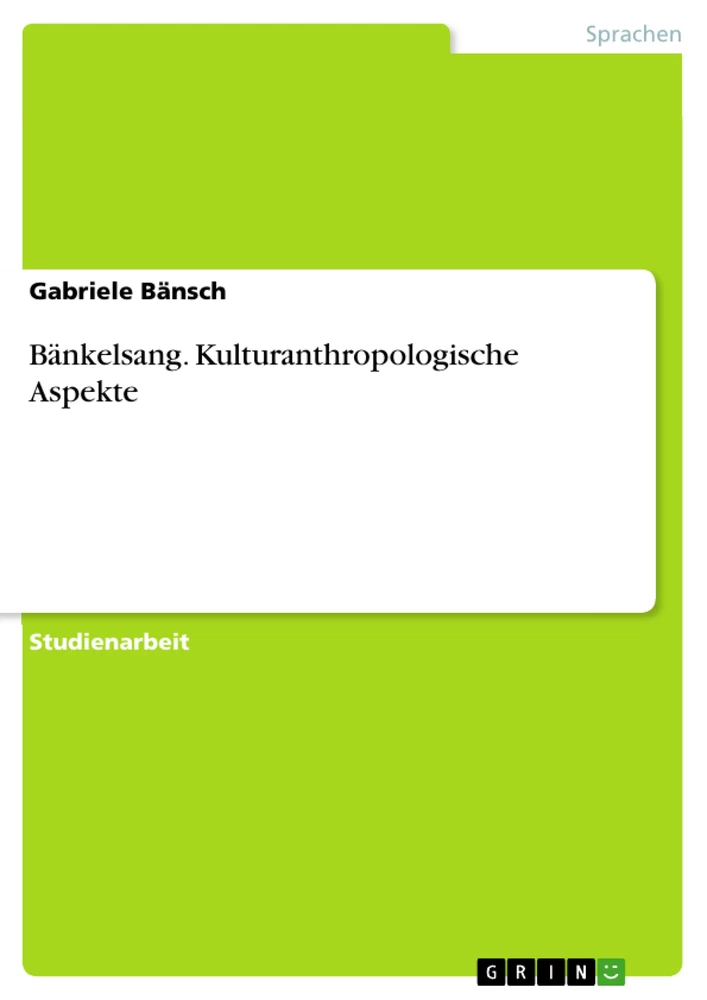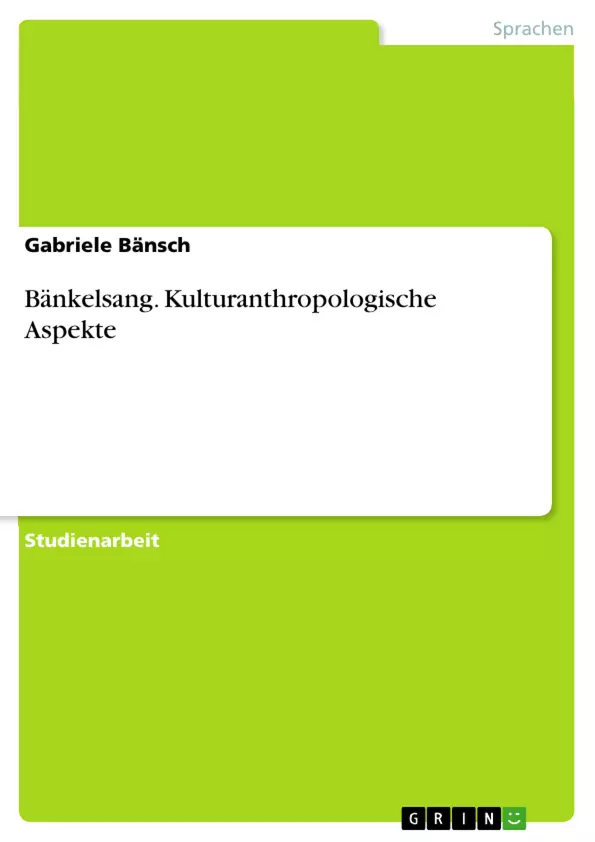Fachliteratur mit dem Hauptthema „Bänkelsang“ ist über 30 Jahre alt. Diese Hausarbeit unternimmt den Versuch, den kulturanthropologischen Aspekt des Bänkelsangs darzustellen. Wer waren diese Bänkelsänger, wann war ihre Blütezeit, wie gestalteten sich die sozialen und ökonomischen Verhältnisse jener Zeit, wer hörte ihnen zu, was waren Inhalte und Themen des Bänkelsangs, woher bezogen die Bänkelsänger ihr Rohmaterial?
Einleitend sollen zunächst die Begriffe „Anthropologie“ und „Kulturanthropologie“ erläutert werden. Dabei wird im Besonderen die kulturanthropologische Unterscheidung von emischer und etischer Sicht nach Marvin Harris erläutert.
Im folgenden Kapitel wird dargestellt, wie und mit welchen Utensilien ein Bänkelsänger seinen Vortrag gestaltet.
Anschließend wird die historische Entwicklung von seiner anfänglichen Entstehung aus dem Zeitungslied bis zu seinem Untergang im 20. Jahrhundert nachgezeichnet.
Danach wird aus kulturanthropologischer Sicht die soziale Stellung des Bänkelsängers über die verschiedenen Jahrhunderte erörtert.
Die thematischen und sprachlichen Besonderheiten des Bänkelsangs stellt das folgende Kapitel dar. Thematisch ist der Bänkelsang begrenzt auf Unerhörtes und Sensationelles. Dieser Begrenzung entspricht ein stereotyper Sprachgebrauch. Im Folgenden wird dann die Darstellung des Bänkelsangs in der Literatur von Grimmelshausen über Goethe bis Tieck aufgezeigt und es werden Beispiele für die umgekehrte Rezeption der Hochliteratur im Bänkelsang vorgestellt.
In den folgenden Kapiteln werden die Beziehungen zwischen Bänkelsang und Hochliteratur im Zusammenhang mit der Entstehung der Balladendichtung untersucht. Um dieses Thema einzuschränken, wird speziell auf das Motiv des Kindsmords eingegangen und dabei die Beziehung von Bänkelsang und Ballade am Beispiel der Ballade von Bürgers „Die Pfarrerstochter von Taubenhain“ und ihrer Verwendung durch die Bänkelsänger eingegangen. Dabei wird aufgezeigt, wie die anthropologische Fragestellung der Literatur im Bänkelsang durch eine fatalistische Lösung umgangen wird. Anschließend erfolgt ein kurzer Ausblick auf die parodistische Adaption des Bänkelsangs in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts.
Zuletzt wird im Anschluss an Karl Veit Riedel eine kulturanthropologische Bewertung des Bänkelsangs aus emischer und etischer Sicht versucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärungen
- Anthropologie
- Kulturanthropologie
- Der Bänkelsang
- Was ist ein Bänkelsänger?
- Die Entwicklung des Bänkelsangs
- Die soziale Stellung des Bänkelsängers
- Die Themen und die Sprache des Bänkelsangs
- Bänkelsang und Literatur
- Der Bänkelsang in der Literatur und die Literatur im Bänkelsang
- Die Balladendichtung und ihre Beziehung zum Bänkelsang
- Das Kindsmord-Motiv aus kulturanthropologischer Sicht
- Bürgers Ballade „Die Pfarrerstochter zu Taubenhain" und ihre Verwendung im Bänkelsang — Ein Textvergleich
- Die parodistische Adaption des Bänkelsangs in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts
- Kritik der volkskundlichen Wertung des Bänkelsangs bei Riedel
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Anhang 1 — Auszug Verzeichnis der verbotenen Dmckschriften
- Anhang 2 — Marktordung der Stadt Ratingen von 1832
- Anhang 3 — Notenbeispiel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die kulturanthropologischen Aspekte des Bänkelsangs zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf seine Beziehung zur Balladendichtung der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Versuch, den Bänkelsang für die Hochliteratur zu adaptieren, wird aus der damaligen Anthropologie und ihrer Kritik in Kants pragmatischer Anthropologie begründet.
- Die Entwicklung des Bänkelsangs als kulturelles Phänomen
- Die soziale Stellung des Bänkelsängers und seine Rolle in der Gesellschaft
- Die Themen und die Sprache des Bänkelsangs im Vergleich zur Balladendichtung
- Die Adaption des Bänkelsangs in der Literatur und die Kritik an seiner volkskundlichen Wertung
- Die anthropologische Fragestellung der Literatur im Bänkelsang
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe „Anthropologie" und „Kulturanthropologie" im Kontext des 18. Jahrhunderts definiert. Das dritte Kapitel widmet sich dem Bänkelsang als eigenem kulturanthropologischem Gegenstand. Es werden die historischen Entwicklung, die soziale Stellung des Bänkelsängers sowie die Themen und die Sprache des Bänkelsangs beleuchtet.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Beziehung zwischen Bänkelsang und Literatur. Zuerst wird die Darstellung des Bänkelsangs in der Literatur von Grimmelshausen bis Tieck aufgezeigt. Anschließend wird die Entstehung der Balladendichtung im 18. Jahrhundert und ihre thematische Affinität zum Bänkelsang erörtert. Das Kapitel konzentriert sich auf das Motiv des Kindsmords und untersucht die Beziehung von Bänkelsang und Ballade am Beispiel von Bürgers „Die Pfarrerstochter zu Taubenhain".
Im fünften Kapitel wird eine kulturanthropologische Kritik der volkskundlichen Wertung des Bänkelsangs bei Riedel aus emischer und etischer Sicht unternommen. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Hausarbeit zusammen und stellt die Bedeutung des Bänkelsangs als kulturelles Phänomen heraus.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Bänkelsang, die Balladendichtung, die Kulturanthropologie, die anthropologische Fragestellung, die soziale Stellung des Bänkelsängers, das Kindsmord-Motiv, die Adaption des Bänkelsangs in der Literatur und die Kritik der volkskundlichen Wertung des Bänkelsangs. Die Arbeit beleuchtet die Beziehung zwischen Bänkelsang und Literatur, insbesondere im Hinblick auf die Balladendichtung des 18. Jahrhunderts. Der Text analysiert die Themen und die Sprache des Bänkelsangs, sowie die anthropologischen Aspekte dieser Kunstform.
Häufig gestellte Fragen
Was war ein Bänkelsänger?
Ein Bänkelsänger war ein Schausteller, der auf Märkten auf einer kleinen Bank („Bänkel“) stand und zu Bildern (Schildern) moralisierende oder sensationelle Lieder vortrug.
Welche Themen waren typisch für den Bänkelsang?
Typisch waren „Unerhörtes“ und Sensationelles: Mordtaten, Naturkatastrophen, Hinrichtungen oder tragische Liebesgeschichten, oft mit einer moralischen Nutzanwendung am Ende.
Wie war die soziale Stellung der Bänkelsänger?
Bänkelsänger gehörten meist zum „fahrenden Volk“ und standen am Rande der Gesellschaft. Ihre Tätigkeit war oft strengen Marktordnungen und Zensur unterworfen.
Welche Verbindung besteht zwischen Bänkelsang und Balladendichtung?
Im 18. Jahrhundert griffen Dichter wie Bürger (z. B. „Die Pfarrerstochter von Taubenhain“) Themen des Bänkelsangs auf, um sie literarisch zu veredeln, während Bänkelsänger umgekehrt populäre Stoffe der Hochliteratur adaptierten.
Warum verschwand der Bänkelsang im 20. Jahrhundert?
Die Funktion der Nachrichtenverbreitung und Unterhaltung wurde zunehmend von Massenmedien wie Zeitungen, Radio und später dem Fernsehen übernommen, wodurch der Bänkelsang seine ökonomische Basis verlor.
- Citar trabajo
- Gabriele Bänsch (Autor), 2013, Bänkelsang. Kulturanthropologische Aspekte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265464