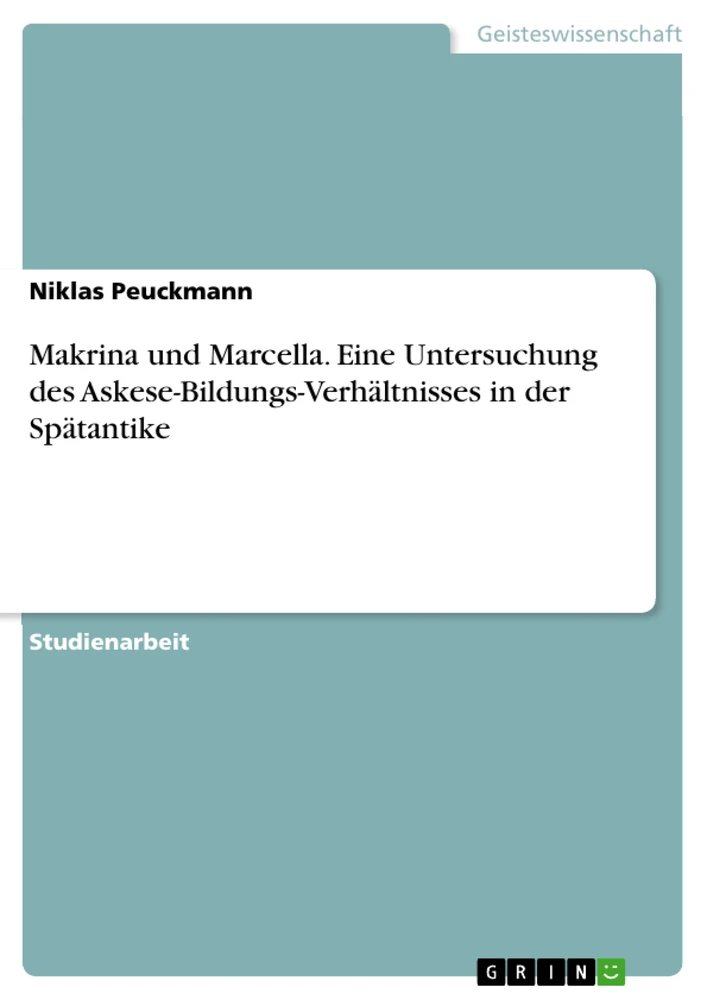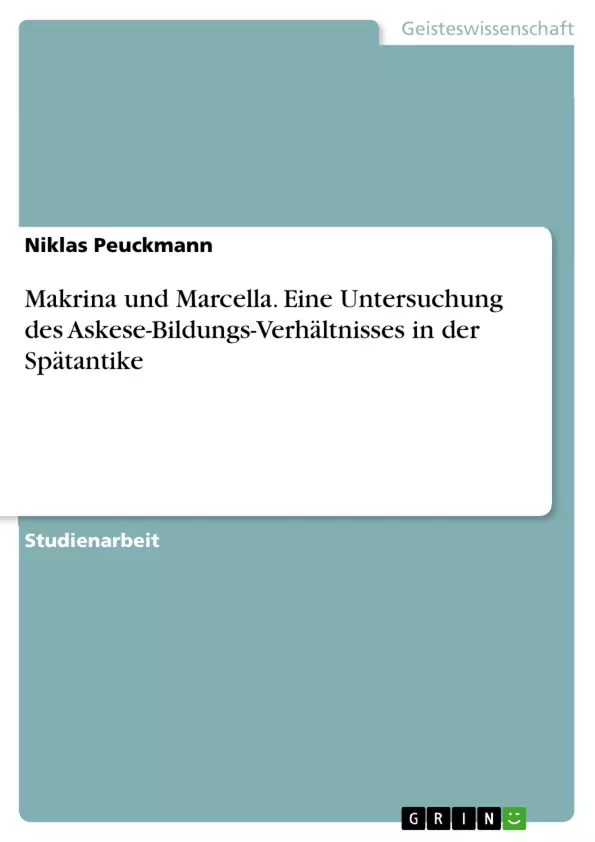In der Antike umschloss Askese weitaus mehr als bloß den einsamen Asketen, der als Eremit dem griechischen Grundwort des Mönchtums, nämlich monos (μονός), was so viel wie allein bedeutet, folgte. Vielmehr begannen Asketen, abseits vom hl. Antonius oder Evagrius Ponticus, sich in dieser Phase auch gemeinschaftlich zu organisieren. Hier findet sich also die Geburtsstunde des Mönchtums wieder.
Gleichsam durften und konnten auch Frauen an dieser Entwicklung partizipieren und sie auch eigenständig beeinflussen. Hierbei nehmen vornehmlich Makrina „die Jüngere“ und Marcella aus Rom eine hervorzuhebende Pionierstellung ein. Beiden Frauen gelang es eine eigenständige Form der gemeinschaftlichen Askese um sich herum zu statuieren und sie schafften darüber hinaus auch einen Raum in dem Bildung tradiert und vervielfältigt werden konnte. Diese Form der Askese kann also als erster Schritt weg von dem Eremitentum hin zum Mönchtum gewertet werden, in dem dann wiederum das Moment der Bildung im Blick auf die Bibliotheken, das Skriptorum und die Klosterschulen eine ganz neuen Stellenwert erlangte.
Die Frage jedoch lautet, inwieweit die Bildung in der Antike die Askese bedingt hat, oder, ob das Verhältnis von Askese und Bildung als eine wechselseitige Beziehung verstanden werden kann?
Um diese Frage hinreichend erörtern zu können, werden zwei zentrale Quellen zu den beiden erwähnten gelehrten Frauen der Antike einer untergliederten Quellenanalyse unterzogen, ehe abschließend die Ergebnisse abgeglichen werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Jungfrau Makrina
- 2.1. Einführung in die Quellengrundlage
- 2.2. Quellenanalyse - Vita Macrina
- 2.2.1. Formale Untersuchung
- 2.2.2. Inhaltliche Untersuchung
- 2.2.3. Historische Einordnung
- 2.3. Untersuchung der Askese-Konzeption
- 2.4. Die Ambivalenz des Bildungsverständnisses
- 2.5. Das Verhältnis von Askese und Bildung
- 3. Die Witwe Marcella
- 3.1. Einführung in die Quellengrundlage
- 3.2. Quellenanalyse - Nekrolog der Marcella
- 3.2.1. Formale Untersuchung
- 3.2.2. Inhaltliche Untersuchung
- 3.2.3. Historische Einordnung
- 3.3. Die asketische Lebensführung der Marcella
- 3.4. Marcellas Bildung im Blick auf ihre Askese
- 4. Vergleichende Schlussbetrachtung
- 4.1. Die Askese der Makrina und Marcella
- 4.2. Die unterschiedlichen Bildungskonzeptionen
- 4.3. Bewertender Ausblick
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Askese und Bildung bei zwei Frauen der Spätantike, Makrina und Marcella. Ziel ist es, das gängige Bild des einsamen Asketen zu hinterfragen und die vielschichtige Beziehung zwischen asketischem Lebensstil und Bildungsprozessen aufzuzeigen. Die Untersuchung basiert auf den verfügbaren Quellen und analysiert deren Konzeptionen von Askese und Bildung.
- Das gängige Bild des asketischen Eremiten in der Spätantike und dessen Kritik
- Die Askese-Konzeptionen von Makrina und Marcella
- Die unterschiedlichen Bildungsverständnisse bei Makrina und Marcella
- Das Verhältnis von Askese und Bildung in den Lebensläufen von Makrina und Marcella
- Ein Vergleich der beiden Fallstudien und deren Bedeutung für das Verständnis von Askese und Bildung in der Spätantike
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung problematisiert die gängige, vereinfachte Vorstellung von Askese in der Spätantike als einsames, weltverneinendes Leben. Sie argumentiert für eine differenziertere Betrachtung, die die vielschichtige Beziehung zwischen Askese und Bildung in den Fokus rückt und kündigt die Untersuchung der Lebensläufe von Makrina und Marcella als Fallstudien an, um dieses Verhältnis zu beleuchten. Die Arbeit untersucht, wie Askese und Bildung in ihren Leben miteinander verknüpft waren und welche Rolle Bildung in ihren jeweiligen asketischen Lebenswegen spielte.
2. Die Jungfrau Makrina: Dieses Kapitel untersucht das Leben der Makrina anhand der verfügbaren Quellen, vor allem Gregor von Nyssas „Vita Macrinae“. Es analysiert die formale und inhaltliche Struktur der Vita, ordnet sie historisch ein und beleuchtet Makrinas asketische Lebensführung und ihr Verständnis von Bildung. Besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse der ambivalenten Beziehung zwischen Askese und Bildung im Kontext von Makrinas Leben und ihrem Umfeld. Die Analyse der Vita Macrinae, inklusive der formalen und inhaltlichen Aspekte, liefert wichtige Einblicke in Makrinas Lebenskonzeption und ihre Integration von Askese und Bildung.
3. Die Witwe Marcella: Dieses Kapitel widmet sich der Untersuchung von Marcellas Leben und ihrem Verhältnis von Askese und Bildung. Ähnlich wie im vorherigen Kapitel wird die Quellenlage analysiert und der Fokus auf die asketische Praxis und das Bildungsverständnis von Marcella gelegt. Im Vergleich zu Makrina wird ein unterschiedlicher Ansatz in der Ausübung von Askese und die damit einhergehende Rolle von Bildung untersucht. Die unterschiedlichen Kontexte und Quellen werden beleuchtet, um ein umfassendes Bild von Marcellas Leben und ihrem Verhältnis von Askese und Bildung zu erstellen.
Schlüsselwörter
Askese, Bildung, Spätantike, Makrina, Marcella, Gregor von Nyssa, Vita Macrinae, Kappadozier, Mönchtum, religiöse Lebensführung, quellenkritische Analyse, historische Einordnung, Bildungsverständnis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Askese und Bildung bei Makrina und Marcella
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Askese und Bildung bei zwei Frauen der Spätantike, Makrina und Marcella. Sie hinterfragt das gängige Bild des einsamen Asketen und beleuchtet die vielschichtige Beziehung zwischen asketischem Lebensstil und Bildungsprozessen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Untersuchung basiert auf den verfügbaren Quellen zu Makrina und Marcella. Im Fokus steht die „Vita Macrinae“ von Gregor von Nyssa für Makrina und der Nekrolog der Marcella für Marcella. Die Arbeit beinhaltet eine quellenkritische Analyse dieser Texte.
Wer sind Makrina und Marcella?
Makrina und Marcella waren zwei Frauen der Spätantike, die ein asketisches Leben führten. Die Arbeit analysiert ihre Lebensläufe und beleuchtet, wie Askese und Bildung in ihren Leben miteinander verknüpft waren.
Welche Aspekte der Askese werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Askese-Konzeptionen von Makrina und Marcella, ihre asketische Lebensführung und die Unterschiede in ihren Ansätzen. Sie untersucht, wie sie Askese in ihren jeweiligen Kontexten praktizierten.
Wie wird Bildung in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Bildungsverständnisse von Makrina und Marcella und deren Beziehung zur Askese. Sie untersucht, welche Rolle Bildung in ihren asketischen Lebenswegen spielte und wie sie Bildung in ihre asketische Praxis integrierten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Kapitel über Makrina (mit Unterkapiteln zur Quellenanalyse, Askese-Konzeption und Bildung), Kapitel über Marcella (mit analoger Struktur), eine vergleichende Schlussbetrachtung und eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel widmet sich spezifischen Aspekten der Askese und Bildung bei den beiden Frauen.
Welche konkreten Fragestellungen werden bearbeitet?
Die Arbeit untersucht unter anderem das gängige Bild des asketischen Eremiten, die Askese-Konzeptionen von Makrina und Marcella, ihre unterschiedlichen Bildungsverständnisse, das Verhältnis von Askese und Bildung in ihren Lebensläufen und einen Vergleich der beiden Fallstudien.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu differenzierten Schlussfolgerungen über das Verhältnis von Askese und Bildung bei Makrina und Marcella. Sie liefert ein differenzierteres Bild der weiblichen Askese in der Spätantike und deren Beziehung zu Bildungsprozessen. Die vergleichende Schlussbetrachtung bietet einen bewertenden Ausblick auf die Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Askese, Bildung, Spätantike, Makrina, Marcella, Gregor von Nyssa, Vita Macrinae, Kappadozier, Mönchtum, religiöse Lebensführung, quellenkritische Analyse, historische Einordnung, Bildungsverständnis.
- Citation du texte
- Niklas Peuckmann (Auteur), 2013, Makrina und Marcella. Eine Untersuchung des Askese-Bildungs-Verhältnisses in der Spätantike, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265593