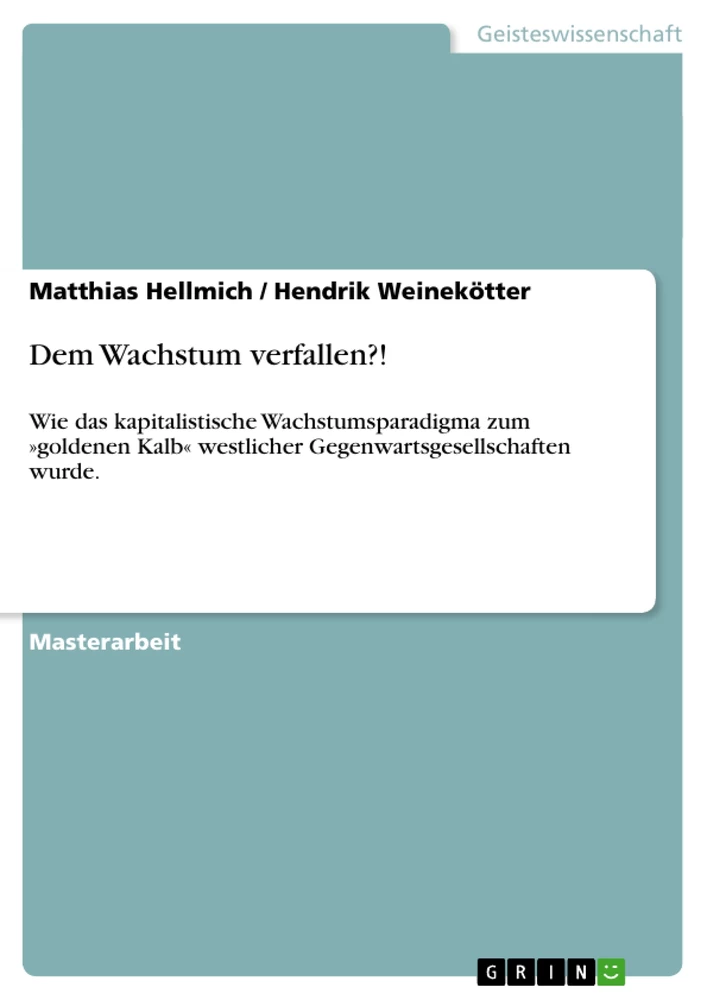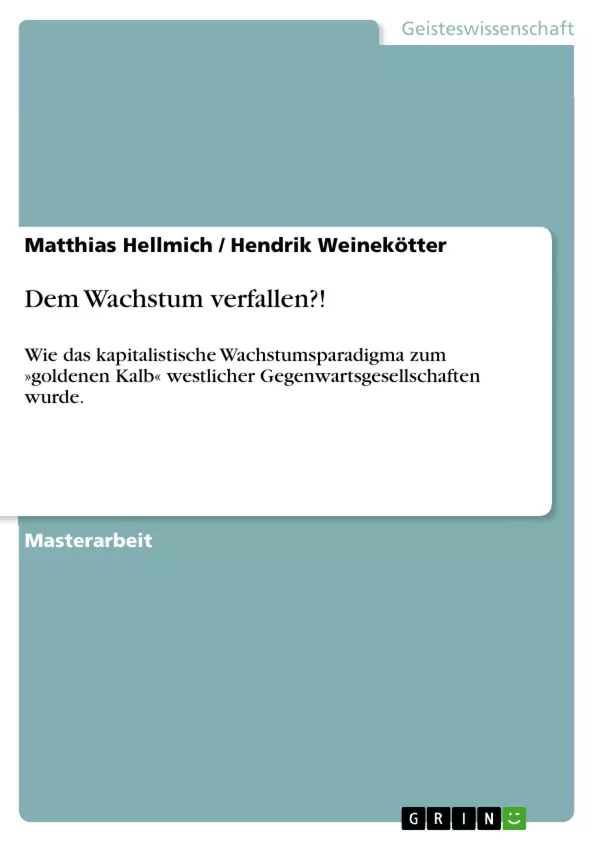Eine Alliteration ist ein sprachliches Stilmittel bei dem Wörter mit gleichen Anfangslauten aneinander gereiht werden. Dieses Stilmittel wird verwendet, um den Zusammenhang aufeinanderfolgender Begriffe stilistisch zu betonen und die Aufzählung einprägsamer zu machen. Für den politischen Betrieb in westlichen Gesellschaften scheint es eine solche Alliteration geschafft zu haben, den Status einer kausalen Argumentation zu erreichen und damit zur zentralen Leitlinie des öffentlichen und privaten Lebens zu werden. Das Motto lautet »Wirtschaft, Wachstum, Wohlstand«. Diese Kausalkette dient vielen Entscheidungsträgern als die beste Antwort auf Probleme, sowohl wirtschaftlichen, sozialen und auch ökologischen Ursprungs. Die Argumentation erscheint zunächst so simpel wie genial. Wenn von allem mehr produziert wird, dann kann auch mehr an alle verteilt werden. Wächst die Wirtschaft, dient dies im Allgemeinen dem Fortschritt und es wird innovativen Technologien, die auch die Umwelt im Blick haben, der Weg bereitet. Selbst wenn die Verteilung nicht immer gerecht verläuft, so fallen doch auch für die Benachteiligten zumindest immer größere Brocken ab. „Es gibt bei allen sich neu einpendelnden oder durchgehaltenen Ungleichheiten ein kollektives Mehr an Einkommen, Bildung, Mobilität, Recht, Wissenschaft, Massenkonsum“ (Beck, 1986, S. 122).
Das (Wirtschafts-)Wachstum ist dabei die zentrale Bedingung, gewissermaßen der Dreh- und Angelpunkt an dem die gesamte Argumentation aufgehängt ist. In den westlichen Ländern hat es den meisten Menschen über Jahrzehnte einen steten Zuwachs an materiellem und finanziellem Wohlstand beschert. Der Kapitalismus als wachstumsorientierte Wirtschaftsordnung hat sich in dieser Zeit als scheinbar durchsetzungsfähigstes System gegenüber anderen Systemen – konkret dem Kommunismus – erwiesen. Allerdings basiert dieses Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell auf der Ausbeutung des Planeten sowie eines großen Teils der Menschen bzw. der „Marginalisierten“ durch einen kleinen Teil der Weltbevölkerung. Im Zuge der Globalisierung verschwinden jedoch zunehmend die natürlichen wie menschlichen »Ressourcen«, die – dem Wachstum geschuldet – zusätzlich zu den bisherigen ausgebeutet werden können. Daher wird heute immer weniger der Raum, sondern vielmehr die Zeit ausgebeutet bzw. werden die zukünftigen Generationen ihrer Lebensgrundlagen schon heute beraubt. Die derzeitige Art des Wirtschaftens zerstört die Grundlage ihres Erfolgs.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- EINLEITUNG
- DAS OBJEKT KAPITALISMUS UND DAS MITTEL GELD
- DAS OBJEKT: KAPITALISMUS
- DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES (OKZIDENTALEN) KAPITALISMUS
- Frühkapitalismus / Industrielle Revolution (1780 — 1870)
- Industrialisierung und Organisation des Kapitalismus (1870 — 1900)
- Hochkapitalismus (1870 — 1945)
- Globalisierter Kapitalismus (1945 — 1974)
- Neoliberaler Kapitalismus (ab 1974)
- ÜBERBLICK ÜBER DIE KAPITALISMUSTHEORIE
- Beiträge zur Ökonomik: Die „unsichtbare Hand", Mehrwert und Ausbeutung
- Entstehung des okzidentalen Kapitalismus: Der kapitalistische Geist und der Protestantismus
- Moderne Ansätze: „Schöpferische Zerstörung" und Wiederbelebung des freien Marktes
- ZWISCHENFAZIT — ZUSAMMENFASSUNG UND ERWEITERUNG
- Kapitalistische Kernelemente
- Neoliberalismus in der Kritik
- DAS MITTEL: GELD
- ÖKONOMSCHE LEHRBUCH-DEFINITION DES GELDES
- GELD IN DER ANALYSE NACH MARX
- Preis und Wert einer Ware
- Wann wird Geld zu Kapital?
- Mehrwert und menschliche Arbeit
- SOZIOLOGISCHE BETRACHTUNG DES GELDES — DIE NEUERE GELDTHEORIE
- Warum wird gegen Geld getauscht?
- Wie entstehen (Geld-)Werte?
- Vertrauen und Unsicherheiten beim Handel mit Geld
- Geld und die Parallelen zur Religion
- Legitimation des Geldes
- ZWISCHENFAZIT-KAPITALISMUS NUR MIT GELD?
- DAS SUBJEKT IM KAPITALISMUS
- KAPITALISMUS — EINE GESELLSCHAFTLICHE KONSTRUKTION?!
- ENTSTEHUNG UND LEGITIMATION DER SOZIALEN ORDNUNG „KAPITALISMUS"
- Institutionalisierung des Kapitalismus als Wirklichkeitsbestimmung
- Legitimationsprozesse und ihre Entsprechung im Kapitalismus
- Ökonomisierung am Beispiel des Social Entrepreneurs
- SOZIALE ORDNUNG ALS EIN REZIPROKER PROZESS
- Herausforderungen für Legitimationsstrukturen
- Machterhalt und der Umgang mit „Irrlehren"
- Monopolanspruch der symbolischen Sinnwelt „Kapitalismus"
- Merkmale kapitalistischer Sozialisation
- „Verwandlung" in eine neue Sinnwelt — Gibt es eine Abkehr vom Kapitalismus?
- KAPITALISMUS ALS SOZIALE ORDNUNG — ZWISCHENFAZIT
- WACHSTUMSTRIEB AUF DER SUBJEKTEBENE
- DAS KAPITALISTISCHE SUBJEKT
- INNERE LANDNAHME UND KONSUM (KULTUR)
- KAPITALISTEN OHNE KAPITAL ODER: WIE DAS SUBJEKT DEM WACHSTUM VERFALLEN
- Grenzen von Wachstum und Wohlstand
- Innere Landnahme, Konsumkultur, Kulturindustrie und das Subjekt
- Eigenverantwortlichkeit der Biographie — Fremdzwang wird zu Selbstzwang
- Was ist das „Mehr"? — Selbstverwirklichung und Ökonomisierung des Lebens
- Beschleunigung des Lebens
- Soziale Bedeutung des Konsums
- Zusammenfassung
- ZWISCHENFAZIT: ÖKONOMSIERUNG DES SUBJEKTS IM NEOLIBERALISMUS
- SCHLUSSTEIL
- (Aus-)BLICK ÜBER DEN KAPITALISTISCHEN TELLERRAND
- REFLEXIVE SCHLUSSBETRACHTUNG
- LITERATURVERZEICHNIS
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Kausalkette „Wirtschaft, Wachstum, Wohlstand“?
Dieses Motto dient westlichen Gesellschaften als Leitlinie, wonach Wirtschaftswachstum die Voraussetzung für Fortschritt und materiellen Wohlstand für alle Schichten ist.
Welche Kritik wird am neoliberalen Kapitalismus geäußert?
Kritisiert werden die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die zunehmende soziale Ungleichheit und die Beraubung zukünftiger Generationen ihrer Lebensgrundlagen.
Was versteht man unter der „Ökonomisierung des Subjekts“?
Es beschreibt den Prozess, bei dem der Einzelne sein gesamtes Leben (Selbstverwirklichung, Zeit, Beziehungen) nach ökonomischen Effizienzprinzipien ausrichtet und sich selbst unter Wachstumsdruck setzt.
Wie hat sich der Kapitalismus historisch entwickelt?
Die Arbeit zeichnet den Weg vom Frühkapitalismus über den Hochkapitalismus bis hin zum globalisierten und heutigen neoliberalen Kapitalismus nach.
Welche soziologische Bedeutung hat Geld in diesem System?
Geld wird nicht nur als Tauschmittel, sondern als Mittel zur Kapitalakkumulation und als zentrales Element der sozialen Ordnung und Legitimation betrachtet.
- Quote paper
- M. A. Matthias Hellmich (Author), Hendrik Weinekötter (Author), 2012, Dem Wachstum verfallen?!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265652