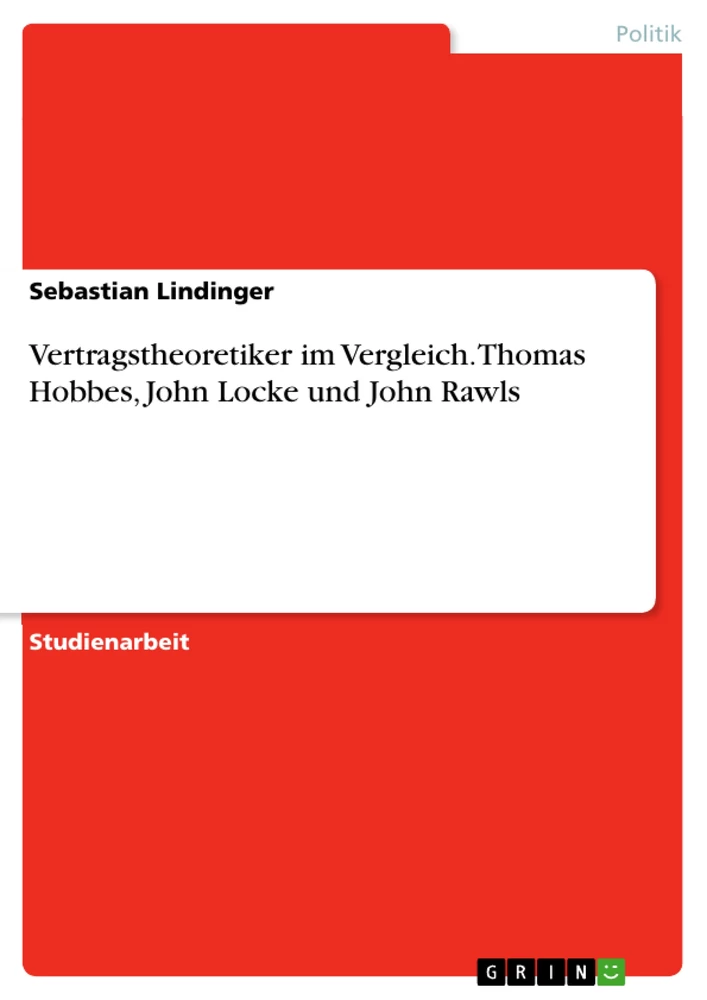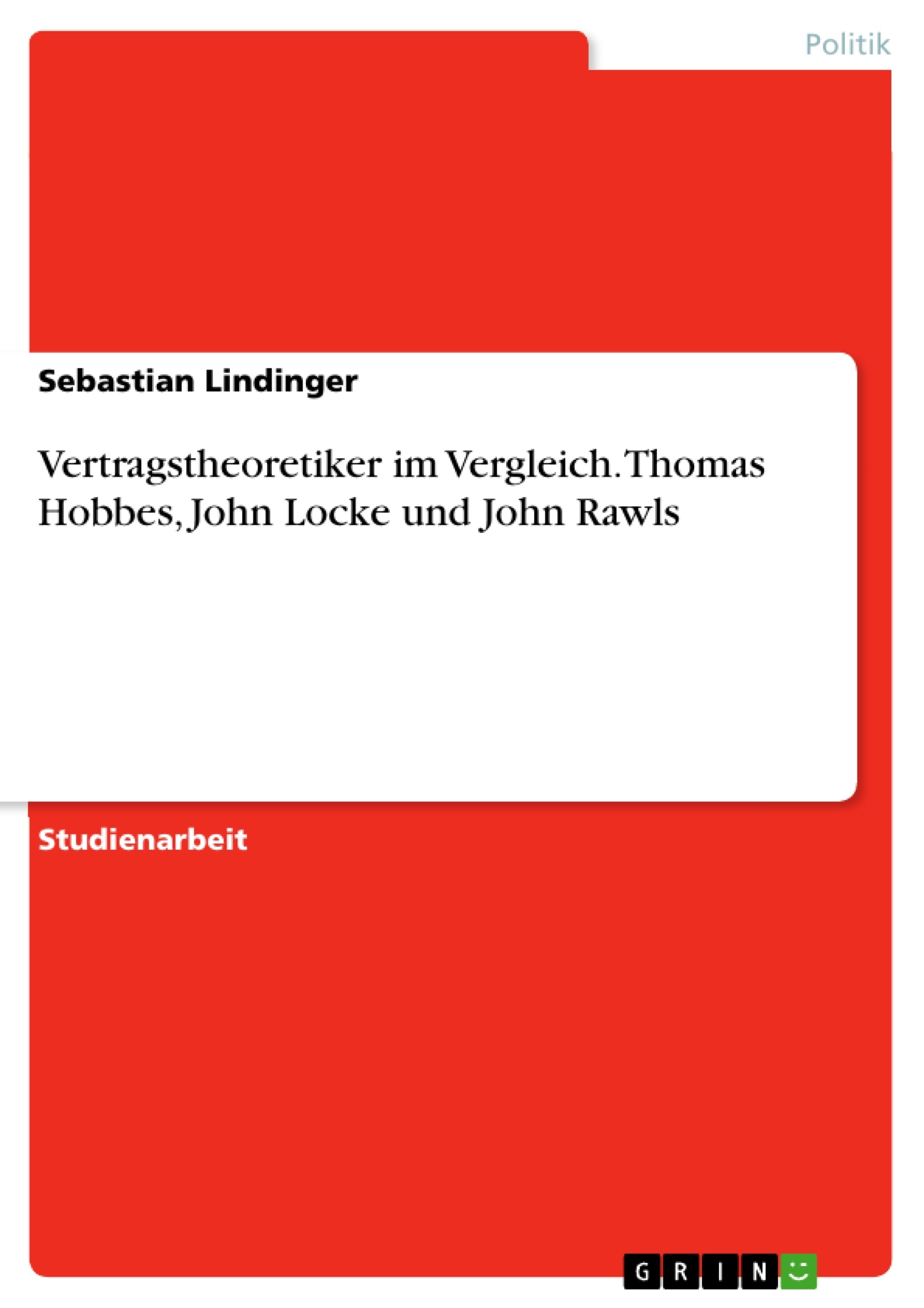In der folgenden Arbeit werde ich die beiden klassischen Vertragstheoretiker Thomas Hobbes und John Locke mit dem eher moderneren Vertragstheoretiker John Rawls vergleichen, insbesondere in ihren Vorstellungen vom Menschen, vom Natur- bzw. Urzustand und der Bildung des Staates durch Vertrag bzw. die Theorie der Gerechtigkeit von Rawls. Thomas Hobbes (1588-1679) gilt als Begründer der modernen politischen Philosophie und der neuzeitlichen Politik und damit des neuzeitlichen politischen Denkens. Hobbes führt zu einem Paradigmenwechsel in der Politik, was zum Ende des klassischen aristotelischen Politikverständnisses führte. (vgl. Kersting 2008, S. 10 ff.) Aufgrund seiner Erfahrungen im englischen Bürgerkrieg entwickelte Hobbes ein eher absolutistisches Staatsmodell. (vgl. Euchner 1996, S. 81) John Locke (1632-1704) gilt als Begründer der aufklärerischen Erkenntniskritik und beeinflusste die Philosophie des 17.-18. Jahrhunderts. Durch seine Vorstellung von der staatlichen Gewaltenteilung, prägte er das Bild des bürgerlich-liberalen Verfassungsstaates, noch im Grundrechtsteil des deutschen Grundgesetzes von 1949 ist sein Einfluss sichtbar. Des Weiteren trat Locke für die Religionsfreiheit ein und beschäftigte sich mit Pädagogik. (vgl. Brockhaus Online Enzyklopädie 2013a) Locke entwickelte ein Modell für eine liberale konstitutionelle Monarchie, das bereits Ähnlichkeiten mit dem modernen Verfassungsstaat aufweist. (vgl. Euchner 1996, S. 81) John Rawls (1921-2002) war ein amerikanischer Philosoph, er begründete ein vertragstheoretisches Modell von Gerechtigkeit als Fairness, beruhend auf den Prinzipien von gleichen Grundrechten bzw. Freiheiten, der Chancengleichheit und der Rechtfertigung von Ungleichheiten. (vgl. Brockhaus Online Enzyklopädie 2013b)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vertragstheorie (Kontraktualismus)
- Thomas Hobbes
- Menschenbild
- Naturzustand
- Vertrag und die Bildung des Staates
- John Locke
- Menschenbild
- Naturzustand
- Vertrag und die Bildung des Staates
- John Rawls
- Menschenbild
- Urzustand
- Eine Theorie der Gerechtigkeit
- Zentrale Unterschiede
- Menschenbild
- Naturzustand
- Vertrag und die Bildung des Staates/Eine Theorie der Gerechtigkeit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem Vergleich der klassischen Vertragstheoretiker Thomas Hobbes und John Locke mit dem modernen Vertragstheoretiker John Rawls. Im Fokus stehen die jeweiligen Vorstellungen von Mensch, Naturzustand bzw. Urzustand und der Bildung des Staates durch Vertrag bzw. Rawls' Theorie der Gerechtigkeit.
- Das Menschenbild der drei Denker
- Die Konzeption des Naturzustands bzw. Urzustands
- Die Rolle des Vertrages in der Bildung des Staates
- Die Bedeutung von Freiheit und Gerechtigkeit in den jeweiligen Theorien
- Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei Vertragstheorien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die drei Vertragstheoretiker Thomas Hobbes, John Locke und John Rawls vor. Sie skizziert die zentralen Themen und die Zielsetzung der Arbeit.
Das zweite Kapitel widmet sich der Vertragstheorie (Kontraktualismus) als philosophischer Grundlage der Arbeit. Es werden die zentralen Fragen und die Grundannahmen des Kontraktualismus erläutert.
Im dritten Kapitel wird das Menschenbild, der Naturzustand und die Bildung des Staates bei Thomas Hobbes analysiert. Hierbei werden die zentralen Elemente seiner Theorie, wie der Egoismus des Menschen, der Krieg aller gegen alle im Naturzustand und die Notwendigkeit eines absoluten Souveräns zur Überwindung des Naturzustands, dargestellt.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit John Locke und seinen Vorstellungen von Mensch, Naturzustand und Staat. Locke sieht den Menschen als von Natur aus frei und gleich, wobei das Naturgesetz die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben bildet. Die Bildung des Staates erfolgt durch einen Vertrag, der jedoch nicht alle Rechte an den Staat abtritt, sondern das Recht auf Eigentum und Widerstand gegen den Staat bewahrt.
Das fünfte Kapitel widmet sich John Rawls und seiner Theorie der Gerechtigkeit als Fairness. Rawls konstruiert einen Urzustand, in dem sich die Menschen unter einem Schleier des Nichtwissens auf Grundsätze der Gerechtigkeit einigen. Diese Grundsätze legen die Grundlage für eine Gesellschaft, die auf Freiheit, Gleichheit und Chancengleichheit basiert.
Das sechste Kapitel analysiert die zentralen Unterschiede zwischen den drei Vertragstheorien. Es werden die verschiedenen Menschenbilder, Naturzustände und die unterschiedlichen Vorstellungen von der Bildung des Staates verglichen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Gesellschaftsvertrag, den Naturzustand, das Menschenbild, die Bildung des Staates, die politische Philosophie, Thomas Hobbes, John Locke, John Rawls, Gerechtigkeit als Fairness, Freiheit, Eigentum, Selbsterhaltung, Macht, Vernunft, Krieg aller gegen alle, Urzustand, Schleier des Nichtwissens, Grundrechte, Gewaltenteilung, Widerstandsrecht.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die zentralen Vertragstheoretiker in diesem Vergleich?
Die Arbeit vergleicht die klassischen Theoretiker Thomas Hobbes und John Locke mit dem modernen Philosophen John Rawls.
Was ist der Hauptunterschied im Menschenbild von Hobbes und Locke?
Während Hobbes den Menschen als egoistisch und im "Krieg aller gegen alle" sieht, betrachtet Locke den Menschen als von Natur aus frei und gleich, geleitet durch ein Naturgesetz des Friedens.
Was versteht John Rawls unter dem "Schleier des Nichtwissens"?
Es ist ein Gedankenexperiment im Urzustand, bei dem Menschen Grundsätze der Gerechtigkeit wählen, ohne ihre eigene soziale Position, Talente oder Interessen zu kennen, um Fairness zu garantieren.
Welche Staatsform favorisierte Thomas Hobbes?
Hobbes plädierte aufgrund seiner Erfahrungen im Bürgerkrieg für ein absolutistisches Staatsmodell mit einem starken Souverän zur Friedenssicherung.
Wie beeinflusste John Locke das moderne Grundgesetz?
Lockes Ideen zur Gewaltenteilung, zum Schutz von Eigentum und zum Widerstandsrecht gegen Tyrannei prägten das bürgerlich-liberale Verfassungsverständnis maßgeblich.
Was ist das Ziel von Rawls' "Theorie der Gerechtigkeit"?
Rawls möchte eine Gesellschaftsordnung begründen, die auf gleichen Grundrechten, echter Chancengleichheit und der Rechtfertigung von Ungleichheiten zum Vorteil der Schwächsten basiert.
- Citation du texte
- Sebastian Lindinger (Auteur), 2013, Vertragstheoretiker im Vergleich. Thomas Hobbes, John Locke und John Rawls, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265752