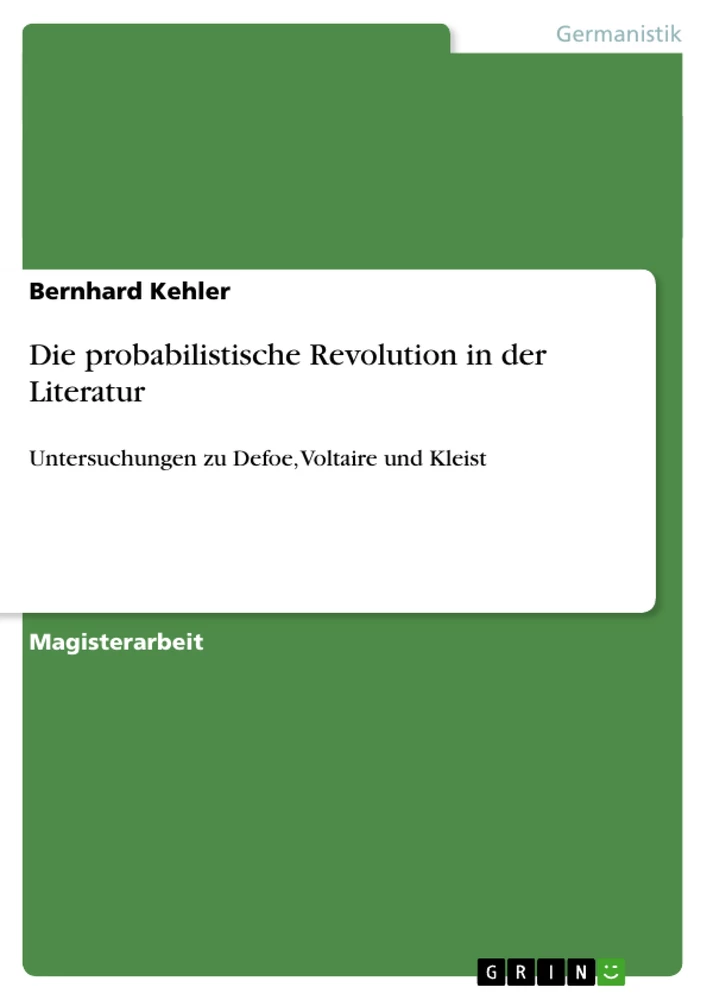Die probabilistische Revolution (1650-1850) steht im Zentrum des Wandels, den die Aufklärung vollzogen hat, vom klerikalen und absolutistischen Staat hin zu einem Gesellschaftssystem, welches sich sowohl der Wissenschaftlichkeit als auch einem System hinterfragter Vernunft verschrieben hat. Der Mathematik kommt dabei eine Brückenkopffunktion zu, indem sie den moraltheologischen Diskurs mit den kalkulierenden, spekulierenden und erkenntnistheoretischen Elementen der Philosophie verbunden hat. Als Geburtsstunde dieser revolutionären Entwicklung wird der wissenschaftstheoretische Diskurs von Fermat und Pascal zum unterbrochenen Spiel angesehen, der im Laufe von etwa zweihundert Jahren zu einer quantitativen Theorie der Wahrscheinlichkeit weiterentwickelt wurde. Parallel zu dem in der Symbolik der Mathematik gehaltenen Diskurs zur Wahrscheinlichkeitstheorie wurden die großen Fragen der Religion, der Philosophie und des Gesellschaftsverständnisses einer ganzen Epoche diskutiert. Nahezu zeitgleich entstand der moderne Roman, der sich signifikant von dem Erzählen vor der Aufklärung unterscheidet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Das Thema
- 1.1 Etymologische Erschließung des begrifflichen Umfeldes
- 2 Untersuchungen zur Schicksalssemantik
- 2.1 Die Schicksalssemantik der Antike im Rahmen einer metaphysischen Ordnung
- 2.1.1 Das Orakel von Delphi
- 2.1.2 Wesensbestimmung und Eingrenzung der Begriffe Zufall, Wahrscheinlichkeit und Zukunft bei Aristoteles, Platon und Cicero
- 2.1.2.1 Die Rolle des Zufalls in der aristotelischen Philosophie
- 2.1.2.2 Die Rolle der Wahrscheinlichkeit in der Rhetorik von Aristoteles und von Cicero
- 2.1.2.3 Die Rolle der Wahrscheinlichkeit in der Poetik von Aristoteles und Platon
- 2.1.2.4 Der Begriff der Zukunft in der Philosophie von Aristoteles
- 2.2 Die Schicksalssemantik des Mittelalters im Rahmen einer providentiellen Ordnung
- 2.2.1 Die Doktrin des Augustinus
- 2.2.2 Die Doktrin von Thomas von Aquin
- 2.2.3 Die neue Doktrin der providentiellen Ordnung bei Calvin
- 2.2.4 Aleatorische Praktiken als sakrale Entscheidungsinstanz
- 2.2.5 Die Verbannung des Glückspiels und der astrologischen Schicksalsbefragung
- 2.3 Die Sprengung der Schicksalssemantik und der Ordnung durch die mathematische Analyse des Zufalls und der Wahrscheinlichkeit
- 2.3.1 Pascal und Fermat: Dialog zum unvollendeten Spiel
- 2.3.2 Der Brückenschlag von der Wahrscheinlichkeit der antiken Rhetorik zur neuen Wahrscheinlichkeit der Mathematiker
- 2.3.2.1 Die Logik von Port Royal
- 2.3.2.2 Leibniz und die neue Rhetorik der Wahrscheinlichkeit
- 2.4 Das Erdbeben von Lissabon
- 2.4.1 Das Erdbeben von Lissabon und seine Auswirkungen auf die Schicksalssemantik und die Doktrin der providentiellen Ordnung
- 2.4.2 Der Theodizeebegriff bei Leibniz
- 2.4.3 Poème sur le Désastre de Lisbonne
- 2.4.4 Die Antwort Rousseaus auf das Gedicht von Voltaire
- 3 Die neue Leitsemantik der Aufklärung im Spiegel der Literatur Voltaire - Defoe - Kleist
- 3.1 Voltaires satirische Antwort auf eine neue vernunftorientierte Schicksalssemantik
- 3.1.1 Candide, ou l'Optimisme
- 3.1.2 Charakteristika des Romanerzählens bei Voltaire
- 3.2 Daniel Defoes: Unkalkulierbares Abenteuer oder abschätzbares Risiko
- 3.2.1 Of Listening to the Voice of Providence
- 3.2.2 Defoes Auseinandersetzung mit Glücksspiel, Wette und Empirismus aus der Perspektive eines Ökonomen
- 3.2.3 Robinson Crusoes Güterabwägung von Chancen und Risiken
- 3.2.4 Charakteristika des Romanerzählens bei Daniel Defoe
- 3.3 Heinrich von Kleist: Eruptive Gewalt als unkalkulierbare Variable des Lebens
- 3.3.1 Heinrich von Kleists Auseinandersetzung mit dem sich etablierenden Paradigma des Empirismus
- 3.3.2 Zufall und Ordnung in der Ästhetik Heinrich von Kleists
- 3.3.3 Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten
- 3.3.4 Das Erdbeben von Chili
- 3.3.5 Charakteristika des Romanerzählens bei Heinrich von Kleist
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der probabilistischen Revolution (1650-1850) auf die Literatur, insbesondere auf die Entwicklung des Romans. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen der mathematischen Analyse von Zufall und Wahrscheinlichkeit und dem Wandel der Schicksalssemantik aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert, wie sich die neue Denkweise in den Werken von Voltaire, Defoe und Kleist manifestiert.
- Die Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs von der Antike bis zur Aufklärung.
- Der Einfluss der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie auf das philosophische und gesellschaftliche Denken.
- Die Darstellung von Zufall und Schicksal in den Romanen von Voltaire, Defoe und Kleist.
- Der Wandel der Erzählstrukturen im Roman im Kontext der probabilistischen Revolution.
- Der Vergleich der literarischen Strategien der drei Autoren im Umgang mit dem Thema Zufall und Schicksal.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Das Thema: Dieses einführende Kapitel skizziert die zentrale These der Arbeit: die probabilistische Revolution beeinflusste maßgeblich die Entwicklung des Romans als Medium der Kontingenzreflektion. Es werden die wichtigsten Begriffe (Wahrscheinlichkeit, Probabilität, Kontingenz, Providenz) eingeführt und deren historische Entwicklung angekündigt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie als Brücke zwischen moraltheologischem Diskurs und philosophischen Fragen einer ganzen Epoche. Die Arbeit kündigt eine etymologische Untersuchung der zentralen Begriffe sowie eine Analyse der literarischen Werke von Voltaire, Defoe und Kleist an, um den Einfluss der probabilistischen Revolution auf das literarische Schaffen zu verdeutlichen.
2 Untersuchungen zur Schicksalssemantik: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung des Schicksalsbegriffs von der Antike über das Mittelalter bis zur Aufklärung. Es analysiert die Rolle von Zufall und Wahrscheinlichkeit in den Philosophien von Aristoteles, Platon und Cicero, sowie die Veränderungen durch die Denkweisen des Augustinus, Thomas von Aquin und Calvin. Besondere Beachtung findet der Einfluss der mathematischen Analyse des Zufalls und der Wahrscheinlichkeit, insbesondere die Arbeiten von Pascal und Fermat, auf das Verständnis von Schicksal und Providenz. Der Fokus liegt auf dem Paradigmenwechsel, der mit der Aufklärung einhergeht und zu einer neuen Beziehung des Einzelnen zu seinem Schicksal führt.
3 Die neue Leitsemantik der Aufklärung im Spiegel der Literatur Voltaire - Defoe - Kleist: Dieses Kapitel untersucht die literarische Umsetzung der neuen Schicksalssemantik anhand der Werke von Voltaire, Defoe und Kleist. Es analysiert, wie die Autoren die neuen Konzepte von Zufall und Wahrscheinlichkeit in ihren Romanen thematisieren und wie sich dies auf die Erzählstrukturen auswirkt. Der Vergleich der drei Autoren soll die unterschiedlichen literarischen Strategien im Umgang mit den neuen Denkmustern aufzeigen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei Voltaires "Candide", Defoes "Robinson Crusoe" und Kleists "Erdbeben von Chili".
Schlüsselwörter
Probabilistische Revolution, Aufklärung, Wahrscheinlichkeit, Zufall, Schicksal, Providenz, Kontingenz, Roman, Voltaire, Defoe, Kleist, Etymologie, Schicksalssemantik, Empirismus, Theodizee, Erzähltheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Untersuchungen zur Schicksalssemantik in der Literatur der Aufklärung"
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der probabilistischen Revolution (1650-1850) auf die Literatur, insbesondere die Entwicklung des Romans. Im Fokus steht der Zusammenhang zwischen der mathematischen Analyse von Zufall und Wahrscheinlichkeit und dem Wandel der Schicksalssemantik in der Aufklärung. Die Analyse konzentriert sich auf die Werke von Voltaire, Defoe und Kleist.
Welche Epochen und Denker werden behandelt?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung des Schicksalsbegriffs von der Antike (Aristoteles, Platon, Cicero) über das Mittelalter (Augustinus, Thomas von Aquin, Calvin) bis zur Aufklärung. Die mathematische Analyse des Zufalls und der Wahrscheinlichkeit durch Pascal und Fermat spielt eine zentrale Rolle, ebenso wie die Auswirkungen des Erdbebens von Lissabon auf die Schicksalssemantik.
Welche Autoren und Werke stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Arbeit analysiert die literarische Umsetzung der neuen Schicksalssemantik anhand der Romane von Voltaire ("Candide"), Defoe ("Robinson Crusoe") und Kleist ("Erdbeben von Chili"). Der Vergleich der drei Autoren zeigt unterschiedliche literarische Strategien im Umgang mit Zufall und Schicksal auf.
Welche Aspekte der probabilistischen Revolution werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs, den Einfluss der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie auf das philosophische und gesellschaftliche Denken, die Darstellung von Zufall und Schicksal in den untersuchten Romanen und den Wandel der Erzählstrukturen im Kontext der probabilistischen Revolution.
Welche Schlüsselbegriffe werden behandelt?
Schlüsselbegriffe sind: Probabilistische Revolution, Aufklärung, Wahrscheinlichkeit, Zufall, Schicksal, Providenz, Kontingenz, Roman, Voltaire, Defoe, Kleist, Etymologie, Schicksalssemantik, Empirismus, Theodizee, Erzähltheorie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus drei Hauptkapiteln: Kapitel 1 ("Das Thema") bietet eine Einleitung und Einführung der zentralen Begriffe. Kapitel 2 ("Untersuchungen zur Schicksalssemantik") verfolgt die historische Entwicklung des Schicksalsbegriffs. Kapitel 3 ("Die neue Leitsemantik der Aufklärung im Spiegel der Literatur Voltaire - Defoe - Kleist") analysiert die literarische Umsetzung der neuen Schicksalssemantik bei den drei ausgewählten Autoren.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen der mathematischen Analyse von Zufall und Wahrscheinlichkeit und dem Wandel der Schicksalssemantik aufzuzeigen und die Manifestation dieser neuen Denkweise in den Werken von Voltaire, Defoe und Kleist zu analysieren.
- Quote paper
- Bernhard Kehler (Author), 2013, Die probabilistische Revolution in der Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265765