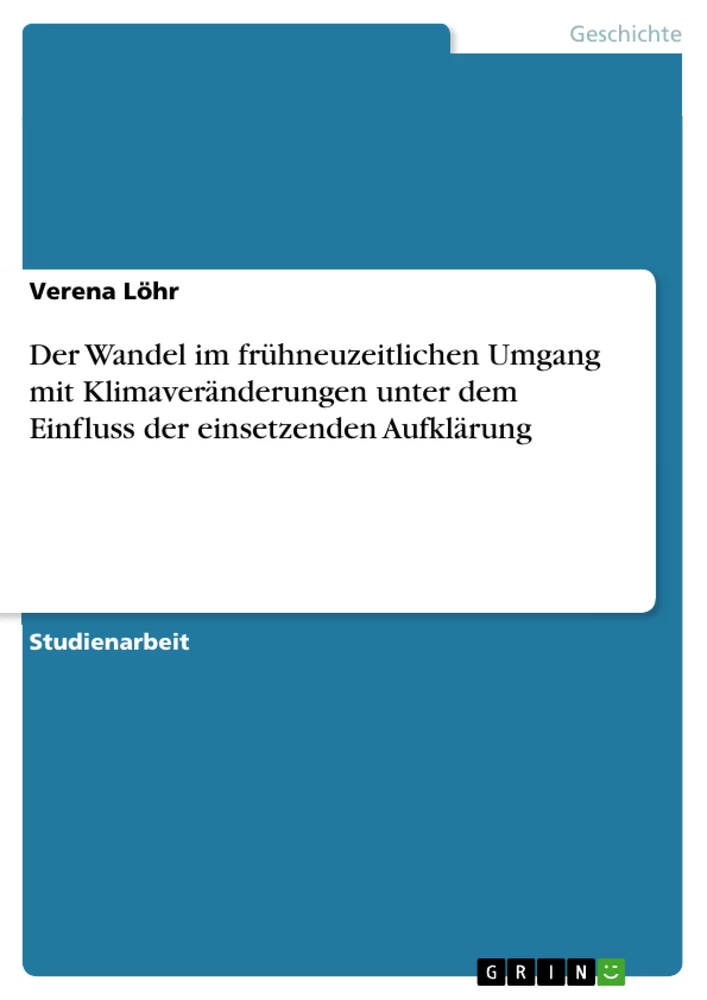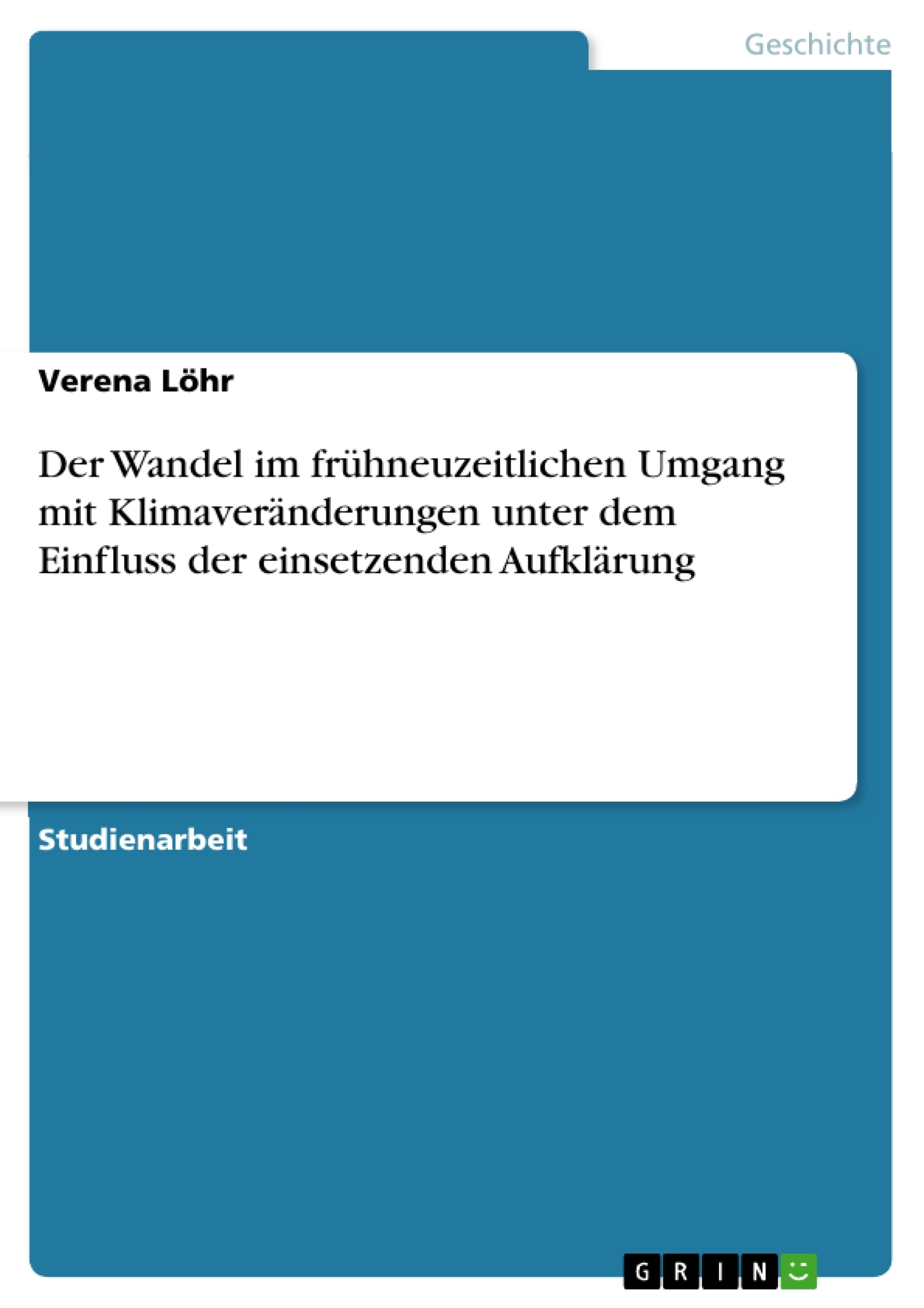Die Kulturgeschichte des Klimas der Frühen Neuzeit soll in dieser Arbeit als Beispiel dienen
zu zeigen, wie man mit Klimaveränderungen umgehen und wie sich dieser Umgang im Laufe
der Zeit durch gewonnene Erfahrungen verändern kann. Durch die frühneuzeitliche Kleine
Eiszeit kann man gut erkennen, wie bereits geringe Veränderungen des Klimas zu enormen
sozialen, politischen und religiösen Erschütterungen führen können. Zunächst wurde
beispielsweise zur Zeit des Dreißigjähren Krieges (1618-1648) Gott für schlechtes Wetter
verantwortlich gemacht, in welchem er seinen Zorn auf die Menschen auszudrücken schien.
Dieser Glaube an die sogenannte „Sündenökonomie“ zeigt sich später in dem hier zu
untersuchenden Kirchenlied „Buß- und Betgesang bei unzeitiger Nässe und betrübtem
Gewitter“ von Paul Gerhardt, welches vor 1648 verfasst wurde. Einige Menschen in der
Frühen Neuzeit erkannten allerdings mit der Zeit, dass allein Beten und tugendhaftes
Verhalten das schlechte Wetter nicht verbesserte. Mit der zunehmenden Verbreitung
aufklärerischen Gedankenguts im späten 17. Jahrhundert veränderten sich die Mentalität und
das Verhältnis zur Religion. Gott war weiterhin für viele Menschen ein wichtiger Punkt in
ihrem Leben, aber er war nicht mehr der allmächtige Richter und Lenker, der beispielsweise
für das Wetter verantwortlich war. Diese durch die Aufklärung geprägte Entwicklung soll zu
späterem Zeitpunkt in dieser Arbeit anhand des 1744 verfassten Lexikonartikels „Sündfluth“ von Johann Heinrich Zedler aufgezeigt werden. So soll anschließend das Ziel dieser Arbeit
ein Vergleich beider Textquellen sein, um den Wandel im frühneuzeitlichen Umgang mit
Klimaveränderungen unter Einfluss der einsetzenden Aufklärung darzustellen. Dieser
Mentalitätswandel kann unter der aktuellen Debatte um die globale Erderwärmung vielleicht
als Musterbeispiel dienen, wie wir Menschen mit unaufhaltsamen Veränderungen leben
lernen und umgehen können, sodass sich im Anschluss daran sogar ein Nutzen davon ziehen
lässt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kritik
- Der biographische Hintergrund Paul Gerhardts
- Intention und Adressatenkreis Paul Gerhardts
- Inhaltsangabe „Buß- und Betgesang bei unzeitiger Nässe und begrübtem Gewitter"
- Biographischer Hintergrund Johann Heinrich Zedlers
- Intention und Adressatenkreis Johann Heinrich Zedlers
- Inhaltsangabe „Lexikonartikel „Sündfluth"
- Interpretation
- Wahrnehmungen: Was und wie wurde beobachtet?
- Ursachen der Ereignisse
- Schlussfolgerung: Wozu wurden die Quellen verfasst?
- Quellenvergleich
- Welche Klimasignale sind in den Quellen zu erkennen?
- Welche Rolle spielt die Sündenökonomie?
- Kulturelle Reaktionen auf Klimaveränderungen
- Fazit
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Quellen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Wandel im frühneuzeitlichen Umgang mit Klimaveränderungen unter dem Einfluss der einsetzenden Aufklärung. Sie analysiert zwei Textquellen - ein Kirchenlied von Paul Gerhardt und einen Lexikonartikel von Johann Heinrich Zedler - um den Wandel im Denken und der Reaktion auf Klimaveränderungen zu verdeutlichen. Die Arbeit zielt darauf ab, die historischen Reaktionen auf Klimaveränderungen im Kontext der Aufklärung zu beleuchten und Parallelen zur heutigen Debatte um die globale Erderwärmung aufzuzeigen.
- Die Wahrnehmung von Klimaveränderungen in der Frühen Neuzeit
- Die Rolle der Sündenökonomie im Umgang mit Klimaveränderungen
- Der Einfluss der Aufklärung auf das Verständnis von Klimaveränderungen
- Die Entwicklung von kulturellen Reaktionen auf Klimaveränderungen
- Der Vergleich von historischen und modernen Reaktionen auf Klimaveränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Klimaveränderungen ein und stellt die Relevanz der Kulturgeschichte des Klimas für das Verständnis von heutigen Herausforderungen heraus. Sie erläutert die Bedeutung der Kleinen Eiszeit als Beispiel für die Folgen von Klimaveränderungen und die Notwendigkeit, historische Reaktionen auf Klimaveränderungen zu untersuchen.
Das Kapitel „Kritik" beleuchtet die biographischen Hintergründe der Autoren Paul Gerhardt und Johann Heinrich Zedler sowie die Intention und den Adressatenkreis ihrer jeweiligen Werke. Es bietet eine Inhaltsangabe des Kirchenliedes „Buß- und Betgesang bei unzeitiger Nässe und begrübtem Gewitter" von Paul Gerhardt und des Lexikonartikels „Sündfluth" von Johann Heinrich Zedler.
Das Kapitel „Interpretation" analysiert die beiden Textquellen hinsichtlich der Wahrnehmungen von Klimaveränderungen, der Ursachen der Ereignisse und der Intention der Autoren. Es werden die Klimasignale, die in den Texten beschrieben werden, sowie die Rolle der Sündenökonomie im Denken der damaligen Zeit untersucht.
Das Kapitel „Quellenvergleich" vergleicht die beiden Textquellen unter dem Aspekt des Wandels im frühneuzeitlichen Umgang mit Klimaveränderungen unter dem Einfluss der einsetzenden Aufklärung. Es werden die Klimasignale, die in den Quellen zu erkennen sind, die Rolle der Sündenökonomie und die kulturellen Reaktionen auf Klimaveränderungen in den beiden Epochen gegenübergestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Wandel im Umgang mit Klimaveränderungen, die Kleine Eiszeit, die Sündenökonomie, die Aufklärung, die Kulturgeschichte des Klimas, Paul Gerhardt, Johann Heinrich Zedler, „Buß- und Betgesang bei unzeitiger Nässe und begrübtem Gewitter", „Lexikonartikel „Sündfluth", und die historische und moderne Reaktion auf Klimaveränderungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte die Aufklärung den Umgang mit dem Klima?
Durch die Aufklärung wandelte sich die Sichtweise: Gott galt nicht mehr als allmächtiger Richter, der das Wetter als Strafe lenkte, sondern man suchte nach rationalen Erklärungen.
Was bedeutet der Begriff „Sündenökonomie“?
Es ist der Glaube, dass schlechtes Wetter oder Naturkatastrophen ein Ausdruck des göttlichen Zorns über das sündhafte Verhalten der Menschen sind.
Welchen Einfluss hatte die „Kleine Eiszeit“ auf die Gesellschaft?
Die geringfügigen Temperaturabsenkungen führten zu enormen sozialen, politischen und religiösen Erschütterungen in der Frühen Neuzeit.
Welche Quellen werden in der Arbeit verglichen?
Verglichen werden ein Kirchenlied von Paul Gerhardt (vor 1648) und ein Lexikonartikel von Johann Heinrich Zedler (1744).
Welchen Bezug hat die historische Klimaforschung zur heutigen Zeit?
Der historische Mentalitätswandel dient als Musterbeispiel dafür, wie Menschen lernen können, mit unaufhaltsamen Veränderungen wie der globalen Erderwärmung umzugehen.
- Citar trabajo
- Verena Löhr (Autor), 2012, Der Wandel im frühneuzeitlichen Umgang mit Klimaveränderungen unter dem Einfluss der einsetzenden Aufklärung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265854