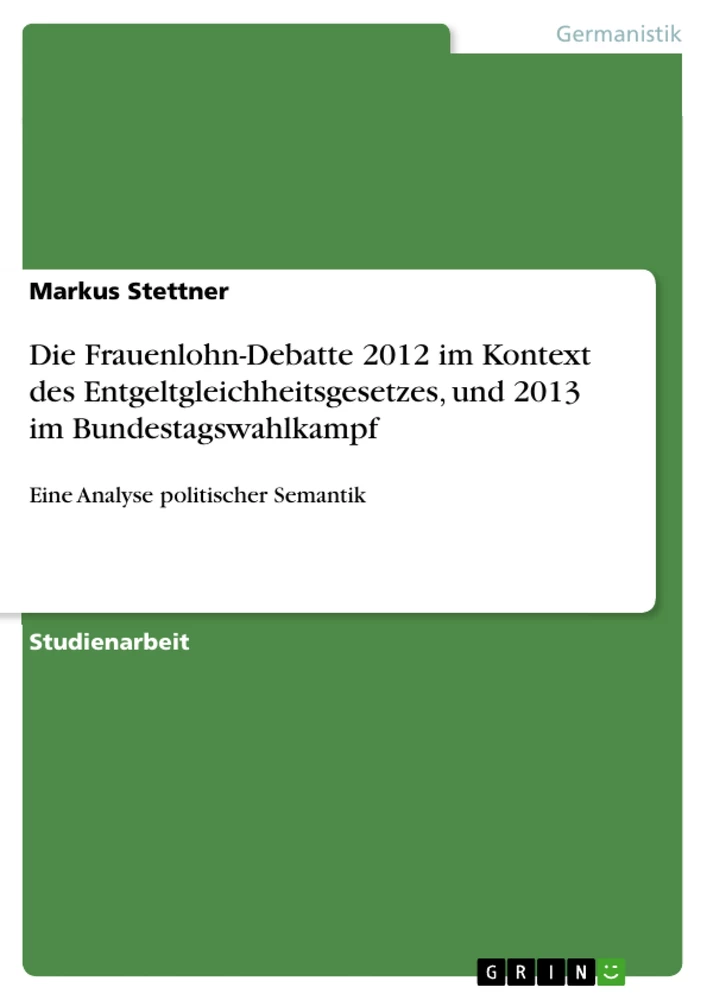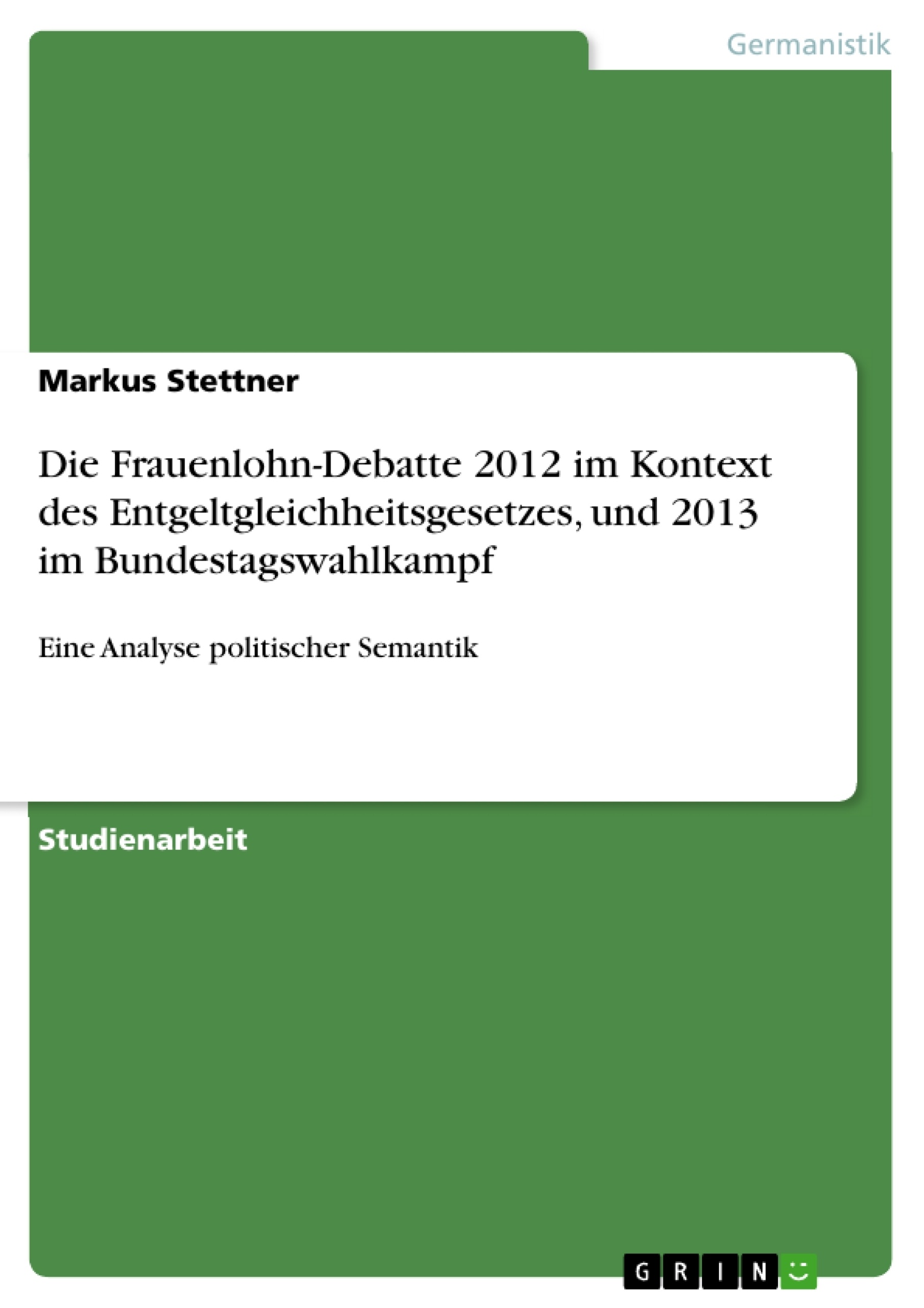Ein Jahr in dem eine Bundestagswahl bevor steht eignet sich besonders gut, um sich mit poli-tischer Semantik zu beschäftigen. Die politische Landschaft der Parteien ist in einem solchen Zeitraum in besonderer Art und Weise gezwungen sich politisch und semantisch zu positionieren. Einerseits wird genauer zugehört, sei es von den Medien oder von andersartigen Institutionen, was die Parteien sagen bzw. ankündigen oder versprechen, was die politischen Parteien zwingt sich semantisch günstig zu platzieren. Andererseits erstellt sich gerade hierdurch, in Form von Wahlprogrammen, eine besondere Dichte von politischer Semantik, die es sich zu analysieren lohnt.
Da die Themen der Parteien zahlreich sind, ist es sinnvoll sich einem Themenkomplex zu widmen, um diesen in der Differenz zwischen den verschiedenen Parteien zu betrachten. Dies soll zum Thema der Frauenlohn-Debatte in dieser Arbeit geschehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Theorie
- 1.1 Termini
- 1.2 Typologie
- 2. Analyse der Wahlprogramme und der ersten Beratung zum Entgeltgleichheitsgesetz
- 2.1 Die SPD als semantische Erbauer und Erlöser von Problemen
- 2.2 BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN als die Angreifer
- 2.3 Die Linke als die die mehr wollen
- 2.4 Die FDP als die die mehr nichts wollen
- 2.5 Die Union (CDU/CSU) als die Opportunisten
- Fazit
- Literatur und Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die politische Semantik, die im Jahr 2012 im Kontext des Entgeltgleichheitsgesetzes und 2013 im Bundestagswahlkampf im Zusammenhang mit der Frauenlohn-Debatte verwendet wurde. Der Fokus liegt auf der Analyse der Wahlprogramme der verschiedenen Parteien und der ersten Beratung zum Entgeltgleichheitsgesetz im Deutschen Bundestag. Ziel ist es, die semantischen Strategien der Parteien aufzuzeigen und zu analysieren, wie sie die Frauenlohn-Debatte für ihre politische Positionierung nutzen.
- Politische Semantik in der Frauenlohn-Debatte
- Analyse der Wahlprogramme der verschiedenen Parteien
- Untersuchung der ersten Beratung zum Entgeltgleichheitsgesetz im Bundestag
- Semantische Strategien der Parteien zur Positionierung in der Frauenlohn-Debatte
- Vergleich der semantischen Ansätze der Oppositionsparteien und der Regierungsparteien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der politischen Semantik ein und erklärt die Relevanz des Themas im Kontext von Bundestagswahlen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frauenlohn-Debatte und die Analyse der Wahlprogramme der verschiedenen Parteien sowie der ersten Beratung zum Entgeltgleichheitsgesetz im Bundestag.
Das erste Kapitel widmet sich der theoretischen Grundlage der Analyse. Es werden wichtige Termini aus der politischen Semantik, wie "realistische Diktion" und "konkurrierender Sprachgebrauch", erläutert. Anschließend wird die Typologie von Schlussregeln und Topoi nach Martin Wengeler vorgestellt, die als Grundlage für die Analyse der Wahlprogramme dienen.
Das zweite Kapitel analysiert die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien. Es werden die semantischen Strategien der SPD, der Grünen, der Linken, der FDP und der Union (CDU/CSU) im Kontext der Frauenlohn-Debatte untersucht. Die Analyse zeigt, wie die Parteien die Thematik für ihre politische Positionierung und Profilierung nutzen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Frauenlohn-Debatte, politische Semantik, Entgeltgleichheitsgesetz, Wahlprogramme, Bundestagswahl, SPD, Grüne, Linke, FDP, Union, Stigmawort, Fahnenwort, Topoi, Schlussregeln, Bewusstseinskonstitutions-Topos, Euphemismus-Topos, Phantom-Topos, Worthülsen-Topos, Assoziations-Topos, Schlagwort-Topos, semantische Strategien, politische Positionierung.
Häufig gestellte Fragen
Worum ging es in der Frauenlohn-Debatte 2012/2013?
Im Zentrum stand die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen (Gender Pay Gap) und die politische Diskussion um ein Entgeltgleichheitsgesetz.
Was ist politische Semantik?
Es ist die Untersuchung der Sprache, die Politiker nutzen, um Themen zu besetzen, Probleme zu definieren und sich gegenüber Wettbewerbern zu positionieren.
Wie positionierten sich die Parteien beim Thema Frauenlohn?
Die Opposition (SPD, Grüne, Linke) forderte schärfere Gesetze, während die Regierung (Union, FDP) eher auf Freiwilligkeit und wirtschaftliche Argumente setzte.
Was sind "Fahnenwörter" und "Stigmawörter"?
Fahnenwörter sind positiv besetzte Begriffe der eigenen Partei; Stigmawörter sind negativ besetzte Begriffe, mit denen der politische Gegner diskreditiert wird.
Warum sind Wahlprogramme für die Semantikanalyse wichtig?
Wahlprogramme bieten eine hohe Dichte an politischer Sprache, in der Parteien ihre Ziele und Weltbilder in komprimierter Form darstellen.
Welche Rolle spielten "Topoi" in der Debatte?
Topoi sind Denkschemata oder Argumentationsmuster, die genutzt werden, um Forderungen als plausibel oder alternativlos darzustellen.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Markus Stettner (Auteur), 2013, Die Frauenlohn-Debatte 2012 im Kontext des Entgeltgleichheitsgesetzes, und 2013 im Bundestagswahlkampf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265894