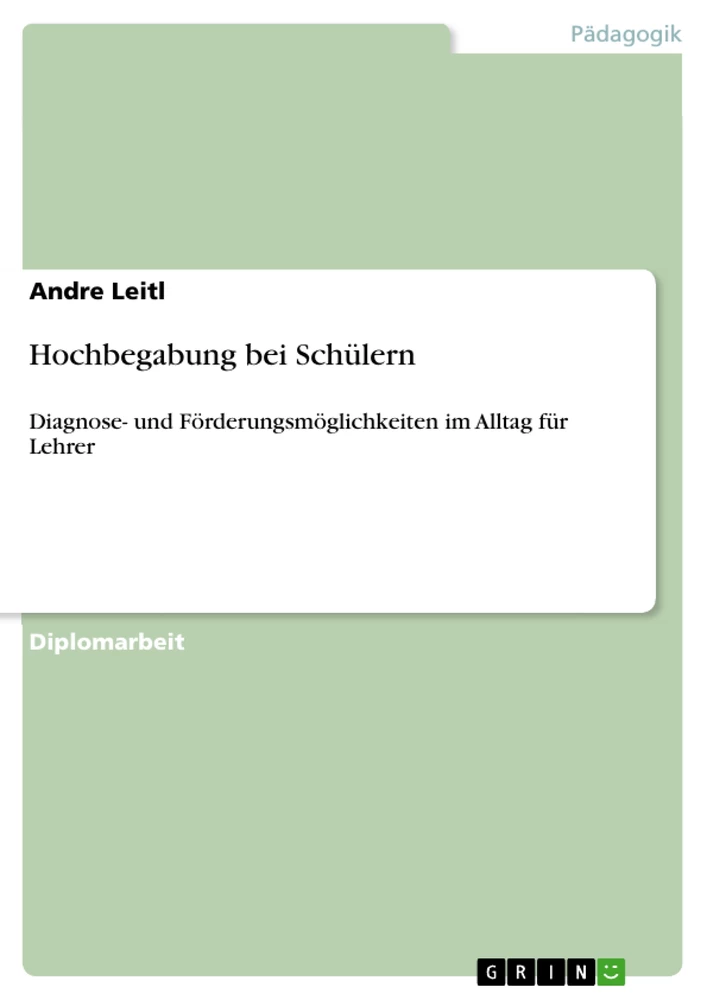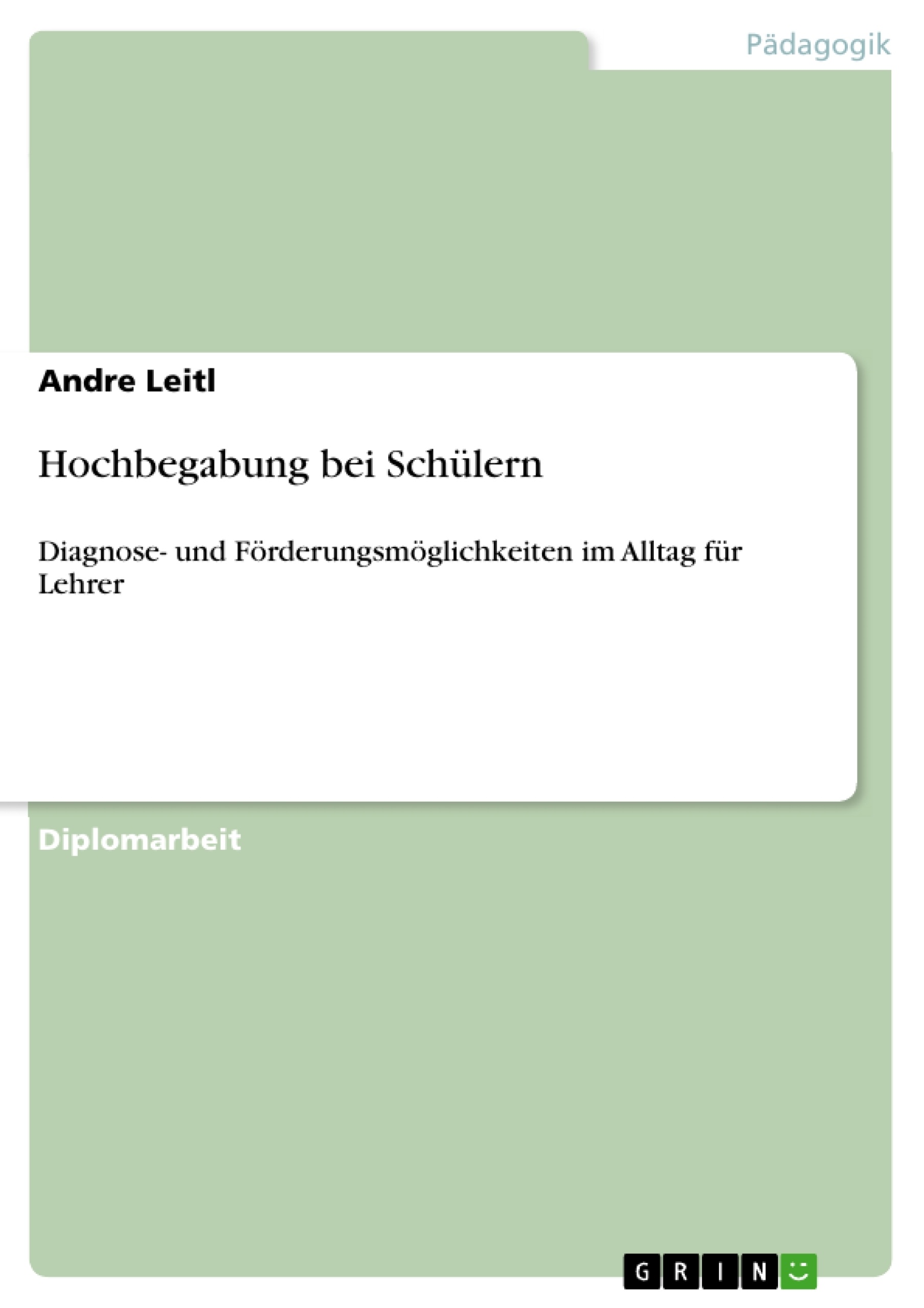„Ein hochbegabter Junge wird endlich eingeschult. Er ist fünf Jahre und neun Monate alt, hat sich bereits im Kindergarten stark gelangweilt. Nun rennt er in die Schule mit großen Erwartungen, was das Lernen betrifft. Er liest fließend Bücher und rechnet wie ein Drittklässler. Nach dem ersten Schultag fragt ihn die Mutter: „Wie war’s? Was habt ihr gemacht?“ Der Fünfjährige erzählt vom Ausmalen eines kopierten Blattes und vom Buchstaben O. Er habe die Lehrerin gefragt, was sie morgen machen würden. Sie antwortete, dass sie dann Wörter mit O kennenlernen würden, und sie hätte auch noch ein schönes Blatt zum Ausmalen. Da habe er zu der Lehrerin gesagt: „Ja schön, aber ich kündige dann“ (Vock, 2004, S. 213).
Man muss schon zweimal das Zitat durchlesen, um das glauben und/oder begreifen zu können. Aber das spiegelt die Realität wider. Eine Realität, die so Unwirklich ist, wie ein Naturforscher das städtische Leben erforscht. Es sind zwei verschiedene Welten, in denen auch die hochbegabten Kinder und Jugendlichen im wahrsten Sinne zu kämpfen haben.
Doch warum brauchen hochbegabte Kinder Hilfe? Die Frage stellt sich Jutta Billhardt (Billhardt, 2013a). Solange Eltern wissen, dass ihr Kind hochbegabt ist und entsprechende Fördermaßnahmen getroffen sind, ist zunächst alles in Ordnung. Leider gibt es andere Fälle, die Jutta Billhardt allgemein beschreibt. Den Anstoß geben die Kinder und Jugendlichen selbst. Durch ihre andere Denkstrukturen, so weiter Jutta Billhardt, können sie sich bereits in Kleinkindzeiten nur im geeigneten Umfeld richtig entfalten.
Hochbegabte Kinder müssen bereits im Kindergartenalter erfahren, dass ihre Fähigkeiten, die sie an den Tag legen, unangebracht sind. Dabei gehen Mädchen und Jungen unterschiedlich mit dieser Situation um: während Mädchen sich zurückhalten und sich möglichst gut an die Umgebung anpassen wollen, welches unter Umständen mit psychosomatische Störungen einhergeht, fallen Jungen durch ihr Verhalten auf (Billhardt, 2013a). Regine Lang sieht eine chronische Unterforderung sowie Langeweile im Kindergarten und in der Schule. Außerdem beschreibt sie, dass hochbegabte Kinder und Jugendliche sich fehl am Platz fühlen (Lang, 2013).
Aus diesem Sachverhalt ergibt sich, dass hochbegabte Kinder qualifizierte Hilfe brauchen. Denn es gibt ein Horrorszenario: die Fehldiagnose. Eltern, Erzieher, Lehrer und sogar Psychologen besitzen wenig Wissen über Hochbegabung und diagnostizieren auf der Basis ihres jeweiligen Kenntnisstands.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Brauchen hochbegabte Kinder Hilfe?
- 2. Grundlagen und Grundüberlegungen zur Hochbegabung
- 2.1. Begrifflichkeit, Definitionen und theoretische Konstrukte von Hochbegabung
- 2.2. Modelle zur Hochbegabung – mehrdimensionale Betrachtungen
- 2.2.1. Das Mehr-Faktoren-Modell von Mönks (1985, 1999, 2012)
- 2.2.2. Das Münchner Hochbegabungsmodell (2001)
- 2.2.3. Das Aktiotop-Modell (2005)
- 2.2.3.1. Handlungen
- 2.2.3.2. Determinanten einer Person
- 2.2.3.2.1. Handlungsrepertoire
- 2.2.3.2.2. Subjektiver Handlungsraum
- 2.2.3.2.3. Ziele
- 2.2.3.3. Umwelt
- 2.3. Einflussfaktoren von Hochbegabung
- 2.3.1. Hochbegabung unter dem Einfluss der Gene
- 2.3.2. Hochbegabung unter dem Einfluss der Umwelt
- 2.3.3. Hochbegabung unter dem Einfluss der Lehrer
- 2.3.4. Resümee
- 3. Hochbegabung in der Schule
- 3.1. Diagnostik
- 3.1.1. Entwicklung und daraus resultierende Charakteristika der Hochbegabten
- 3.1.2. Diagnostik der hochbegabten Underachiever
- 3.1.3. Tests für hochbegabte Kinder und Jugendliche
- 3.1.3.1. Komplexes Problemlösen
- 3.1.3.2. Lerntests
- 3.1.3.3. Kreativitätstest
- 3.1.3.4. Erfassung der Arbeitsgedächtniskapazität
- 3.1.3.5. Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder und Jugendliche
- 3.1.4. Fazit
- 3.2. Förderung
- 3.2.1. Fördermaßnahmen durch das Schulsystem
- 3.2.1.1. Akzeleration und Enrichment
- 3.2.1.2. Förderung im Schulunterricht
- 3.2.1.2.1. Förderung durch Differenzierung
- 3.2.1.2.2. Motivationsförderung
- 3.2.2. Spezialfall: Förderung der hochbegabten Underachiever
- 4. Diskussion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Hochbegabung bei Schülern und untersucht Diagnose- und Fördermöglichkeiten im schulischen Alltag. Ziel ist es, Lehrkräften ein umfassendes Verständnis des Themas zu vermitteln und praxisnahe Hilfestellungen zur Identifikation und Förderung hochbegabter Kinder zu bieten.
- Definition und Modelle von Hochbegabung
- Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Hochbegabung (Gene, Umwelt, Lehrer)
- Diagnostik von Hochbegabung, insbesondere bei Underachievern
- Fördermaßnahmen im Schulsystem (Akzeleration, Enrichment, Differenzierung)
- Spezifische Förderansätze für hochbegabte Underachiever
Zusammenfassung der Kapitel
1. Brauchen hochbegabte Kinder Hilfe?: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und hinterfragt die Notwendigkeit von spezifischen Fördermaßnahmen für hochbegabte Kinder. Es werden die Herausforderungen und Schwierigkeiten beleuchtet, denen hochbegabte Schüler im regulären Schulsystem begegnen können, und es wird die Notwendigkeit einer individuellen Betrachtungsweise betont. Die Frage nach der Notwendigkeit von Hilfestellungen wird durch die Darstellung potenzieller Probleme und Herausforderungen fundiert begründet.
2. Grundlagen und Grundüberlegungen zur Hochbegabung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen des Themas Hochbegabung dar. Es definiert den Begriff der Hochbegabung, diskutiert verschiedene Modelle und Konstrukte (Mehr-Faktoren-Modell von Mönks, Münchner Hochbegabungsmodell, Aktiotop-Modell) und analysiert die verschiedenen Perspektiven auf Hochbegabung. Die Kapitelteile beleuchten die Komplexität des Konstrukts und betonen den Einfluss verschiedener Faktoren, wie z.B. genetische Anlagen, Umweltbedingungen und die Rolle der Lehrkräfte.
3. Hochbegabung in der Schule: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Umsetzung von Diagnose- und Fördermaßnahmen im Schulkontext. Es beschreibt verschiedene diagnostische Verfahren zur Erkennung von Hochbegabung, einschließlich der Herausforderungen bei der Diagnose von Underachievern. Im zweiten Teil werden verschiedene Fördermöglichkeiten wie Akzeleration, Enrichment und differenzierter Unterricht detailliert dargestellt und bewertet. Die verschiedenen Aspekte der Förderung werden kritisch beleuchtet und miteinander verglichen. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung im schulischen Alltag.
Schlüsselwörter
Hochbegabung, Diagnostik, Förderung, Underachiever, Modelle der Hochbegabung, Akzeleration, Enrichment, Differenzierung, Schulsystem, Lehrerrolle, Gene, Umwelt, Intelligenz, Kreativität, Talent.
Häufig gestellte Fragen zu "Hochbegabung bei Schülern: Diagnose und Förderung im Schulalltag"
Was ist der Inhalt des Buches "Hochbegabung bei Schülern: Diagnose und Förderung im Schulalltag"?
Das Buch behandelt umfassend das Thema Hochbegabung bei Schülern. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Diagnose und Förderung hochbegabter Kinder im schulischen Kontext, einschließlich der Herausforderungen bei Underachievern.
Welche Modelle der Hochbegabung werden im Buch vorgestellt?
Das Buch präsentiert verschiedene Modelle der Hochbegabung, darunter das Mehr-Faktoren-Modell von Mönks, das Münchner Hochbegabungsmodell und das Aktiotop-Modell. Diese Modelle werden detailliert beschrieben und verglichen, um die vielschichtigen Aspekte von Hochbegabung zu beleuchten.
Welche Einflussfaktoren auf die Hochbegabung werden diskutiert?
Der Einfluss von genetischen Anlagen, Umweltfaktoren und der Rolle der Lehrkräfte auf die Entwicklung von Hochbegabung wird ausführlich analysiert. Das Buch betont die Interaktion dieser Faktoren und deren Bedeutung für die Förderung hochbegabter Kinder.
Wie wird die Diagnostik von Hochbegabung im Buch behandelt?
Das Buch beschreibt verschiedene diagnostische Verfahren zur Erkennung von Hochbegabung, mit besonderem Augenmerk auf die Herausforderungen bei der Diagnose von Underachievern (hochbegabte Schüler, die ihre Fähigkeiten nicht vollumfänglich nutzen). Es werden verschiedene Tests und Methoden vorgestellt, wie z.B. Tests zum komplexen Problemlösen, Lerntests, Kreativitätstests und der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder und Jugendliche.
Welche Fördermaßnahmen für hochbegabte Schüler werden im Buch vorgestellt?
Das Buch erläutert verschiedene Fördermaßnahmen im Schulsystem, darunter Akzeleration (Beschleunigung des Lernfortschritts), Enrichment (Anreicherung des Lernstoffes) und differenzierter Unterricht. Es werden spezifische Förderansätze für hochbegabte Underachiever behandelt und die praktische Umsetzung im schulischen Alltag diskutiert.
Wer profitiert von der Lektüre dieses Buches?
Das Buch richtet sich vor allem an Lehrkräfte, die ein umfassendes Verständnis von Hochbegabung entwickeln und praxisnahe Hilfestellungen zur Identifikation und Förderung hochbegabter Kinder erhalten möchten. Es ist auch relevant für Eltern, Schulpsychologen und alle anderen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Buches am besten?
Schlüsselwörter sind: Hochbegabung, Diagnostik, Förderung, Underachiever, Modelle der Hochbegabung, Akzeleration, Enrichment, Differenzierung, Schulsystem, Lehrerrolle, Gene, Umwelt, Intelligenz, Kreativität, Talent.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, das Buch enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die Kernaussagen und Inhalte jedes Kapitels prägnant zusammenfasst.
- Quote paper
- Andre Leitl (Author), 2013, Hochbegabung bei Schülern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266047