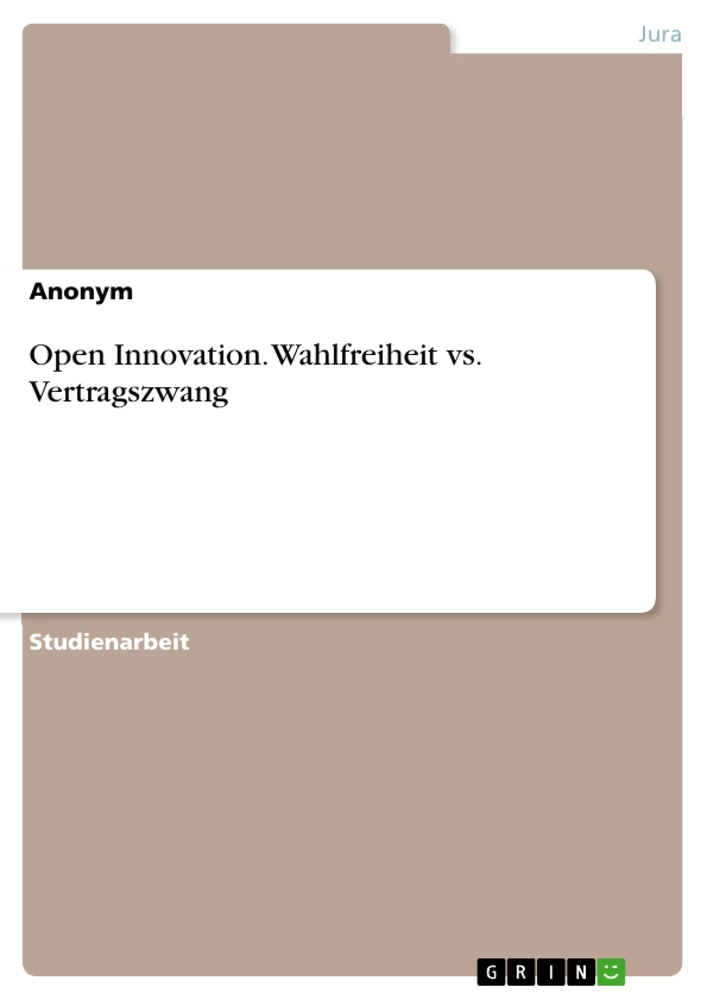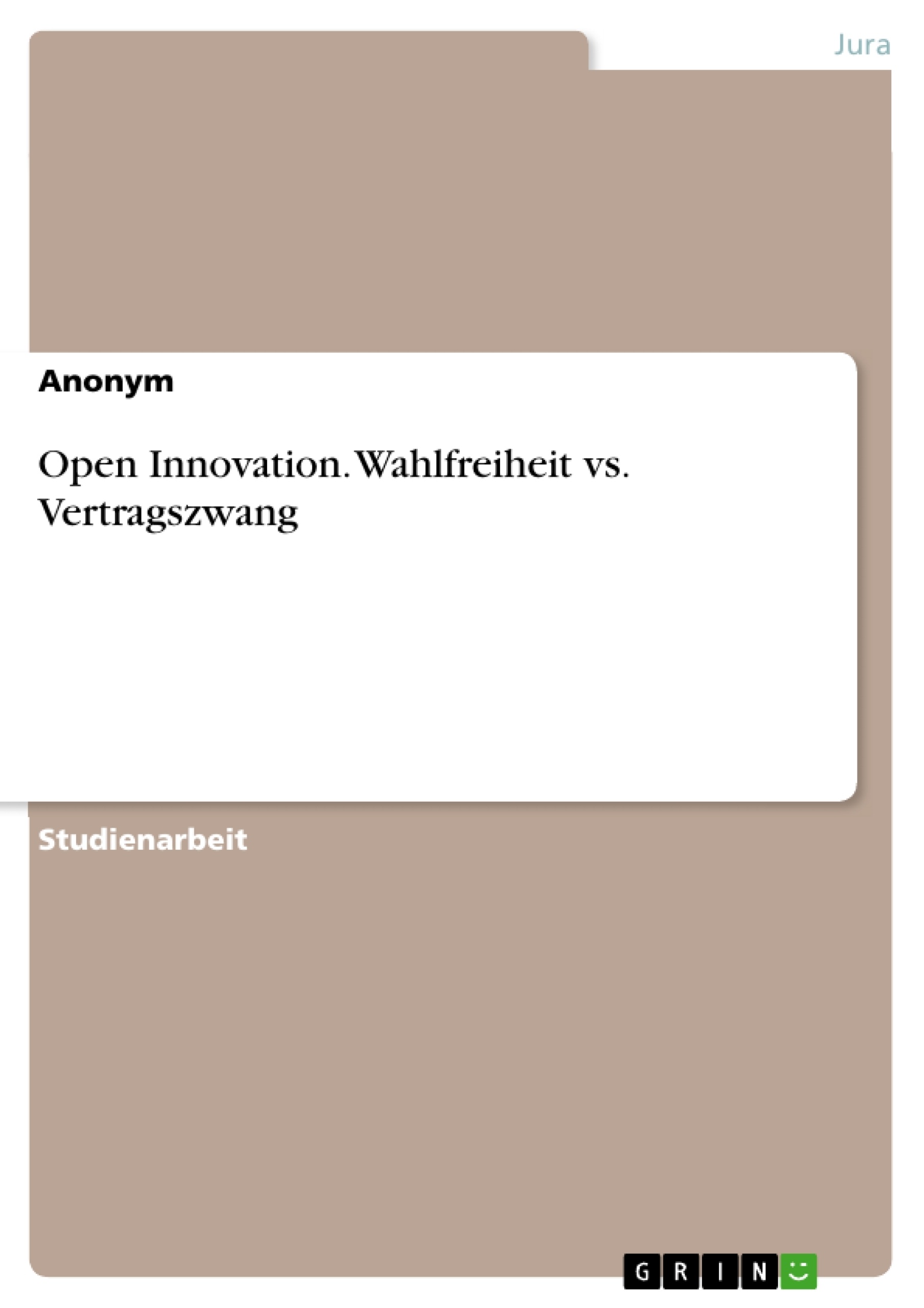Seit Henry W. Chesbrough sein Werk „Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology“ veröffentlichte und damit den Begriff „Open Innovation“ prägte, wird zunehmend über einen Umschwung im Innovationsmanagement diskutiert.
Der Ansatz von „Open Innovation“ beschreibt demnach den aktiven und gezielten Einbezug der Außenwelt zur Verbesserung des eigenen Innovationspotenzials durch die Öffnung der Unternehmensgrenzen. Die strategische Nutzung der Außenwelt im Sinne der Innovationssteigerung lässt sich dabei auf drei Kernprozesse zurückführen:
Während beim Outside-In-Prozess die Internalisierung und die Verarbeitung von externem Wissen in die eigene Innovationsarbeit im Vordergrund steht. Beschreibt im Gegenzug der Inside-Out-Prozess die Ausgliederung und Verwertung internen Wissens außerhalb des Unternehmens.
Der Coupled-Prozess umfasst schließlich Innovationspartnerschaften und Ideennetzwerke, welche sich durch den Austausch und den gegenseitige Nutzen von eingebrachtem Wissen im Hinblick auf die Forschung und Entwicklung (F&E) auszeichnen.
Das Modell der offenen Innovation spiegelt dabei sinnbildlich den Wandel von der Industrie- zur Kommunikations- und Wissensgesellschaft wider und trägt zugleich den veränderten Anforderungen an neue Produkte, deren Entwicklung und der Ideenfindung Rechnung.
In der Praxis gestaltet sich die Realisierung der Innovationsöffnung jedoch nicht selten als problematisch. Neben strategischen und rechtlichen Überlegungen um die Öffnung des eigenen Unternehmens, muss oftmals geistiges Eigentum und externes Wissen erst mühsam und zwanghaft zugänglich gemacht werden, um es verwerten zu können.
Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, wie ein offeneres Innovationsmanagement sinnvoll umgesetzt werden kann und in welchem Rahmen der Zugriff auf externes geistiges Eigentum ggf. zwanghaft durchgesetzt werden kann.
Der erste Teil dieser Arbeit beleuchtet die betriebswirtschaftlichen Motive hinter „Open Innovation“, sowie die Risiken, die mit der Öffnung des F&E-Bereichs einhergehen. Neben Grenzen, werden sowohl unternehmensstrategische als auch rechtliche Schranken herausgearbeitet. Abschließend werden Lösungen vorgestellt, um den aufgezeigten Gefahren entgegenzutreten.
Der zweite Teil widmet sich umfassend der Systematik der Zwangslizensierung von geistigem Eigentum. Unter Berücksichtigung bisheriger Rechtsprechung und geltenden Rechts entsteht so ein Überblick über die Mechanismen und Möglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Einleitung
- Erster Teil — Der „Open Innovation"-Ansatz als bewusste Offenheit und Kooperation „
- A. Begriffsdefinition „Open Innovation"
- 1. Allgemeine Definition
- 2. „Open Innovation" und Schutzrechte
- a) Urheberrecht
- b) Patentrecht
- B. Chancen und Möglichkeiten
- 1. Informationsaustausch „C2B"
- 2. Wissenstransfer „B2B"
- a) „Transaction Networks "
- b) Co-Creation Networks
- 3. Gesellschaftlicher Nutzen
- C. Risiken und Gefahren
- 1. Technologietransfers und Wissensaustausch „transaction networks"
- a) Wirtschaftliches Risiko
- b) Unvorhergesehene Ereignisse
- c) Kartellrechtliche Schranken
- 2. Gemeinsam betriebene Forschung und Entwicklung — die „co-creation"
- a) „Co-creation" in Unternehmensverbänden
- a) Schutz des generierten Wissens
- (1) Erweiterung der „grace period"
- (2) Ausnahmen für Patentverletzungen
- (3) Privatrechtliche Lösung — „Private Ordering "
- b) „Co-creation" in „Open Innovation Communities"
- a) Die Defensivpublikation
- b) Friedenspatent
- c) Patentverteidigungspools
- d) Defensivpatent
- D. Zusammenfassung
- Zweiter Teil — Die Zwanslizenz as geeignetes Mittel zur Rechtskorrektur?
- A. Allgemeines
- B. Ausgleich auf drei Ebenen
- 1. Die Ausgestaltung der Schutzrechte — Ausgleich auf erster Stufe?
- a) Das Patentrecht
- b) Das Urheberrecht
- 2. Die Schranken der Schutzrechte — Ausgleich auf zweiter Stufe?
- a) Das Patentrecht — 2nd Level
- a) Forschungsprivileg - 11 Abs. 2 PatG
- b) Zwangslizenz - 24 Abs. 2 PatG
- b) Das Urheberrecht — 2nd Level
- 3. Das Kartellrecht als Schranke — Ausgleich auf dritter Stufe?
- a) Das Patentrecht — 3rd Level
- a) Kartellrechtlicher Anspruch auf eine Zwangsliz enz aus An. 102 AEUV
- b) Kartellrechtlicher Anspruch auf eine Zwangsliz enz aus 19, 20 GWB
- c) Die Rechtsfo Igenanordnung de s S 3 3 GWB
- b) Das Urheberrecht — 3rd L evel
- c) Bewertung
- C. Ausblick
- D. Zusammenfassung
- Zusammenfassende Schlussbetrachtung
- Das Konzept der „Open Innovation" und seine Anwendung in der Praxis
- Die Bedeutung von Schutzrechten im Kontext von „Open Innovation"
- Die Chancen und Risiken des Wissenstransfers und der Zusammenarbeit im Innovationsprozess
- Die Rolle der Zwangslizenz als Instrument zur Rechtskorrektur im Bereich des geistigen Eigentums
- Die rechtlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen der „Open Innovation" im Hinblick auf die Gestaltung eines nachhaltigen Innovationsprozesses
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem „Open Innovation"-Ansatz, der den Einbezug der Außenwelt zur Verbesserung des eigenen Innovationspotenzials durch die Öffnung der Unternehmensgrenzen beschreibt. Sie untersucht die Chancen und Risiken dieses Ansatzes, insbesondere im Hinblick auf den Schutz geistigen Eigentums und den Zugriff auf externes Wissen. Die Arbeit analysiert dabei die verschiedenen Formen der „Open Innovation", wie den Informationsaustausch zwischen Unternehmen und Kunden („C2B"), den Wissenstransfer zwischen Unternehmen („B2B") sowie die gemeinsame Forschung und Entwicklung („co-creation"). Sie beleuchtet die Herausforderungen im Umgang mit geistigen Eigentumsrechten im Kontext von „Open Innovation" und analysiert die Rolle der Zwangslizenz als Instrument zur Rechtskorrektur.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit beleuchtet den „Open Innovation"-Ansatz als bewusste Offenheit und Kooperation im Innovationsprozess. Er definiert den Begriff „Open Innovation" und analysiert die Chancen und Möglichkeiten, die sich aus der Öffnung von Unternehmensgrenzen ergeben. Dabei werden verschiedene Formen des Wissenstransfers und der Zusammenarbeit im Innovationsprozess vorgestellt und die Bedeutung von Schutzrechten im Kontext von „Open Innovation" beleuchtet. Der erste Teil thematisiert auch die Risiken und Gefahren, die mit der Öffnung des F&E-Bereichs einhergehen, wie beispielsweise das wirtschaftliche Risiko, unvorhergesehene Ereignisse und kartellrechtliche Schranken.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der Zwangslizenz als geeignetes Mittel zur Rechtskorrektur. Er untersucht die Systematik der Zwangslizensierung von geistigem Eigentum und analysiert die verschiedenen Anspruchsgrundlagen für eine Zwangslizenz im Patent- und Urheberrecht. Dabei werden die kartellrechtlichen Aspekte der Zwangslizenz beleuchtet und die Bedeutung des „technischen Fortschritts von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung" für die Erteilung einer Zwangslizenz untersucht. Der zweite Teil beleuchtet auch die Auswirkungen des neuen EU-Patents auf die Erteilung von Zwangslizenzen und die Bedeutung der „Open Innovation" für die Gestaltung eines nachhaltigen Innovationsprozesses.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Open Innovation, Innovationsprozess, Wissenstransfer, geistiges Eigentum, Schutzrechte, Urheberrecht, Patentrecht, Zwangslizenz, Kartellrecht, Abhängigkeitslizenz, „co-creation", „transaction networks", „Open Innovation Communities", gesellschaftlicher Nutzen, wirtschaftliches Risiko, Privatautonomie, Forschungsprivileg, Defensivpublikation, Friedenspatent, Patentverteidigungspools, Defensivpatent, EU-Patent, Innovationkultur.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Konzept „Open Innovation“?
Open Innovation beschreibt die strategische Öffnung von Unternehmensgrenzen, um externes Wissen für die eigene Innovationsarbeit zu nutzen (Outside-In) oder internes Wissen nach außen zu verwerten (Inside-Out).
Welche Rolle spielen Schutzrechte wie Patente bei Open Innovation?
Schutzrechte sind zentral, da sie den Rahmen für Kooperationen bilden. Die Arbeit untersucht, wie geistiges Eigentum geschützt werden kann, während gleichzeitig Wissen geteilt wird.
Was ist eine Zwangslizenz im Patentrecht?
Eine Zwangslizenz ermöglicht den Zugriff auf geschütztes geistiges Eigentum gegen den Willen des Inhabers, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt oder kartellrechtlich geboten ist.
Welche Risiken birgt die Öffnung des F&E-Bereichs?
Risiken umfassen den ungewollten Abfluss von Kernwissen (Wissensverlust), wirtschaftliche Abhängigkeiten und kartellrechtliche Schranken bei Kooperationen.
Was versteht man unter „Co-Creation“?
Co-Creation bezeichnet die gemeinsame Forschung und Entwicklung in Netzwerken oder Communities, bei der Partner ihr Wissen zum gegenseitigen Nutzen bündeln.
Wie hilft das Kartellrecht bei der Durchsetzung von Innovationen?
Das Kartellrecht kann als Schranke gegen den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen dienen und unter bestimmten Bedingungen Ansprüche auf Zwangslizenzen begründen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2013, Open Innovation. Wahlfreiheit vs. Vertragszwang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266092