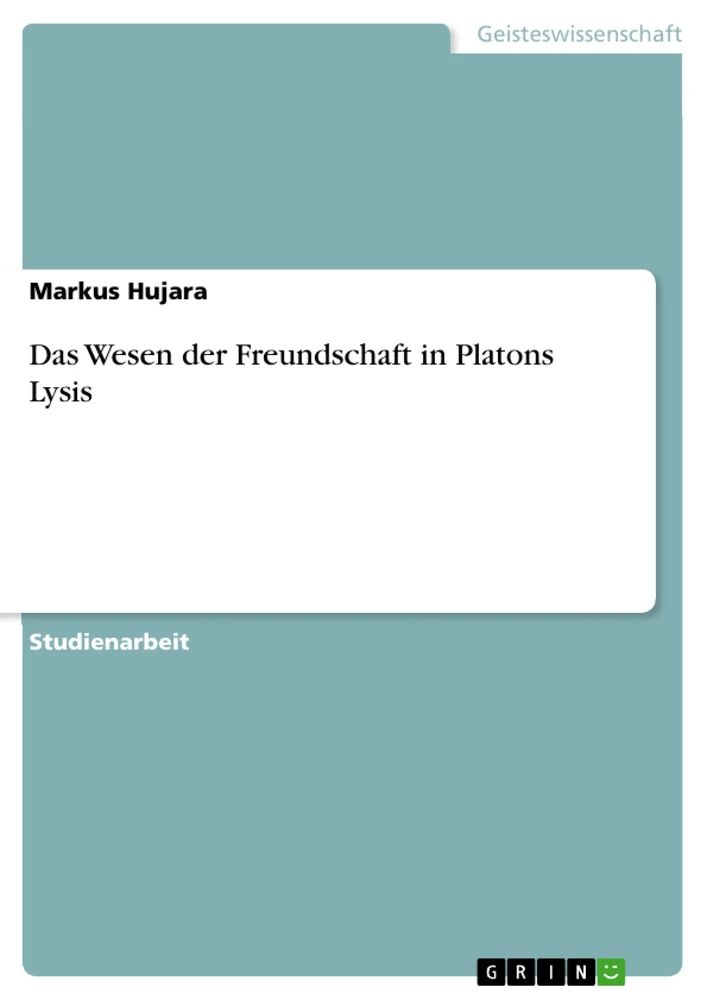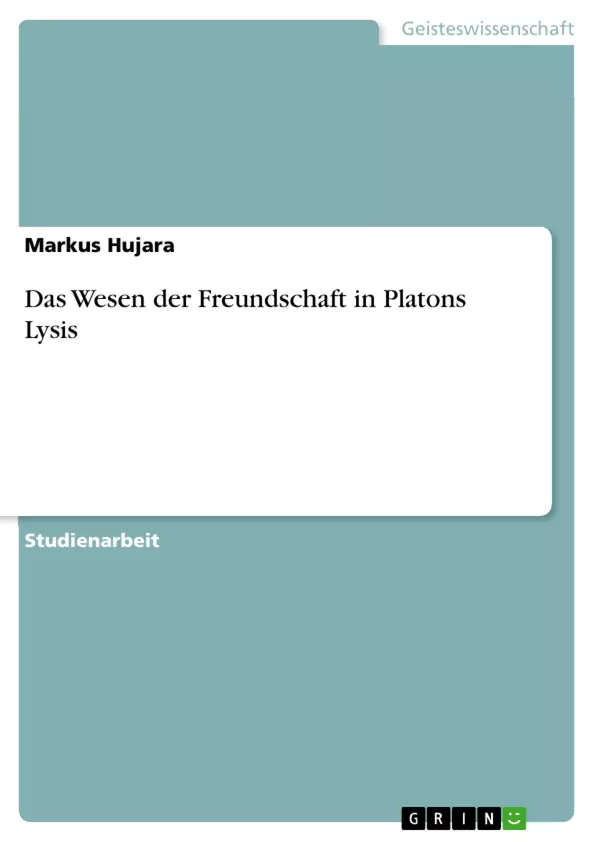Diese Arbeit hat zum Ziel, eine detaillierte Interpretation des Dialoges Lysis im Hinblick auf das von Platon entwickelte Modell vom Wesen der Freundschaft darzulegen. In der Einführung wird ein kurzer Überblick über das Geschehen in dem Dialog geboten. Anschließend wird erläutert, warum bei der Lektüre des Lysis streng zwischen der Ebene des Dialoges und der Ebene der Sachlichkeit unterschieden werden muss. Hierbei soll auf eine mögliche Lösung der Schlussaporie hingewiesen werden. Zur weiteren Vorbereitung werden die zwei verschiedenen Bedeutungen von philia dargelegt.
Zu Beginn des Hauptteils soll Platons Fragestellung im Hinblick darauf, was Freundschaft begründet und erhält, erläutert werden. Anhand des Primärtextes, eigenen Überlegungen und Sekundärliteratur von Rang wird dann das Wesen der Freundschaft in Verbindung mit der Bedeutung der Begriffe to agathon, to prõton philon und to oikeion interpretiert. In der Folge wird ein sachlicher Ausweg aus der Schlussaporie aufgezeigt. Schließlich soll am Beispiel des Hippothales gezeigt werden, dass falsches Begehren nicht zu wahrer Freundschaft führen kann.
In den Ausblicken wird Platons Freundschaftsmodell mit den Erkenntnissen der Psychologie und anderen Theorien der empirischen Wissenschaften auf diesem Gebiet verglichen. Hierbei soll auf Platons besondere These der Selbstlosigkeit hingewiesen werden, die Platons Lysis auch für den Leser des 21.Jahrhunderts im Hinblick auf das Wesen der Freundschaft zur interessanten und wichtigen Lektüre macht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- I. EINFÜHRUNG
- I. 1. Aus dem Inhalt
- I. 2. Die Aporie und der mühsame Weg zur Hintertür
- I. 3. Die Mehrdeutigkeit des Wortes philia
- II. DAS WESEN DER FREUNDSCHAFT IM DIALOG LYSIS
- II. 1. Platons Fragestellung
- II. 2. Auf der Suche nach dem Wesen der Freundschaft
- II. 3. Durch die Hintertür - ein Ausweg aus der Aporie
- II. 4. Hippothales - ein Begehren fern von wahrer Freundschaft
- III. AUSBLICKE
- III.1. Platons Freundschaftsmodell im Vergleich mit der Psychologie
- III. 2. Lysis heute – ein Plädoyer wider den Egoismus
- Schlussreflexion
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Platons Dialog „Lysis" mit dem Ziel, Platons Modell vom Wesen der Freundschaft zu ergründen. Die Arbeit beleuchtet die komplexe Frage, was Freundschaft begründet und erhält, und untersucht, wie Platons Modell sich von modernen psychologischen Theorien unterscheidet.
- Das Wesen der Freundschaft und ihre verschiedenen Ausprägungen
- Platons Fragestellung im Dialog „Lysis"
- Die Rolle von Begehren und Selbstlosigkeit in Freundschaftsbeziehungen
- Platons Freundschaftsmodell im Vergleich zu modernen Theorien
- Die Bedeutung von Platons Lysis für das Verständnis von Freundschaft in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über den Inhalt des Dialogs „Lysis", wobei sie die Aporie als eine Schlüsselfunktion hervorhebt. Des Weiteren werden die verschiedenen Bedeutungen des Wortes „philia" erläutert. Der Hauptteil befasst sich mit Platons Fragestellung und untersucht das Wesen der Freundschaft anhand des Primärtextes und sekundärer Literatur. Besonderes Augenmerk wird auf die Begriffe „to agathon", „to proton philon" und „to oikeion" gelegt. Die Arbeit skizziert einen möglichen Ausweg aus der Schlussaporie und verdeutlicht am Beispiel des Hippothales, wie falsches Begehren zu keiner wahren Freundschaft führt. Der Ausblick vergleicht Platons Freundschaftsmodell mit psychologischen Erkenntnissen und betont die Besonderheit von Platons These der Selbstlosigkeit.
Schlüsselwörter
Platon, Lysis, Freundschaft, philia, to agathon, to proton philon, to oikeion, Aporie, Selbstlosigkeit, Begehren, Psychologie, Egoismus.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Platons Dialog „Lysis“?
Der Dialog untersucht das Wesen der Freundschaft (philia) und versucht zu klären, was Menschen dazu bewegt, Freunde zu werden und diese Beziehung aufrechtzuerhalten.
Was bedeutet "Aporie" im Kontext dieses Dialogs?
Aporie bezeichnet die Ratlosigkeit am Ende des Dialogs, da keine abschließende, allgemeingültige Definition von Freundschaft gefunden wird – die Arbeit zeigt jedoch einen "Ausweg aus der Hintertür" auf.
Was sind "to agathon" und "to proton philon"?
Dies sind zentrale Begriffe der platonischen Theorie: "to agathon" steht für das Gute und "to proton philon" für das erste, ursprüngliche Freundliche, das Ziel allen Begehrens ist.
Wie unterscheidet sich Platons Modell von modernen psychologischen Theorien?
Platon betont eine Form der Selbstlosigkeit und das Streben nach dem Guten, während moderne Theorien oft eher auf egoistischen Motiven oder gegenseitigem Nutzen basieren.
Warum ist der Lysis auch heute noch lesenswert?
Die Arbeit versteht den Dialog als Plädoyer gegen den Egoismus und als wichtige Reflexion darüber, was wahre zwischenmenschliche Bindungen im Kern ausmacht.
- Citation du texte
- Markus Hujara (Auteur), 2003, Das Wesen der Freundschaft in Platons Lysis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26624