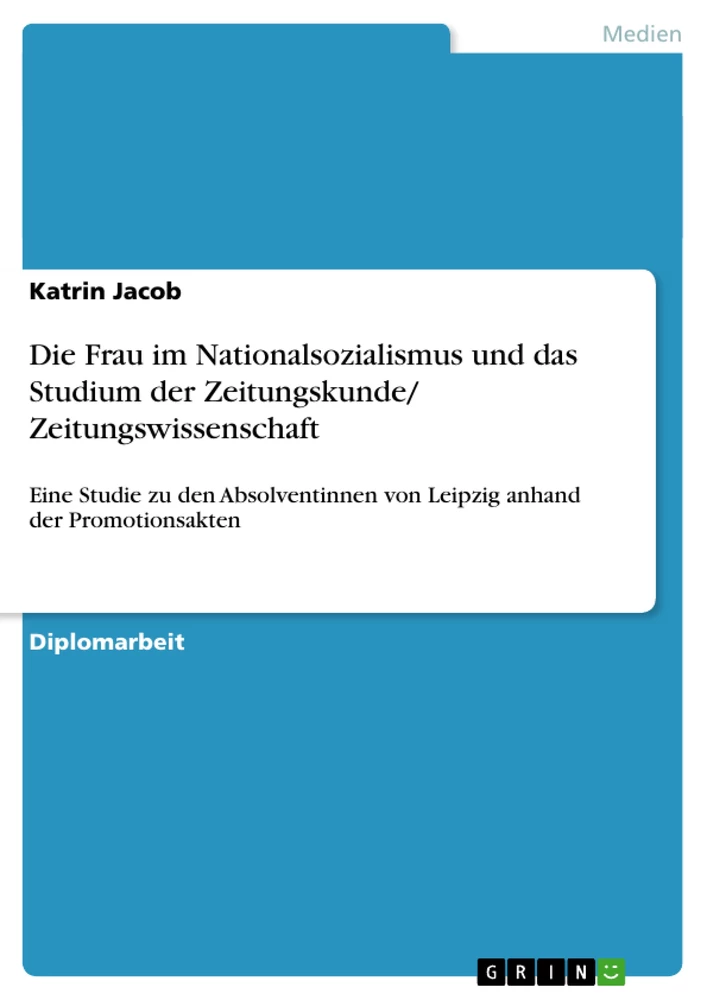Aus der Einleitung:
(...)
Anfang der 80er Jahre rückte in der feministischen und historischen Frauenforschung die Thematik der Frau im Nationalsozialismus in den Vordergrund. Ausgehend von den Quellenstudien Annette Kuhns und Valentine Rothes wurden Frauen zuerst einseitig als Opfer eines patriarchalen, extrem frauen- und menschenfeindlichen Männerregimes betrachtet. Oder die Rolle der Frau in der Widerstandsbewegung untersucht.
Ende der 80er Jahre zerbricht Angelika Ebbinghaus mit ihren Ergebnissen über der aktiven Rolle der Frauen NS-Biopolitik dieses Korsett. „Wenn Frauen reaktionäre Ziele verfolgten, sind wir es gewohnt, stets das männliche Geschlecht und dessen Motive dafür verantwortlich zu machen. Eine engagierte Frauenforschung sollte der Frage nachgehen, warum Frauen, die sich den Idealen der ersten Frauenbewegung verpflichtet fühlten, sich so bruchlos in die sexistische und rassistische Fürsorgepolitik des Nationalsozialismus einfügten, ohne nennenswerten Widerstand zu leisten.”
Bis Ende der 80er Jahre entschuldigte die bundesdeutsche Frauenforschung „zumindest partiell” die Beteiligung von Frauen am Nationalsozialismus.
(...)
Während meiner ersten Recherchen stellte sich heraus, das sich die Zahl der Absolventinnen am damaligen Institut für Zeitungswissenschaft kontinuierlich erhöhte. Eine erste Überraschung für mich. Ich hatte nach der ersten Literatursichtung angenommen, eine rückläufige Tendenz zu finden.
Dann stieß ich auf die Anfang der 60er Jahre von Ralf Dahrendorf entwickelte These von der „Modernisierung wider Willen”.
(...)
Ich werde zeigen, dass die Absolventinnen des Instituts für Zeitungskunde keine Opfer waren. Sie waren vielmehr Mitläuferinnen und Täterinnen, in Form „geistiger Brandstifterinnen”. Sie haben sich zu Schriftleiterinnen ausbilden lassen, in diesem Beruf gearbeitet und die nationalsozialistische Ideologie mit verbreitet. Auch während des Studium haben sie aktiv das nationalsozialistische System unterstützt. Selbst wenn sie nur Mitläuferinnen waren, so standen sie der nationalsozialistischen Ideologie nahe und arrangierten sich mit dem System.
Meine Diplomarbeit soll andere Studentinnen und Interessenten auch über einen Lebensabschnitt von Frauen informieren und zeigen, wie Männer versucht haben, Frauen in die von ihnen gebauten Schranken zu verweisen.
(...)
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis und Erklärung
- 1 Einleitung
- 2 Das ideologische Frauenbild im Nationalsozialismus
- 2.1 Die Entwicklung der Ideologie und die Herleitung des Wesens und der Aufgaben der Frau
- 2.2 Die „NS-Biopolitik" und der Mutterkult
- 2.3 Die Erwerbstätigkeit von Frauen
- 2.4 Frauen im Journalismus
- 2.4.1 Die Entwicklung der Stellung des Schriftleiterberufs
- 2.4.2 Der Beruf der Schriftleiterin
- 2.4.3 „NS Frauen-Warte" — Schriftleiterinnen im Dienst des „Mutterkultes"
- 3 Das Frauenstudium an deutschen Universitäten von 1933-1945
- 3.1 Zur Situation an den deutschen Universitäten vor und nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten
- 3.2 Das Frauenstudium an den deutschen Universitäten dieser Zeit
- 3.3 Die Situation an der Universität Leipzig
- 4 Biographische Analyse
- 4.1 Methoden und Kriterien der Auswertung
- 4.2 Die Ergebnisse
- 5 Sprachlich-qualitative Analyse der Dissertationsthemen und der ausgewählten Dissertationen
- 5.1 Vergleich der Themenwahl
- 5.1.1 Methoden und Kriterien
- 5.1.2 Die Ergebnisse
- 5.2 Vergleich der Dissertationen
- 5.2.1 Methoden und Kriterien
- 5.2.2 Die Ergebnisse
- 5221 Jahrgang 1935/36
- 5222 Jahrgang 1940/41
- 5223 Jahrgang 1944/45
- 5.1 Vergleich der Themenwahl
- 6 Auswertung und Schlussfolgerungen
- Anhang
- Tabelle Absolute Zahlen und Prozentwerte der Auszählung der Dissertationsthemen
- Tabelle Arbeit vor dem Studium
- Tabelle Arbeit während des Studiums
- Tabelle der Promovenden, Promotionsdaten, Dissertationsthemen und der Prüfungsfächer
- Quellenverzeichnis
- Quellen und Dokumentationen
- Zeitungen
- Literatur
- Zeitschriften und Zeitungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Rolle von Frauen im Nationalsozialismus am Beispiel der Absolventinnen des Instituts für Zeitungswissenschaft an der Universität Leipzig. Die Arbeit analysiert die Biographien der Absolventinnen, die Dissertationsthemen und die sprachliche Entwicklung der Dissertationen im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie und Politik.
- Das ideologische Frauenbild im Nationalsozialismus
- Die „NS-Biopolitik" und der Mutterkult
- Das Frauenstudium an deutschen Universitäten
- Die Entwicklung des Schriftleiterberufs
- Der Einfluss der nationalsozialistischen Propaganda auf die Sprache und Argumentation der Dissertationen
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beleuchtet das nationalsozialistische Frauenbild, das sich auf eine lange patriarchale Tradition stützte und die Frau in die Rolle der Mutter und Hausfrau zurückdrängen wollte. Die „NS-Biopolitik" zielte auf die Kontrolle über den Körper der Frau, die Unterdrückung ihrer Selbstbestimmungsrechte und die Förderung der Geburtenrate. Die Erwerbstätigkeit von Frauen wurde als Bedrohung für die traditionelle Familienstruktur angesehen und durch verschiedene Maßnahmen eingeschränkt. Das Kapitel analysiert die Entwicklung des Schriftleiterberufs und die Rolle von Frauen im Journalismus, insbesondere in der Zeitschrift „NS Frauen-Warte".
Das dritte Kapitel beleuchtet die Situation der deutschen Universitäten vor und nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Die Gleichschaltung der Universitäten führte zur Entlassung jüdischer Professoren und zur Unterordnung der Wissenschaft unter die nationalsozialistische Ideologie. Das Frauenstudium wurde durch einen Numerus clausus eingeschränkt und die Studentinnen wurden in Studienrichtungen gelenkt, die ihre „weiblichen Tugenden" förderten. Das Kapitel beschreibt die Situation an der Universität Leipzig, die sich frühzeitig und widerstandslos in das nationalsozialistische Herrschaftssystem einfügte.
Das vierte Kapitel analysiert die Biographien der Absolventinnen und Absolventen des Instituts für Zeitungswissenschaft an der Universität Leipzig. Die Ergebnisse zeigen, dass die Frauen aus den gleichen Schichten wie die Männer stammten und einen ähnlichen Bildungsstand besaßen. Die Arbeit untersucht die Familienstände, die beruflichen Tätigkeiten vor und während des Studiums, die Mitgliedschaften in politischen Organisationen sowie die finanzielle Unterstützung, die die Promovenden von der Universität erhielten.
Das fünfte Kapitel analysiert die Dissertationsthemen und die Sprache der Dissertationen. Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen in gleichem Maße zu politischen Themen promovierten wie Männer, aber nicht stärker zu diesen Themen. Die Arbeit untersucht die Verwendung von nationalsozialistischen Sprachstereotypen und Antisemitismen in den Dissertationen und stellt fest, dass sich die Sprache der Absolventinnen im Laufe der Zeit an die Männersprache anpasst.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Frauenbild im Nationalsozialismus, die „NS-Biopolitik", den Mutterkult, das Frauenstudium, die Universität Leipzig, den Schriftleiterberuf, die nationalsozialistische Propaganda, die Sprache der Dissertationen und den Antisemitismus.
Häufig gestellte Fragen
Wie war das ideale Frauenbild im Nationalsozialismus definiert?
Frauen wurden primär in der Rolle als Mutter und Hausfrau gesehen, zuständig für die biologische Erhaltung der "Volksgemeinschaft".
Welche Rolle spielten Absolventinnen der Zeitungswissenschaft in der NS-Zeit?
Viele arbeiteten als Schriftleiterinnen und trugen aktiv zur Verbreitung der nationalsozialistischen Ideologie und Propaganda bei.
Wurde das Frauenstudium im Nationalsozialismus eingeschränkt?
Ja, durch einen Numerus clausus und die gezielte Lenkung in Studienfächer, die als "weiblich" galten, wurde der Zugang zu Universitäten kontrolliert.
Was war die "NS Frauen-Warte"?
Es war die einzige parteiamtliche Frauenzeitschrift, die der ideologischen Schulung und der Verbreitung des Mutterkultes diente.
Waren Frauen im Nationalsozialismus nur Opfer?
Die Forschung zeigt, dass viele Frauen nicht nur Opfer, sondern auch aktive Mitläuferinnen und Täterinnen waren, die das System stützten.
- Citar trabajo
- Katrin Jacob (Autor), 1995, Die Frau im Nationalsozialismus und das Studium der Zeitungskunde/ Zeitungswissenschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266343