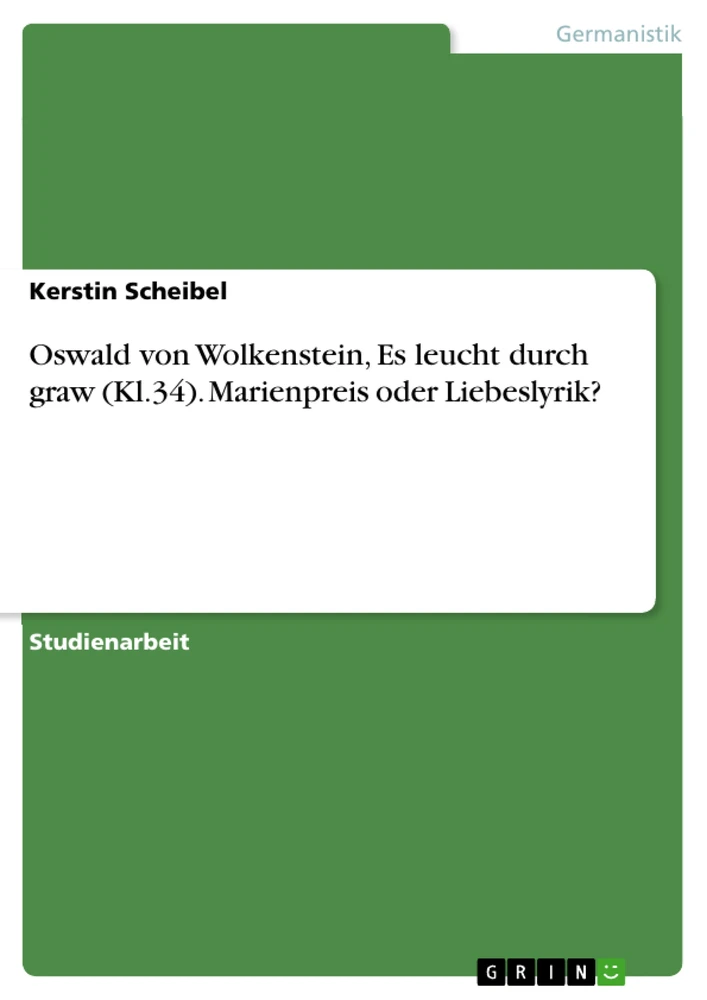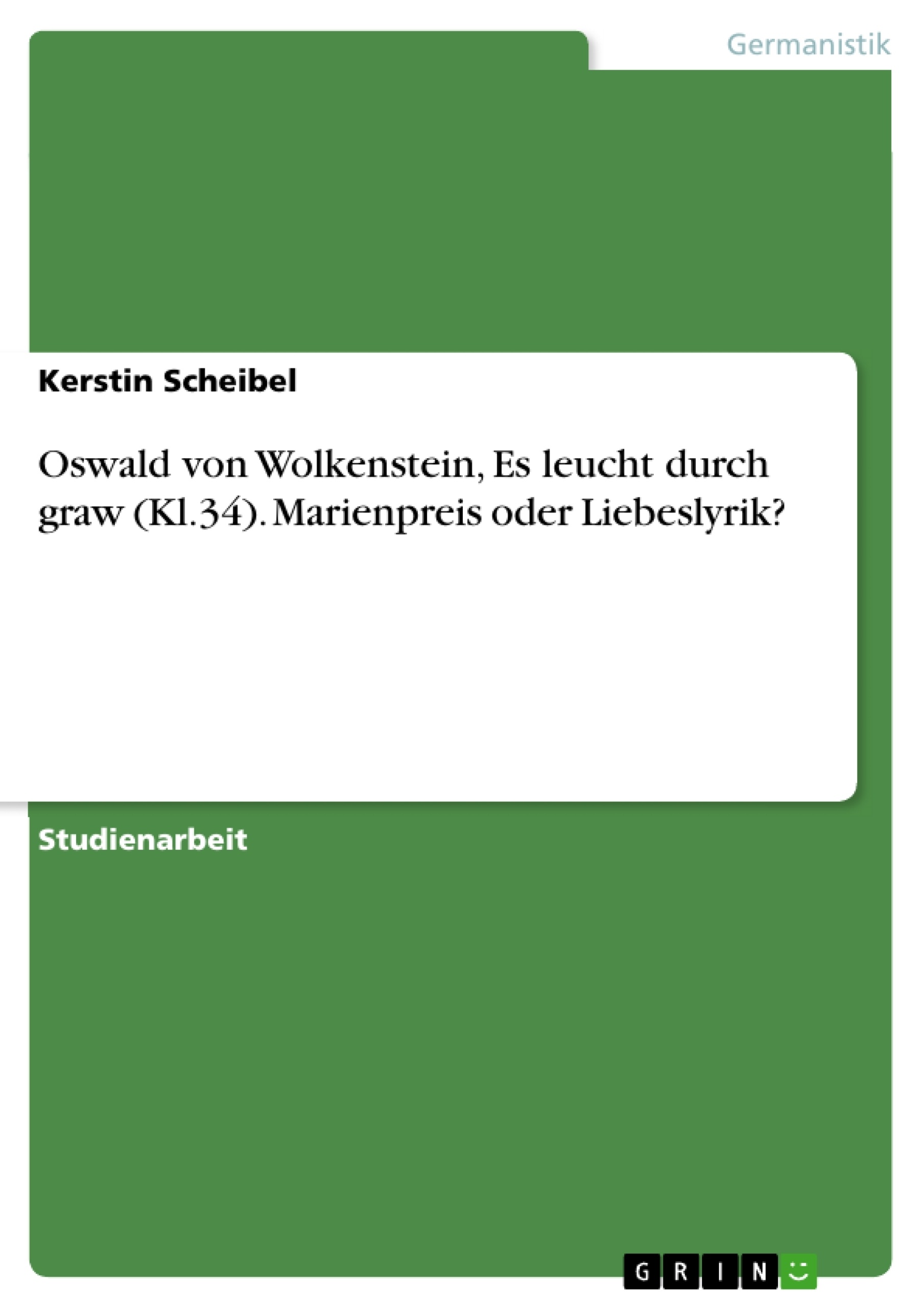Kaum ein anderer Dichter des Mittelalters ist so gut dokumentiert wie Oswald von Wolkenstein. Er wird oft als der letzte Minnesänger bezeichnet. Sein Werk umfasst geistliche wie auch weltliche Themengebiete. Die Arbeit befasst sich mit Oswalds Lied Es leucht durch graw (Kl. 34). Das Lied schöpft aus unterschiedlichen Liedtraditionen und wird in der Forschung sowohl als Marienpreis als auch geistliches Tagelied typisiert. Inhaltlich vereinigen sich religiöse Themen mit Motiven der weltlichen Natur– und Liebesdichtung zu einer schwer zu durchleuchtenden Geschlossenheit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Biographie Oswalds von Wolkenstein
- 3. Das Tagelied
- 4. Marienlyrik im Mittelalter
- 4.1 Marienlyrik bei Oswald von Wolkenstein
- 5. Lied Analyse Es leucht durch graw (Kl. 34)
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Oswalds von Wolkensteins Lied „Es leucht durch graw“ (Kl. 34) und untersucht seine Einordnung als Marienpreis oder geistliches Tagelied. Die Arbeit beleuchtet die biographischen Hintergründe des Dichters, die gattungsspezifische Einordnung des Tagelieds und die Entwicklung der Marienlyrik im Mittelalter. Die Analyse des Liedes selbst steht im Mittelpunkt.
- Biographie Oswalds von Wolkenstein und deren Einfluss auf sein Werk
- Gattungsmerkmale des Tagelieds im Mittelalter
- Entwicklung und Bedeutung der Marienlyrik im Werk Oswalds
- Interpretation und Analyse von „Es leucht durch graw“ (Kl. 34)
- Untersuchung der religiösen und weltlichen Elemente im Lied
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Einordnung von Oswalds Lied „Es leucht durch graw“ (Kl. 34) als Marienpreis oder geistliches Tagelied. Sie erwähnt die vielschichtigen Interpretationen des Liedes in der Forschung und skizziert den Aufbau der Arbeit, der von der Biographie Oswalds über die Gattung des Tagelieds und die Marienlyrik zum Hauptteil, der Analyse von Kl. 34, führt. Die Einleitung betont die einzigartige Stellung Oswalds als Dichter, der geistliche und weltliche Themen verbindet und eine innovative Sprache verwendet.
2. Biographie Oswalds von Wolkenstein: Dieses Kapitel skizziert die Lebensgeschichte Oswalds von Wolkenstein, von seiner frühen Reisezeit bis zu seinen Tätigkeiten als Berater Kaiser Sigismunds und seiner Rolle im Tiroler Vormundschaftsrat. Es hebt die Bedeutung seiner Reisen für seine Liedkunst hervor und erwähnt seine Ehe mit Margarete von Schwangau sowie einen Besitzstreit, der sein Leben prägte. Der Abschnitt beschreibt die Einteilung von Oswalds Werk in Liebeslyrik, geistliche Gesänge und autobiographische Lieder, betont aber auch die Unmöglichkeit, sein Werk strikt nach Gattungen zu ordnen, da Oswald gattungstypische Elemente virtuos variiert.
3. Das Tagelied: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Tagelieds als Untergattung des Minnesangs um 1200. Es erklärt die verschiedenen Bezeichnungen und diskutiert den Ursprung der Gattung, wobei auf die Verknüpfung mit volkstümlichen Liedern und der heimischen Frauenklage hingewiesen wird. Es beschreibt die typischen Elemente des Tagelieds, wie die Personenkonstellation (Liebespaar und Wächter), den Schauplatz (Schlafgemach oder Versteck) und den Handlungsverlauf (Liebesnacht und Abschied am Morgen). Die Bedeutung des Tagelieds als „Ventilfunktion“ wird erläutert, die es erlaubt, die erfüllte Liebe im Gegensatz zu den Konventionen der Hohen Minne auszudrücken, wenn auch nur fiktiv.
4. Marienlyrik im Mittelalter: Dieses Kapitel (zusammen mit Unterkapitel 4.1) beschreibt die Entwicklung der Marienlyrik im Mittelalter und ihren Stellenwert im Gesamtwerk von Oswald von Wolkenstein. Es analysiert die typischen Merkmale der Marienlyrik und den Wandel ihres Ausdrucks im Laufe der Zeit. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Marienlyrik in Oswalds Werk und der Frage, inwieweit sie sich von anderen Lyrikformen abhebt oder mit ihnen verschmilzt. Das Unterkapitel 4.1 behandelt explizit die Marienlyrik bei Oswald von Wolkenstein.
Schlüsselwörter
Oswald von Wolkenstein, Tagelied, Marienlyrik, Mittelalter, Liedanalyse, „Es leucht durch graw“ (Kl. 34), Minnesang, geistliche Lyrik, weltliche Lyrik, Biographie, Gattungsmerkmale, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Oswalds von Wolkensteins "Es leucht durch graw" (Kl. 34)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Oswalds von Wolkensteins Lied „Es leucht durch graw“ (Kl. 34) und untersucht seine Einordnung als Marienpreis oder geistliches Tagelied. Die Analyse betrachtet biographische Hintergründe des Dichters, die Gattung des Tagelieds und die Entwicklung der Marienlyrik im Mittelalter.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Biographie Oswalds von Wolkenstein und deren Einfluss auf sein Werk, die Gattungsmerkmale des mittelalterlichen Tagelieds, die Entwicklung und Bedeutung der Marienlyrik in Oswalds Werk, die Interpretation und Analyse von „Es leucht durch graw“ (Kl. 34) sowie die Untersuchung der religiösen und weltlichen Elemente im Lied.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Biographie Oswalds von Wolkenstein, Das Tagelied, Marienlyrik im Mittelalter (inkl. Unterkapitel zu Oswalds Marienlyrik), Liedanalyse von "Es leucht durch graw" (Kl. 34) und Zusammenfassung.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Einordnung von „Es leucht durch graw“ als Marienpreis oder geistliches Tagelied vor, erwähnt verschiedene Interpretationen in der Forschung und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie betont Oswalds einzigartige Stellung als Dichter, der geistliche und weltliche Themen verbindet.
Wie wird die Biographie Oswalds von Wolkenstein behandelt?
Das Kapitel zur Biographie skizziert Oswalds Leben, von seinen Reisen bis zu seinen Tätigkeiten als Berater und seine Rolle im Tiroler Vormundschaftsrat. Es betont den Einfluss seiner Reisen auf seine Liedkunst, seine Ehe und einen Besitzstreit. Die Einordnung seines Werks in verschiedene Gattungen (Liebeslyrik, geistliche Gesänge, autobiographische Lieder) wird diskutiert, wobei die Überschreitung gattungstypischer Grenzen hervorgehoben wird.
Was wird im Kapitel zum Tagelied erklärt?
Dieses Kapitel beleuchtet Entstehung und Entwicklung des Tagelieds als Untergattung des Minnesangs, erklärt verschiedene Bezeichnungen, diskutiert den Ursprung (Verknüpfung mit volkstümlichen Liedern), beschreibt typische Elemente (Personen, Schauplatz, Handlung) und erläutert seine Bedeutung als „Ventilfunktion“ für die Darstellung von Liebe entgegen den Konventionen der Hohen Minne.
Wie wird die Marienlyrik im Mittelalter behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Marienlyrik im Mittelalter und ihren Stellenwert in Oswalds Werk. Es analysiert typische Merkmale und den Wandel ihres Ausdrucks im Laufe der Zeit, mit Fokus auf ihre Bedeutung in Oswalds Werk und ihre Beziehung zu anderen Lyrikformen. Ein Unterkapitel konzentriert sich explizit auf Oswalds Marienlyrik.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Oswald von Wolkenstein, Tagelied, Marienlyrik, Mittelalter, Liedanalyse, „Es leucht durch graw“ (Kl. 34), Minnesang, geistliche Lyrik, weltliche Lyrik, Biographie, Gattungsmerkmale, Interpretation.
- Quote paper
- Kerstin Scheibel (Author), 2013, Oswald von Wolkenstein, Es leucht durch graw (Kl.34). Marienpreis oder Liebeslyrik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266415