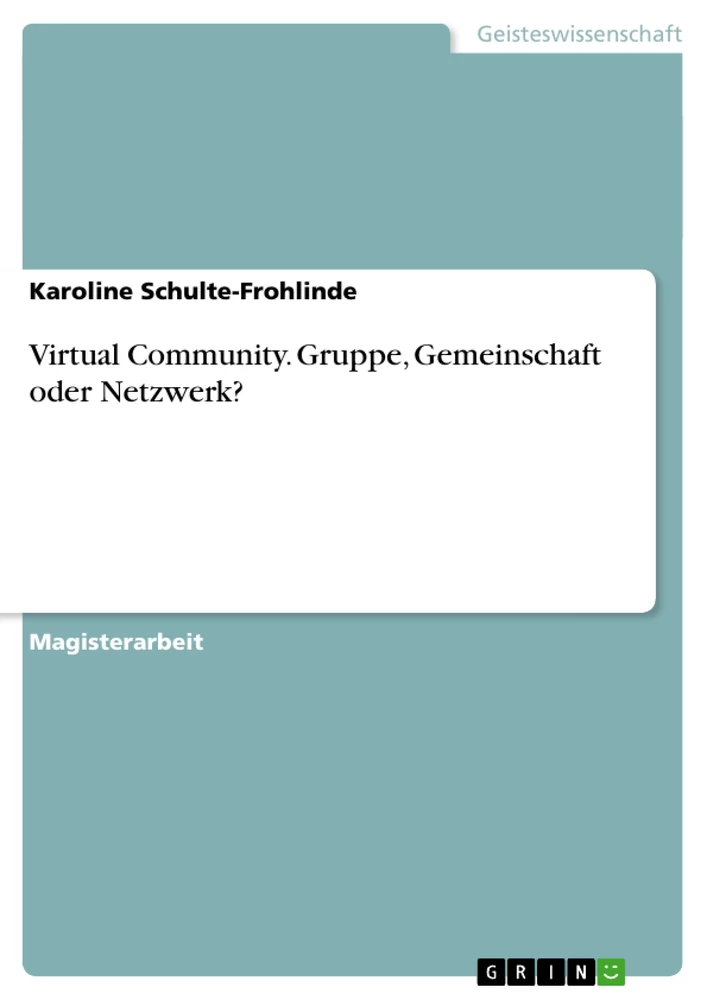In dieser Arbeit wird das Konzept der Virtual Community, das Howard Rheingold 1993 mit Erscheinen des Buches ‚The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier’ geprägt hat, vor dem Hintergrund technischer Entwicklungen und den daraus resultierenden Folgen erneut einer Analyse unterzogen.
‚Virtual Community’ wird als Konzept seit jeher problematisch wahrgenommen. Da die soziologische Definition von ‚Community’, also Gemeinschaft, deutlich von dem differiert, was unter ‚Virtual Community’ im allgemeinen Sprachgebrauch verstanden wird und wegen des Adjektivs ‚Virtual’ ist die Bezeichnung seit Erscheinen des Buches von Rheingold unzählige Male auf seine theoretische Anwendbarkeit geprüft worden.
Das Konzept ‚Virtual Community’ erlangt jedoch erst Hand in Hand mit der Entwicklung von Social Software während der Durchsetzung typischer Web 2.0 Anwendungen eine neue Relevanz.
Neben der Definition von Social Software wird eine analytische Annäherung an das Konzept ‚Virtual Community’ vorgenommen und zu seinem originären Ursprung zurückverfolgt. Die Vertreter der Theorie, dass Virtual Communities Gemeinschaften im soziologischen Sinne sind, konstruieren das Internet bzw. Virtualität als Sozialraum.
Eine wachsende Zahl von Nutzern und ständige Verfügbarkeit des Internet sind Voraussetzung für die Entstehung eines sozialen Handlungsraums. In diesem Kontext werden die Begriffe Kommunikation, Raum, das handelnde Subjekt, Sozialisation und Identitätskonstruktion definiert, da sie die theoretische Grundlage für die Definition einer ‚Virtual Community’ bilden.
Mittels des mediologischen Ansatzes erfolgt eine Einordnung von Internet und Virtualität und damit auch von ‚Virtual Communities’ in den historischen Kontext. Neuere Ansätze zur Definition virtueller Gemeinschaften, vor allem in der anglo-amerikanischen Communityforschung, ziehen zur Erklärung von ‚Virtual Communities’ die Oralitätsthese von Ong hinzu. Das besondere an der „Kultur“, die im Internet entsteht, ist, dass sie sowohl Kennzeichen
oraler als auch auraler Kulturen zeigt.
Im Fokus der Arbeit stehen folgende Fragen: Was ist eine ‚Virtual Community’ und was nicht? Wie sind Gruppen, Netzwerke und Gemeinschaften generell im Internet einzuordnen? Können im Internet Gemeinschaften im soziologischen Sinne entstehen oder gibt es nur Gruppen, Netzwerke, soziale Netzwerke und Imaginierte Gemeinschaften? [...]
Daten-DVD nicht im Lieferumfang enthalten
Inhaltsverzeichnis
- Hauptteil
- Auf den ersten Blick ein Problem
- Das Internet - Eine kurze Bestandsaufnahme
- Der Wandel im WWW von Web 1.0 zu Web 2.0
- Wer nutzt das Netz?
- Social Software und Virtual Community
- Gemeinschaft und Gesellschaft nach Ferdinand Tönnies
- Imagined Communities
- Was ist nach soziologischer Definition soziale Gemeinschaft?
- Kommunikation, CMC und Handlungsräume
- Subjektkonstruktion, Sozialisation und Identität
- Realität und Virtualität aus mediologischer Sicht
- Oralität und Virtual Community
- Fazit — Gibt es Gemeinschaft im Netz?
- Anhang
- Verzeichnis der Abkürzungen
- Begriffslexikon
- Bildbeispiele
- Gesprächsanalyse, Fragebögen und Interviews
- CC — Beispiel zur Oralität im Netz
- Fragebögen und narrative Interviews
- Daten-DVD mit Medienbeispielen und Herleitungsnachweisen
- Literatur
- Links
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert das Konzept der Virtual Community, das Howard Rheingold 1993 prägte, vor dem Hintergrund technischer Entwicklungen und deren Folgen. Sie untersucht die Entstehung und Entwicklung des Internets und Web 2.0, insbesondere die Rolle von Social Software in der Entstehung von Virtual Communities. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob im Internet Gemeinschaften im soziologischen Sinne entstehen können und wie sich Virtual Communities von anderen sozialen Gruppen unterscheiden.
- Der Wandel von Web 1.0 zu Web 2.0 und die Bedeutung von Social Software
- Die soziologische Definition von Gemeinschaft und die Relevanz des Konzepts der Imagined Community
- Die Bedeutung von Kommunikation, CMC und Handlungsräumen im virtuellen Kontext
- Subjektkonstruktion, Sozialisation und Identität im Internet
- Die Rolle von Oralität in der Entstehung von Virtual Communities
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt das Konzept der Virtual Community vor und beschreibt die Problematik der Bezeichnung. Es werden die Ursprünge des Internets und die Entwicklung von Web 1.0 zu Web 2.0 nachgezeichnet, wobei die Bedeutung von Social Software und die Entstehung neuer Anwendungen im Netz hervorgehoben werden. Des Weiteren werden die Zugangsbarrieren zum Internet und die digitale Spaltung beleuchtet.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem soziologischen Gemeinschaftsbegriff. Es werden die Ansätze von Ferdinand Tönnies und Benedict Anderson vorgestellt und die Merkmale sozialer Gemeinschaft erläutert. Dabei werden die Bedeutung von gemeinsamen Werten, sozialen Beziehungen und der Organisation von Gemeinschaft sowie die verschiedenen Typen von Gemeinschaft, wie z.B. die Gemeinschaft des Blutes, des Geistes und des Ortes, Imaginierte Gemeinschaften und Intentionale Gemeinschaften, näher beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Kommunikation im Internet. Es werden die Ansätze von Niklas Luhmann und Jürgen Habermas zur Definition von Kommunikation und Handlung vorgestellt und die Besonderheiten der Computer Mediated Communication (CMC) im Internet hervorgehoben. Des Weiteren wird die Frage nach der Entstehung von Intersubjektivität im virtuellen Kontext gestellt und die Bedeutung von Sprache, Wahrnehmung, Bewusstsein und Realität für die Konstruktion von Virtual Communities diskutiert.
Das vierte Kapitel untersucht die Entstehung von Virtual Communities aus mediologischer Sicht. Es werden die Ansätze von Régis Debray zur Mediologie vorgestellt und die Bedeutung von Medien und Symbolen für die Übermittlung von Kultur und Wissen im Internet hervorgehoben. Des Weiteren wird die Rolle von Oralität in der Entstehung von Virtual Communities diskutiert und die Entstehung von virtuellen Identitäten und virtuellen Gemeinschaften im Kontext der Digital Natives und Digital Immigrants beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Virtual Community, Social Software, Web 2.0, Kommunikation, CMC, Handlungsräume, Subjektkonstruktion, Sozialisation, Identität, Oralität, Imagined Communities, Gemeinschaft, Gesellschaft, Mediologie, Digital Natives, Digital Immigrants, Internet, World Wide Web, Cyberspace, Raum, Zeit, Kultur, Medien, Wissen, Information.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine "Virtual Community"?
Der Begriff wurde von Howard Rheingold geprägt und beschreibt soziale Aggregationen im Internet, wenn Menschen lange genug öffentliche Debatten mit Gefühl führen.
Sind virtuelle Gemeinschaften echte Gemeinschaften im soziologischen Sinne?
Die Arbeit analysiert dies kritisch anhand von Ferdinand Tönnies' Definition von Gemeinschaft und Gesellschaft sowie Benedict Andersons "Imagined Communities".
Welche Rolle spielt Web 2.0 für virtuelle Gemeinschaften?
Durch Social Software und die Mitmach-Kultur des Web 2.0 erlangte das Konzept der Virtual Community eine neue Relevanz und Dynamik.
Was ist die Oralitätsthese in Bezug auf das Internet?
Sie besagt, dass die Kommunikation im Netz sowohl Merkmale schriftlicher als auch mündlicher (oraler) Kulturen vereint.
Wie wird Identität in virtuellen Räumen konstruiert?
Die Arbeit untersucht, wie Subjektkonstruktion und Sozialisation in einem rein digitalen Handlungsraum funktionieren.
- Citation du texte
- Karoline Schulte-Frohlinde (Auteur), 2008, Virtual Community. Gruppe, Gemeinschaft oder Netzwerk?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266428