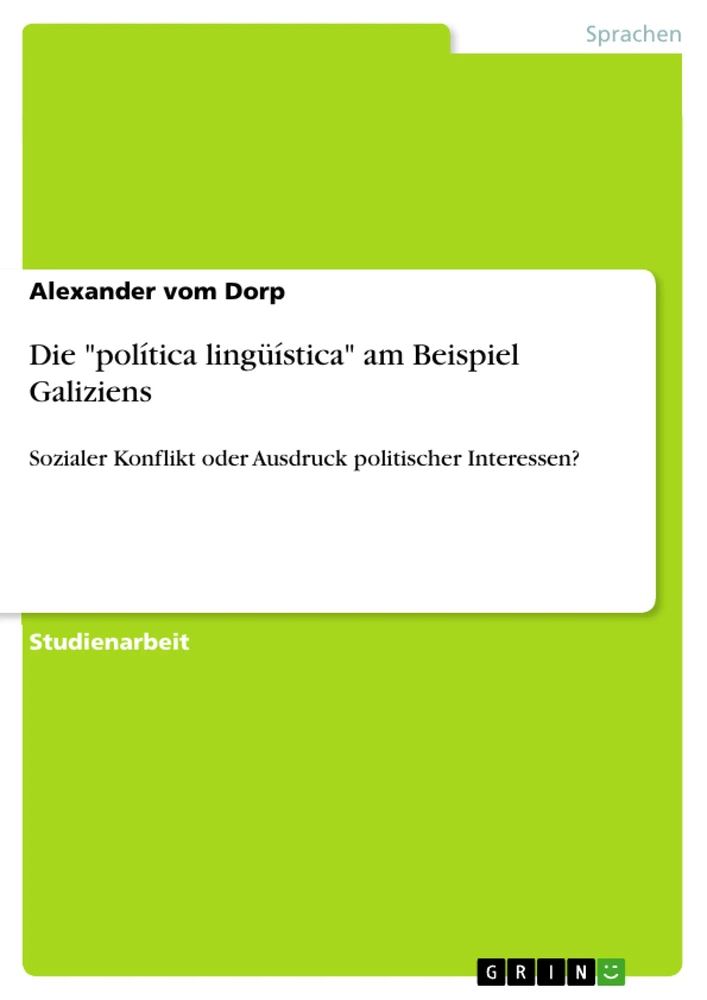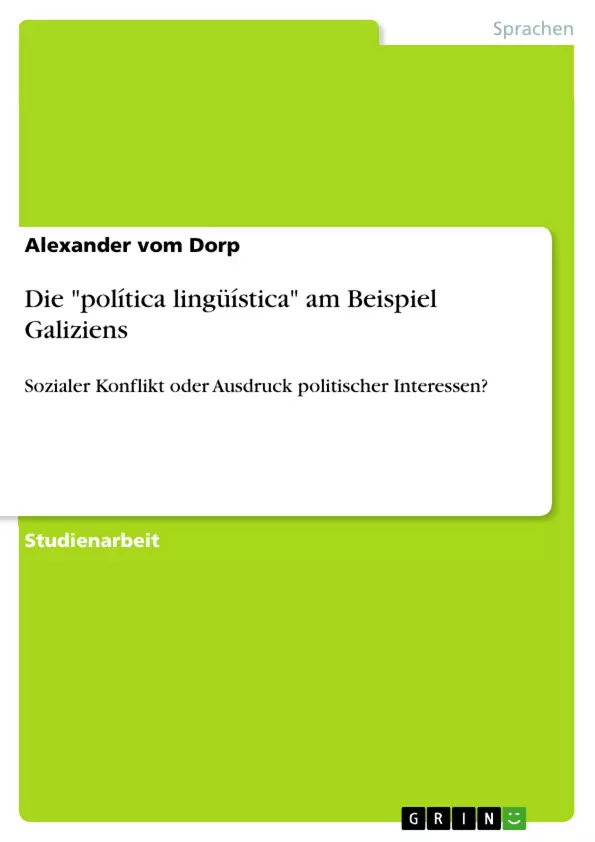Die spanische Sprachpolitik ist in Bewegung, besonders in den Autonomen Gemeinschaften, die neben dem Kastilischen als lengua oficial nach der Verfassung von 1978 zusätzlich auch über eine eigene offizielle Sprache (catalán, euskera, gallego) verfügen. Die Lösung der Sprachenfrage ist seit langem Gegenstand von Diskussionen, die alle zurückgehen auf die umstrittene Interpretation des Artikels 3 der Constitución, welcher sich mit den Sprachen Spaniens auseinandersetzt.1 Ninyoles hat ihn als eine Mischung aus Territorial- und Personalprinzip bezeichnet, wobei er gleich anmerkt, dass ein im Artikel beinhaltetes Hierarchieverhältnis zugunsten des castellano dieses Mischprinzip wieder einschränke.2
Seit dem Ende des Franquismus werden die spanischen Regionalsprachen aber durch die Verfassung geschützt, was einer Ausdehnung ihrer Präsenz zu-gute kam. Das Konzept der política lingüística ist von großer Bedeutung geworden in den comunidades autónomas Galizien, dem Baskenland und Katalonien, sowie den Balearen und Valencia, wo jeweils Formen des catalán gesprochen werden. Die genannten Regionen betreiben teilweise einen enormen Aufwand, um ihre Autonomierechte und damit einhergehend ihre Regionalsprachen zu fördern und dahin aufzuwerten, dass deren Bedeutung mit dem Kastilischen gleichgesetzt werden kann. Die von den Regionalregierungen angewandten Mittel zur Umsetzung ihrer política lingüística, gehen jedoch keinesfalls immer konform mit den Interessen aller Bevölkerungsteile, erst recht nicht mit der politischen Opposition, die momentan hauptsächlich durch den PP repräsentiert wird.
So hat sich das Thema zu einem kontroversen Diskurs gewandelt, der in den Medien schon mal zum “guerra del idioma“ stilisiert wird. Beinahe täglich berichten Zeitungen von neuen Maßnahmen zur weiterführenden sprachlichen Standardisierung (normalización lingüística) in den jeweiligen Regionen. Kritiker verschiedener Lager machen Mobil, gegen die aus ihrer Sicht zu nationalistische Politik der Regionalregierungen. Spaniens Oppositionsführer Mariano Rajoy sieht die Einheit des Landes in Gefahr, auch die katholische Kirche stößt ins selbe Horn, indem sie vor einer Balkanisierung warnt. Separatismusvorwürfe stehen der Forderung nach einer Zulassung des Katalanischen im spanischen Parlament gegenüber.3
Die folgende Arbeit versucht eine Analyse der Hintergründe dieses Konfliktes vor allem für die Situation in Galizien. Zudem soll geklärt werden, ob und inwiefern jene Auseinandersetzung
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Sprachpolitische Entwicklung im Postfranquismus
- 2.1 Der Weg zur Autonomen Gemeinschaft nach 1975
- 2.2 La lei de normalización lingüística de 15.6.1983
- 2.3 Von Manuel Fraga Iribarne bis Emilio Pérez Touriño
- 2.4 Die Weiterentwicklung zur aktuellen Situation des Galizischen
- 3. Gallego vs. Castellano - Un conflicto social?
- 3.1 Die inmersión lingüística im Schulwesen und ihre Folgen
- 3.2 Die gegenwärtige Debatte
- 4. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die sprachpolitische Entwicklung Galiziens im Postfranquismus und untersucht, ob und inwiefern der Sprachkonflikt zwischen Gallego und Castellano durch politische Interessen geprägt ist. Dabei werden die historischen Entwicklungen, die rechtlichen Grundlagen der Sprachpolitik und die aktuelle Debatte um die Sprachnormalisierung in Galizien beleuchtet.
- Sprachpolitische Entwicklung in Galizien nach dem Franquismus
- Einfluss von historischen Ereignissen auf die Sprachpolitik
- Analyse der Gesetzgebung zur Sprachnormalisierung
- Aktuelle Debatte um die Rolle des Gallego in der Gesellschaft
- Bedeutung von politischen Interessen im Sprachkonflikt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung
Die Einführung führt in die Thematik der spanischen Sprachpolitik und den Konflikt zwischen dem Kastilischen und den Regionalsprachen, wie dem Katalanischen, Euskera und Gallego, ein. Der Fokus liegt auf der Interpretation von Artikel 3 der spanischen Verfassung, der die Sprachenfrage regelt, und den politischen Spannungen, die durch die Regionalisierung der Sprache entstehen.
2. Sprachpolitische Entwicklung im Postfranquismus
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung Galiziens zum autonomen Gebiet nach dem Ende des Franquismus. Es werden wichtige Stationen und Ereignisse der postfranquistischen Geschichte hervorgehoben, die Einfluss auf die aktuelle Sprachpolitik der galizischen Regionalregierung hatten.
2.1 Der Weg zur Autonomen Gemeinschaft nach 1975
Der Abschnitt beschreibt den Prozess der Demokratisierung Spaniens in den 1970er Jahren und die Anerkennung Galiziens als historische Nationalität. Es wird das Autonomiestatut von 1981 hervorgehoben, das das Galizische als offizielle Sprache anerkennt und die Verantwortung der Behörden für dessen Förderung unterstreicht.
2.2 La lei de normalización lingüística de 15.6.1983
Dieses Kapitel fokussiert sich auf das erste Gesetz zur Sprachnormalisierung in Galizien. Es analysiert die wichtigsten Punkte des Gesetzes und seine Bedeutung für die Förderung des Galizischen.
2.3 Von Manuel Fraga Iribarne bis Emilio Pérez Touriño
Dieser Abschnitt beleuchtet die Entwicklung der Sprachpolitik unter den verschiedenen Regionalregierungen Galiziens, von Manuel Fraga Iribarne bis Emilio Pérez Touriño. Es werden die unterschiedlichen Ansätze und Strategien zur Sprachnormalisierung sowie die politischen Kontroversen um die Umsetzung dieser Strategien dargestellt.
2.4 Die Weiterentwicklung zur aktuellen Situation des Galizischen
Dieser Teil des Kapitels behandelt die Weiterentwicklung der Sprachpolitik Galiziens und analysiert die aktuelle Situation des Galizischen in Bezug auf seinen Status und seine Verbreitung in der Gesellschaft. Es werden wichtige Faktoren, die den Status des Galizischen beeinflussen, wie z.B. die Sprachpolitik der Regierung und die Einstellungen der Bevölkerung, diskutiert.
3. Gallego vs. Castellano - Un conflicto social?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern der Sprachkonflikt zwischen Gallego und Castellano ein sozialer Konflikt ist. Es analysiert die Auswirkungen der Sprachpolitik auf die Gesellschaft, insbesondere auf das Bildungswesen und die Einstellungen der Bevölkerung.
3.1 Die inmersión lingüística im Schulwesen und ihre Folgen
Dieser Abschnitt beleuchtet die Einführung der Sprachimmersion im galizischen Schulsystem und deren Auswirkungen auf die sprachliche Entwicklung der Kinder. Es werden die Argumente für und gegen die Sprachimmersion sowie die sozialen Folgen dieser Politik diskutiert.
3.2 Die gegenwärtige Debatte
Der letzte Abschnitt des Kapitels behandelt die aktuelle Debatte um die Sprachpolitik Galiziens. Es werden die verschiedenen Positionen und Argumente der verschiedenen Akteure, wie z.B. Politiker, Sprachwissenschaftler und Bürger, diskutiert. Es werden außerdem die Herausforderungen und Kontroversen, die mit der Umsetzung der Sprachpolitik verbunden sind, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Sprachpolitik, Sprachnormalisierung, Galizisch, Kastilisch, Autonome Gemeinschaften, Regionalsprachen, Postfranquismus, Sozialer Konflikt, Politische Interessen, Bildungswesen, Medien, Ideologie, Opportunismus.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Política Lingüística“ in Spanien?
Es bezeichnet die Sprachpolitik der Autonomen Gemeinschaften, die darauf abzielt, Regionalsprachen wie Gallego, Katalanisch oder Euskera neben dem Kastilischen zu fördern.
Was ist die „Normalización Lingüística“ in Galizien?
Es ist der Prozess der sprachlichen Standardisierung, um das Galizische (Gallego) in allen öffentlichen Bereichen, Schulen und Medien als gleichberechtigte Sprache zu etablieren.
Was versteht man unter „Inmersión Lingüística“ im Schulwesen?
Sprachimmersion bedeutet, dass Unterrichtsfächer primär in der Regionalsprache unterrichtet werden, um eine hohe Sprachkompetenz bei den Schülern zu erzielen.
Warum ist die Sprachpolitik in Galizien umstritten?
Kritiker und die politische Opposition (wie der PP) befürchten eine „Balkanisierung“ oder Benachteiligung des Kastilischen und sehen in der Politik oft nationalistische Interessen.
Welche Rolle spielt Artikel 3 der spanischen Verfassung?
Dieser Artikel regelt die Sprachenfrage und wird kontrovers interpretiert, da er einerseits das Kastilische als Amtssprache festlegt, andererseits den Schutz der anderen Sprachen Spaniens fordert.
- Quote paper
- Alexander vom Dorp (Author), 2008, Die "política lingüística" am Beispiel Galiziens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266453