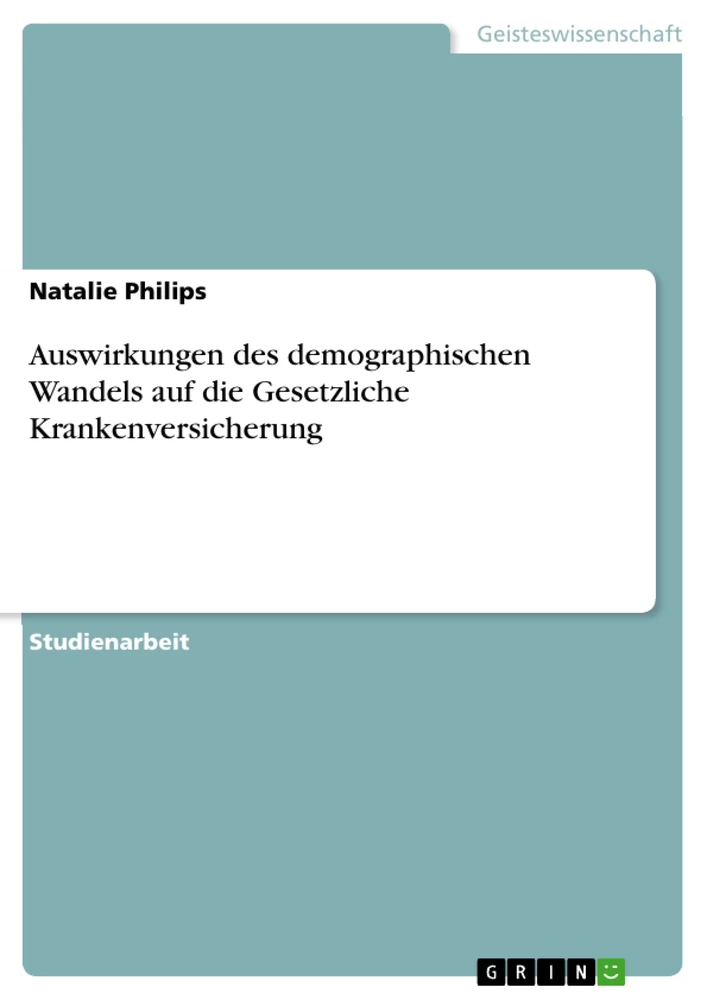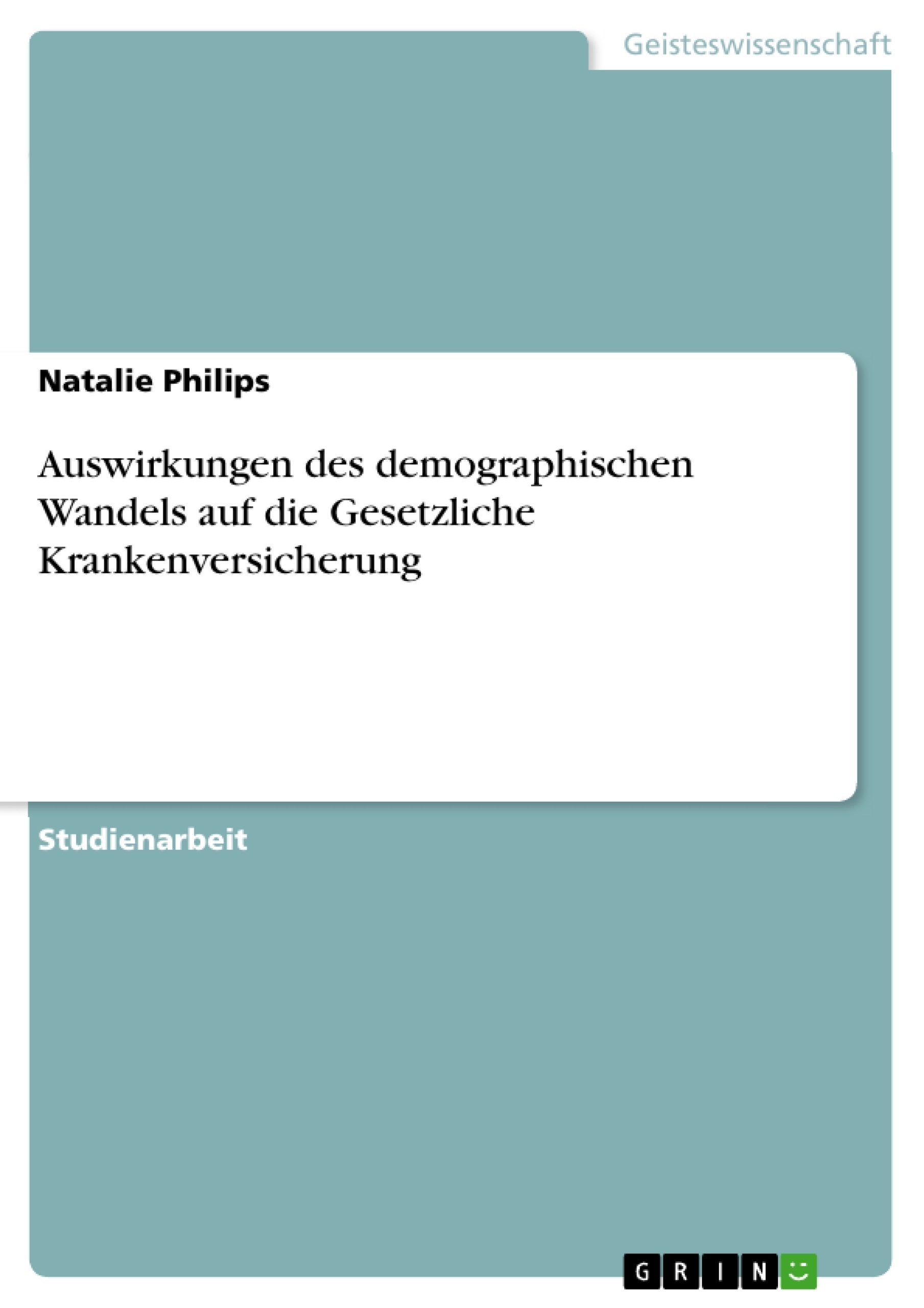Die Bevölkerung in Deutschland nimmt ab und wird immer älter. Dieser Strukturwandel ist unstrittig und wird künftig zu gravierenden Problemen bei den umlagefinanzierten Sozialversicherungssystemen führen. Neben der Rentenversiche¬rung steht die Gesetzliche Krankenversicherung (im Folgenden kurz: GKV) vor großen Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels.
Das Finanzvolumen der GKV verringert sich und gleichzeitig nimmt der Leistungsbedarf der Versicherten zu. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit gegensteuernder gesundheitspolitischer Maßnahmen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Folgen des demographischen Wandels für die GKV anhand der Betrachtung der Ausgaben- und Einnahmeentwicklung, darzustellen. Zudem soll untersucht werden, ob die dadurch entstehenden Probleme durch die Reformvorschläge der politischen Parteien gelöst werden können.
Untergliedert ist die vorliegende Arbeit in drei Hauptteile.
Im Punkt 2. werden die Grundlagen für die Bearbeitung der Fragestellung erarbeitet. Zunächst werden die wichtigsten Fakten des demographischen Wandels und seine Einflussgrößen in Deutschland dargestellt und darauf die Grundlagen der GKV skizziert.
Im Folgenden beschäftigt sich Kapitel 3 mit der Frage, wie der demographische Wandel sich auf die Finanzierung der GKV auswirkt. Zunächst wird auf die Ausgabenseite eingegangen und danach wird die Einnahmenseite betrachtet.
Darauf aufbauend werden in Kapitel 4 zwei Möglichkeiten zur Verbesserung des Status Quo aufgezeigt. Bei der ersten Reformoption handelt es sich um eine von der SPD favorisierte Bürgerversicherung. Die CDU auf der anderen Seite sieht in der Einführung der Kopfpauschale die Lösung der GKV-Problematik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Demographische Entwicklung in Deutschland: Veränderung der Altersstruktur und Bevölkerungsrückgang
- Die Gesetzliche Krankenversicherung
- Konsequenzen des Bevölkerungswandels für Finanzierung der GKV
- Einfluss des demographischen Wandels auf die GKV-Ausgaben
- Einfluss des demographischen Wandels auf die GKV-Einnahmen
- Reformoptionen auf der GKV-Einnahmenseite
- Bürgerversicherung
- Kopfpauschalen
- Bewertung der Lösungsansätze
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) in Deutschland. Die Arbeit analysiert die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der GKV unter dem Einfluss des demographischen Wandels und untersucht die Auswirkungen auf die Finanzierung des Systems. Darüber hinaus werden zwei Reformoptionen, die Bürgerversicherung und die Kopfpauschale, vorgestellt und bewertet, um zu beurteilen, ob diese die Herausforderungen der GKV-Finanzierung im Kontext des demographischen Wandels lösen können.
- Demographischer Wandel in Deutschland
- Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung
- Auswirkungen des demographischen Wandels auf die GKV-Ausgaben und -Einnahmen
- Reformoptionen für die GKV-Finanzierung
- Bewertung der Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik des demographischen Wandels und dessen Auswirkungen auf die GKV. Anschließend werden die Grundlagen der GKV erläutert, einschließlich der Versicherungspflicht, des Solidaritätsprinzips und des Umlageverfahrens. Kapitel 3 analysiert die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die GKV-Finanzierung, indem es den direkten und indirekten demographischen Effekt auf die Ausgaben und Einnahmen betrachtet. Dabei werden die Kompressionsthese und die Medikalisierungsthese diskutiert, die unterschiedliche Ansätze zur Entwicklung der Gesundheitsausgaben im Alter bieten.
Kapitel 4 stellt zwei Reformoptionen für die GKV-Finanzierung vor: die Bürgerversicherung und die Kopfpauschale. Die Bürgerversicherung zielt darauf ab, die Versicherungspflicht auf alle Bürger auszuweiten und alle Einkommensarten bei der Beitragsbemessung zu berücksichtigen. Die Kopfpauschale hingegen basiert auf dem Äquivalenzprinzip und sieht einen einheitlichen Beitrag für alle Versicherten vor. Die beiden Modelle werden im Hinblick auf ihre Stärken und Schwächen bewertet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den demographischen Wandel, die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), die Finanzierung der GKV, die GKV-Ausgaben, die GKV-Einnahmen, die Bürgerversicherung, die Kopfpauschale, die Kompressionsthese, die Medikalisierungsthese, die Altersstruktur, die Lebenserwartung, die Fertilitätsrate, der Altenquotient, die Versicherungspflichtgrenze, das Solidaritätsprinzip, das Umlageverfahren, die Reformoptionen und die Bewertung der Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich der demographische Wandel auf die GKV aus?
Durch eine alternde Bevölkerung steigen die Ausgaben für medizinische Leistungen, während die Einnahmen aufgrund weniger Beitragszahler sinken.
Was ist der Unterschied zwischen der Kompressionsthese und der Medikalisierungsthese?
Die Kompressionsthese besagt, dass Krankheiten in eine kurze Phase vor dem Tod zusammengedrängt werden, während die Medikalisierungsthese davon ausgeht, dass die längere Lebenszeit mit mehr Behandlungsbedarf verbunden ist.
Was beinhaltet das Modell der Bürgerversicherung?
Die Bürgerversicherung sieht vor, die Versicherungspflicht auf alle Bürger auszuweiten und neben dem Erwerbseinkommen auch andere Einkommensarten (z. B. Mieten, Zinsen) zur Beitragsbemessung heranzuziehen.
Was versteht man unter einer Kopfpauschale?
Bei einer Kopfpauschale zahlen alle Versicherten einen einkommensunabhängigen Einheitsbeitrag, wobei ein sozialer Ausgleich meist über Steuermittel erfolgt.
Welche Faktoren beeinflussen die demographische Entwicklung in Deutschland?
Zentrale Einflussgrößen sind die sinkende Fertilitätsrate (Geburtenrate), die steigende Lebenserwartung und der daraus resultierende Anstieg des Altenquotienten.
- Quote paper
- Natalie Philips (Author), 2011, Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Gesetzliche Krankenversicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266478