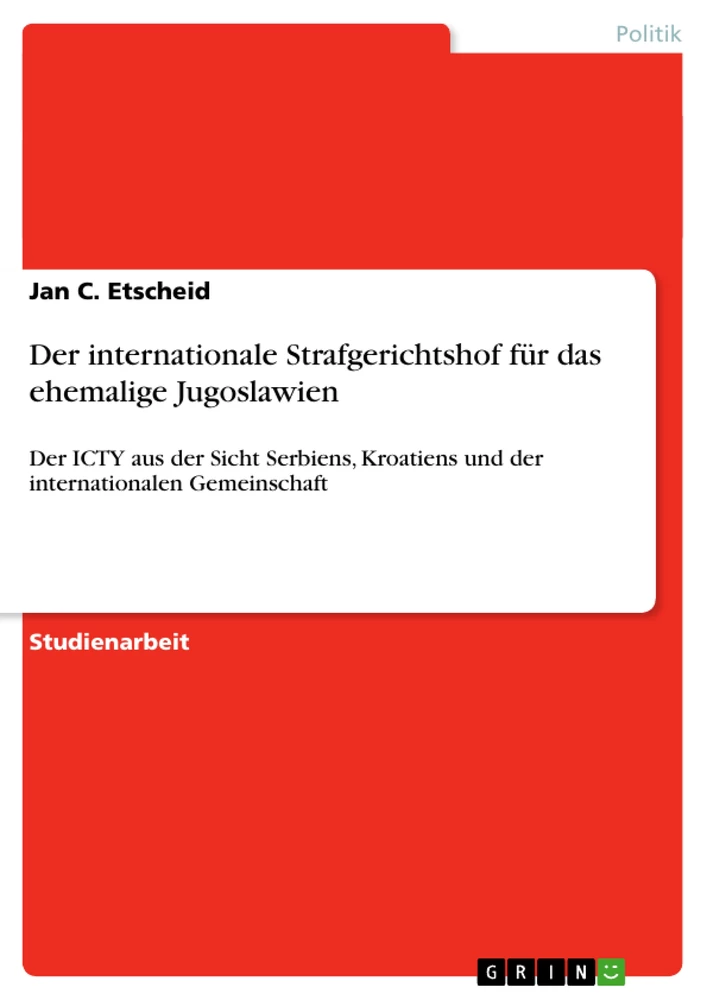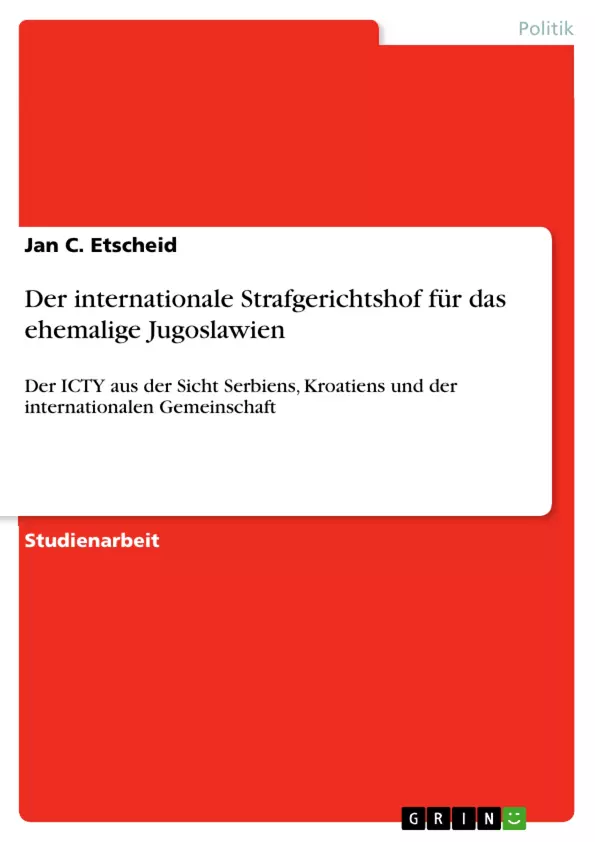In der Hausarbeit wurde die Sicht Serbiens, Kroatiens und der internationalen Gemeinschaft auf den ICTY erarbeitet und ein allgemeines Fazit gezogen. Zu Beginn wird kurz die Geschichte des ICTY erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- DER ICTY
- SICHT SERBIENS
- SICHT KROATIENS
- SICHT DER INTERNATIONALEN GEMEINSCHAFT
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) und analysiert dessen Bewertung aus der Perspektive Serbiens, Kroatiens und der internationalen Gemeinschaft. Ziel ist es, die Legitimität, Rechtsmäßigkeit und den Erfolg des Tribunals zu beleuchten und zu untersuchen, ob es zur Schaffung von Gerechtigkeit und Aussöhnung zwischen den Völkern beigetragen hat.
- Die Legitimität und Rechtsmäßigkeit des ICTY
- Die unterschiedlichen Perspektiven Serbiens, Kroatiens und der internationalen Gemeinschaft
- Die Auswirkungen des ICTY auf die Aussöhnung zwischen den Völkern
- Die Rolle des ICTY bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen
- Die Herausforderungen bei der Zusammenarbeit mit dem ICTY
Zusammenfassung der Kapitel
- DER ICTY
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY), der 1993 durch die Resolution 827 des UN-Sicherheitsrats gegründet wurde. Es wird festgehalten, dass die Meinungen über die Notwendigkeit, die Rechtmäßigkeit und den Erfolg des Tribunals uneinheitlich sind. Trotz der unterschiedlichen Perspektiven wird jedoch betont, dass die Arbeit des ICTY fast abgeschlossen ist, da die meisten Angeklagten vor Gericht gestellt wurden und die letzten Berufungsverfahren laufen.
- SICHT SERBIENS
Serbien bezweifelte von Anfang an die Legitimität des ICTY und kritisierte den Eingriff in die serbische Souveränität. Die serbische Regierung argumentierte, dass die USA nicht mit dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC) zusammenarbeiten, aber eine Zusammenarbeit Serbiens mit dem ICTY einfordern. Die Urteile gegen Serben wurden als härter empfunden als gegen bosnische oder kroatische Angeklagte, was zu einem Gefühl der Ungerechtigkeit und einer Blockadehaltung Serbiens gegenüber dem ICTY führte. Der ICTY wurde von vielen Serben als Instrument der westlichen Staaten angesehen, um Serbien zu bestrafen. Die fehlende Zusammenarbeit Serbiens mit dem ICTY erschwerte die Untersuchung von Verbrechen gegen Serben. Erst als die Chefanklägerin Carla del Ponte öffentlich betonte, dass auch Kroaten und Bosniaken Verbrechen begangen hatten, begann Serbien stärker mit dem ICTY zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit war jedoch eher auf Druck von außen als auf Überzeugung begründet. Die Auslieferung von ehemaligen Führern wie Ratko Mladic erfolgte vor allem aufgrund des Drucks durch die EU-Beitrittsverhandlungen. Bis heute ist der ICTY in weiten Teilen der serbischen Bevölkerung weder gewünscht noch akzeptiert. Die serbische Gesellschaft setzt eher auf Polarisierung statt Dialog und fühlt sich als Opfer der westlichen Staaten.
- SICHT KROATIENS
Kroatien setzte zu Beginn große Hoffnungen in den ICTY, da man sich eine Bestätigung der Opferrolle erhoffte. Kroatien war der einzige Staat, der ein Gesetz zur Regelung der Zusammenarbeit mit dem ICTY verabschiedete. Die anfängliche Konzentration des Tribunals auf serbische Verbrechen erfüllte diese Hoffnungen zunächst. Doch durch die im angelsächsischen Gerichtswesen üblichen Kreuzverhöre, unzureichenden Schutz der Zeugen und Anklagen gegen Kroaten fühlte sich Kroatien nicht mehr als Opfer geschützt, sondern eher als Täter behandelt. Ähnlich wie in Serbien werden auch in Kroatien die ehemaligen Offiziere als Helden verehrt, weshalb man der Anklage mit Unverständnis begegnete. Diese Ereignisse führten dazu, dass Kroatien die Verfahren zu verschleppen und die Unterstützung einzuschränken begann. Erst als die EU 2005 die Beitrittsverhandlungen nicht aufnahm, nahm Kroatien wieder die vollständige Zusammenarbeit mit dem ICTY auf. Diese Taktik der EU, die von vielen Kroaten als Erpressung wahrgenommen wurde, verschlechterte die Wahrnehmung des ICTY in der Öffentlichkeit. Auch die Tatsache, dass Kroatien mit der NATO kämpfte, aber nur Kroaten und keine NATO-Soldaten angeklagt wurden, trug nicht zu einer breiten Akzeptanz bei. Kroatiens Unterstützung wurde mehr und mehr von Zwang und weniger von Überzeugung abhängig. Dennoch steht Kroatien anders als Serbien der Idee des ICTY positiv gegenüber, da man die Serben als Aggressoren zur Verantwortung ziehen müsse.
- SICHT DER INTERNATIONALEN GEMEINSCHAFT
Die UN verfolgte mit der Einsetzung des ICTY drei Hauptziele. Erstens sollte die Schuld für Kriegsverbrechen einzelnen Personen zugewiesen werden, um die kollektiven Feindbilder „der Serben" oder „der Kroaten" zu durchbrechen. Obwohl Einzelpersonen vor Gericht gestellt wurden, sind die Feindbilder nicht verschwunden, was sicherlich auch mit dem Heldenstatus von Mladic oder Gotovina zu tun hat. Dennoch hat der ICTY eine gewisse Verantwortung gegenüber den Opfern erfüllt. Das zweite Ziel war die Auflösung einer Friedensgesellschaft. Dafür sollten die Ereignisse der Vergangenheit aufgearbeitet und eine gemeinsame Vergangenheit konstruiert werden. Durch eine unabhängige, internationale Beweisaufnahme sollte eine Grundlage für die Zukunft geschaffen und die nationalen Mythen eingedämmt werden. Bisher beharren die Staaten zwar auf ihren Opferrollen, jedoch ist das Fundament für die Zukunft gelegt. Das dritte Ziel war die Prävention gegen weitere Verbrechen. Führende Militärs und Warlords sollten von Kriegsverbrechen abgeschreckt werden, indem sie sich einer persönlichen Verantwortung bewusst sind. Diese Wirkung ist jedoch zumindest in den Jugoslawienkriegen verfehlt worden, wie das Massaker von Srebrenica zeigt, das nach der Einrichtung des ICTY begangen wurde. Es ist jedoch möglich, dass die Prozesse wie gegen Milosevic eine Abschreckung in künftigen Konflikten haben werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY), Kriegsverbrechen, Aussöhnung, Gerechtigkeit, Serbien, Kroatien, Internationale Gemeinschaft, Legitimität, Rechtsmäßigkeit, Zusammenarbeit, Opferrolle, Täterrolle, Feindbilder, nationale Mythen, Prävention, Abschreckung, Prozesse, Urteile und die Auswirkungen des ICTY auf die Gesellschaften in den ehemaligen jugoslawischen Republiken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der ICTY und wann wurde er gegründet?
Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) wurde 1993 durch die UN-Sicherheitsratsresolution 827 ins Leben gerufen.
Warum wird der ICTY in Serbien kritisch gesehen?
Viele Serben betrachten den Gerichtshof als Instrument des Westens, das die serbische Souveränität verletzt und Urteile einseitig zulasten serbischer Angeklagter fällte.
Welche Haltung nahm Kroatien gegenüber dem ICTY ein?
Kroatien war anfangs kooperativ, da es sich eine Bestätigung der Opferrolle erhoffte, distanzierte sich jedoch, als auch kroatische Offiziere angeklagt wurden.
Was waren die Hauptziele der internationalen Gemeinschaft?
Ziele waren die individuelle Zuweisung von Schuld (statt Kollektivschuld), die Aufarbeitung der Vergangenheit und die Abschreckung künftiger Kriegsverbrecher.
Hat der ICTY seine Präventionsziele erreicht?
Die präventive Wirkung wird kritisch hinterfragt, da schwere Verbrechen wie das Massaker von Srebrenica erst nach der Gründung des Tribunals stattfanden.
- Arbeit zitieren
- Jan C. Etscheid (Autor:in), 2013, Der internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266483