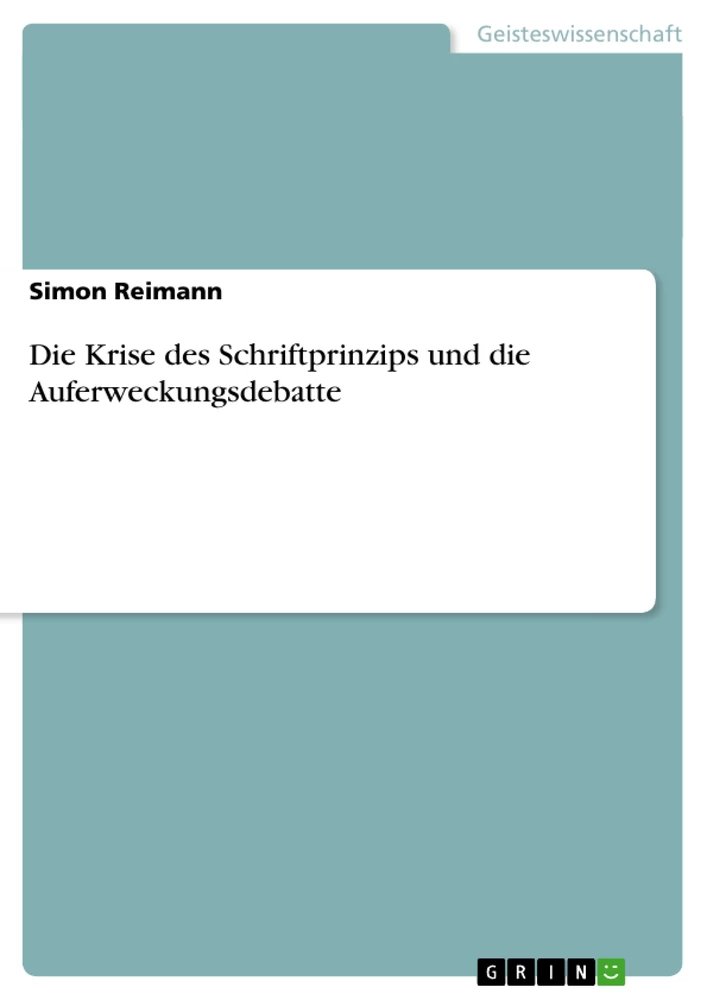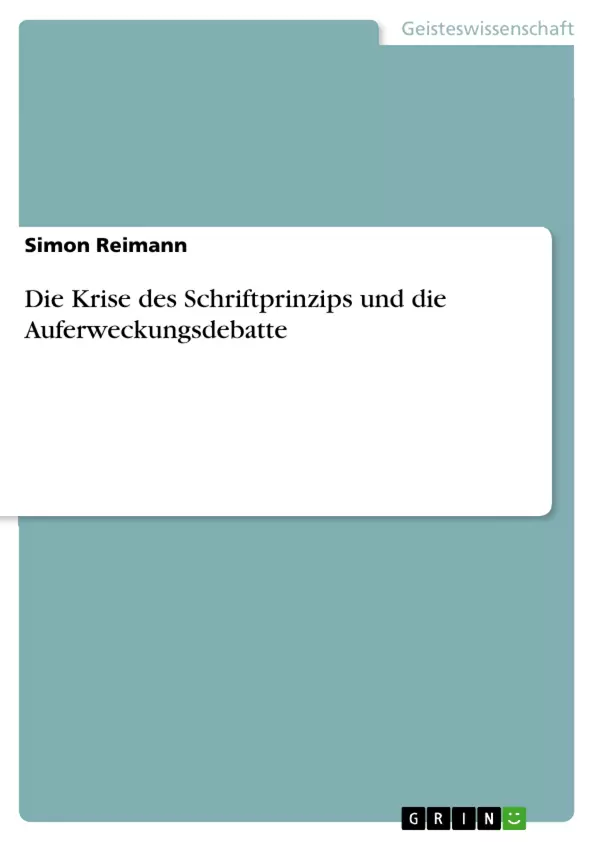Die vorliegende Arbeit widmet sich zwei thematisch scheinbar nur lose verbundenen Aufsätzen: der Krise des Schriftprinzips und der Frage: Volles Grab, leerer Glaube?. Hierzu soll zuerst die Krise des Schriftprinzips näher beleuchtet werden, wozu die Entwicklung des Schriftprinzips von seinen Anfängen ausgehend überblicksartig dargestellt wird, um besonders die Argumentationsstränge zu beleuchten, an denen sich die momentan konstatierte Krise entwickelte.
Anschließend soll der Aufsatz Volles Grab, leerer Glaube? betrachtet werden, wobei es weniger um Inhalt und Zusammenhänge der Auferweckungsdebatte geht, als um die Argumentationsweise Dalferths. Dieser führt die Standpunkte diverser Wissenschaften und Wissenschaftler zusammen und beleuchtet kritisch deren Beitrag zu Klärung der Frage. Dabei argumentiert er vom in der Schrift Gesagten ausgehend, und veranschaulicht en passant das theologische Potential des Schriftprinzips.
Da der Autor sich an anderer Stelle bereits Gedanken über die Zukunft des Schriftprinzips gemacht hat, kann dies durch Zufall oder Absicht zu einer Agenda des Aufsatzes geführt haben, welche eine Berechtigung und Nutzbarkeit des Schriftprinzips trotz Krise nahelegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Krise des Schriftprinzips
- Volles Grab gleich leerer Glaube? Das Schriftprinzip vor dem Hintergrund der Auferweckungsdebatte
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Krise des Schriftprinzips und beleuchtet die Auferweckungsdebatte im Kontext des Schriftprinzips. Dabei wird die Entwicklung des Schriftprinzips von seinen Anfängen bis zur aktuellen Krise dargestellt und die Argumentationsweise Dalferths in der Auferweckungsdebatte untersucht.
- Die Entwicklung und Krise des Schriftprinzips
- Die Auferweckungsdebatte und die Rolle des Schriftprinzips
- Die Argumentationsweise Dalferths
- Die Bedeutung des Schriftprinzips in der Theologie
- Die Frage nach der Universalität der Theologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit widmet sich der Krise des Schriftprinzips und der Auferweckungsdebatte, wobei die Argumentationsweise Dalferths im Vordergrund steht.
- Die Krise des Schriftprinzips: Die Geschichte des Schriftprinzips wird in unterschiedliche Phasen eingeteilt, beginnend mit Luther und der altprotestantischen Orthodoxie. Die Krise des Schriftprinzips ergibt sich aus der Tatsache, dass die Schrift nicht mehr als direktes Wort Gottes verstanden werden kann, sondern als Menschenwort. Dennoch bleibt die Schrift die höchste Autorität in Glaubensfragen.
- Volles Grab gleich leerer Glaube? Das Schriftprinzip vor dem Hintergrund der Auferweckungsdebatte: Dalferths Aufsatz zur Auferweckungsdebatte untersucht die Frage, ob das leere Grab für die theologische Bedeutung der Auferstehung Jesu entscheidend ist. Er argumentiert, dass die Erscheinungen Jesu wichtiger sind als das leere Grab und dass die Schrift aus sich selbst heraus verstanden werden muss. Er kritisiert auch den Rückzug der Theologie auf die biblischen Überlieferungen und plädiert für eine universelle Betrachtungsweise, die den Beitrag anderer Wissenschaften zur Erkenntnis der Wirklichkeit berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Schriftprinzip, die Krise des Schriftprinzips, die Auferweckungsdebatte, die Argumentationsweise Dalferths, die Universalität der Theologie, die Bedeutung des Schriftprinzips in der Theologie, die historische Entwicklung des Schriftprinzips, die Bedeutung der Schrift in der Theologie, die Interpretation der Schrift, die Rolle der Theologie in der Wissenschaft, die Frage nach der historischen Wahrheit, die Bedeutung der Erscheinungen Jesu, die Bedeutung des leeren Grabes, die Fraktalität der Wirklichkeit und die Lückenhaftigkeit der wissenschaftlichen Erkenntnis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Krise des Schriftprinzips"?
Die Krise entsteht daraus, dass die Heilige Schrift heute oft als Menschenwort und nicht mehr als direktes Wort Gottes verstanden wird, was ihre absolute Autorität in Frage stellt.
Welche Position vertritt Dalferth in der Auferweckungsdebatte?
Dalferth argumentiert, dass die Erscheinungen Jesu theologisch wichtiger sind als die Frage nach dem leeren Grab und beleuchtet das Potential des Schriftprinzips kritisch.
Wie hat sich das Schriftprinzip historisch entwickelt?
Die Arbeit skizziert den Weg von Luthers Anfängen über die altprotestantische Orthodoxie bis hin zur heutigen wissenschaftlich-kritischen Auseinandersetzung.
Ist das "leere Grab" entscheidend für den christlichen Glauben?
Die Arbeit untersucht Dalferths These "Volles Grab, leerer Glaube?", wobei er die Bedeutung der Schrift gegenüber rein historischen Fakten hervorhebt.
Was bedeutet "Universalität der Theologie" in diesem Kontext?
Es ist der Anspruch der Theologie, Beitrager anderer Wissenschaften zur Erkenntnis der Wirklichkeit zu berücksichtigen, anstatt sich nur auf biblische Überlieferungen zurückzuziehen.
Warum bleibt die Schrift trotz der Krise eine Autorität?
Trotz der Einordnung als Menschenwort bleibt sie für die Theologie die höchste Norm, da sie die Grundlage für die Interpretation des christlichen Glaubens bildet.
- Quote paper
- M. A. Simon Reimann (Author), 2013, Die Krise des Schriftprinzips und die Auferweckungsdebatte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266503